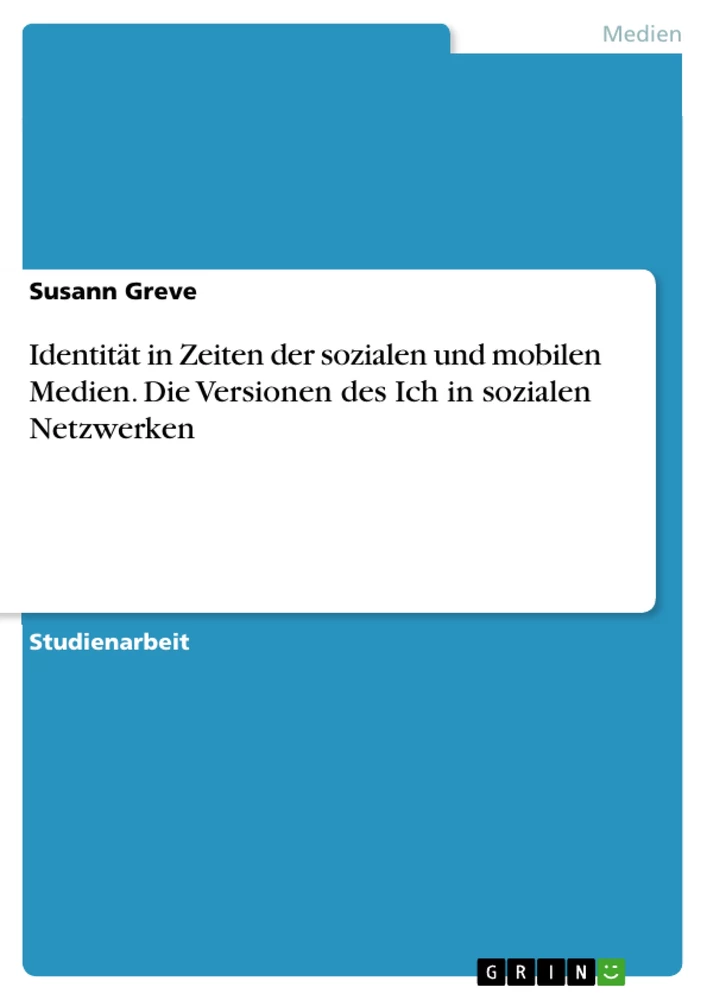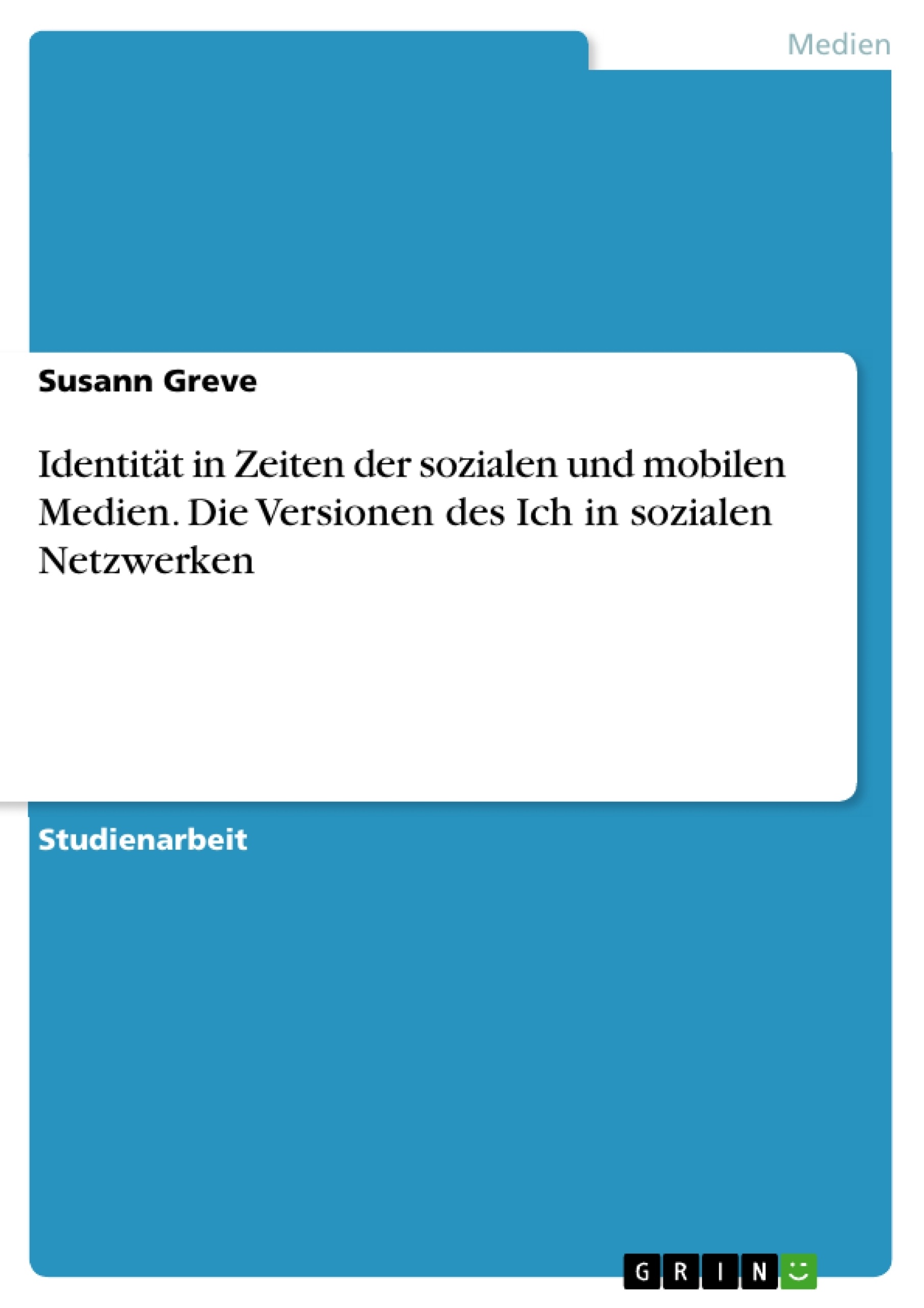Zielführend in dieser Arbeit soll es sein, die Möglichkeiten der Selbstdarstellung im Internet zu untersuchen und unter Einbeziehung der Transaktionsanalyse des Psychotherapeuten Eric Berne neue Optionen herauszuarbeiten. Im besonderen Fokus soll dabei die Frage danach stehen, inwiefern Nutzer von sozialen Netzwerken, je nach thematischer Ausrichtung der Plattform, divergente Rollen einnehmen bzw. sich selbst unterschiedlich präsentieren. Welche Facetten des Selbst nutzen sie dabei und in welchem Umfang? Fraglich ist auch, ob die unterschiedlichen Zustände des Ich, wie sie Berne in der Transaktionsanalyse beschreibt, ebenfalls auf die Selbstdarstellung in mobilen und sozialen Medien angewendet werden können.
Wenn wir im Internet surfen, was erwarten wir dann? Dass die Menschen, denen wir begegnen uns die Wahrheit über ihre Identität verraten oder dass sie uns eine Scheinidentität präsentieren? In den Zeiten verknüpfter Profile von Netzwerken wie Facebook, Twitter und Google ist es schwer, sich hinter einer Maske zu verstecken, da die Identität scheinbar transparent ist. Dennoch gibt es Netzwerke und Plattformen, auf denen der User wenig über sich preisgeben muss. Läuft man hier Gefahr auf eine Fake-Identität hereinzufallen? Grundsätzlich ist Authentizität ein wichtiger Faktor für viele Internetnutzer und wird aus diesem Grund, wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch herausgestellt werden soll, von diversen Theoretikern thematisiert. Welche Rolle die Aspekte Privatsphäre, Kriminalität und Öffentlichkeit dabei spielen, soll hier von untergeordneter Bedeutung sein. Es rückt besonders der Gedanke in den Vordergrund, auf welche Art und Weise der Nutzer sich selbst darstellen und was er dabei über sich lernen kann. „Selbstmanagement“ oder „Identitätsarbeit“ wird dieser Vorgang von Wissenschaftlern wie Nicola Döring und Christian Stiegler bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung.
- 2. Die Identität in Zeiten der sozialen und mobilen Medien
- 2.1. Formen der Identität..
- 2.2. Selbstmanagement.
- 3. Transaktionsanalyse und die Zustände des „Ich“ von Eric Berne
- 4. Möglichkeiten der Selbstdarstellung
- 4.1. Mittel der Selbstdarstellung...
- 4.2. Plattformen der Selbstdarstellung..
- 4.3. Besondere Formen der Selbstdarstellung
- 5. Beispielanalyse..
- 6. Zusammenfassung....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Selbstdarstellung im Internet unter Berücksichtigung der Transaktionsanalyse von Eric Berne. Sie analysiert, wie Nutzer von sozialen Netzwerken sich selbst präsentieren und welche Aspekte des Selbst sie dabei nutzen. Insbesondere soll die Frage geklärt werden, ob Bernes Theorie der Ich-Zustände auf die Selbstdarstellung in sozialen Medien angewendet werden kann.
- Moderne Identität im Internet
- Formen der Identität und Selbstmanagement
- Transaktionsanalyse und die Zustände des „Ich“ von Eric Berne
- Methoden der Selbstdarstellung in sozialen Medien
- Anwendbarkeit der Transaktionsanalyse auf die Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Selbstdarstellung im Internet und der Anwendbarkeit der Transaktionsanalyse von Eric Berne in diesem Kontext. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Theorien zur modernen Identität im Internet, darunter die Identität als „Subjekt der Aufklärung“, die Identität als „soziologisches Objekt“ und die Identität als „postmodernes Subjekt“. Es werden verschiedene Konzepte wie die „me and I-Theorie“ von George Herbert Mead und die Innen- und Außenperspektive von Nicola Döring diskutiert. Kapitel 3 gibt eine kurze Einführung in die Transaktionsanalyse von Eric Berne, die sich mit den verschiedenen Zuständen des „Ich“ befasst. In Kapitel 4 werden Möglichkeiten der Selbstdarstellung im Internet beleuchtet, darunter die Mittel der Selbstdarstellung, Plattformen der Selbstdarstellung und besondere Formen der Selbstdarstellung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Selbstdarstellung, soziale Medien, Identität, Transaktionsanalyse, Eric Berne, Ich-Zustände, Selbstmanagement, Privatsphäre, Authentizität, Online-Kommunikation, Web 2.0, Facebook, Twitter, Google, Jugendforschung, Medienanalyse, Medienästhetik
Häufig gestellte Fragen
Welche psychologische Theorie wird zur Untersuchung der Online-Identität genutzt?
Die Arbeit nutzt die Transaktionsanalyse von Eric Berne, insbesondere seine Theorie der verschiedenen „Ich-Zustände“.
Was ist das Ziel der Untersuchung der Selbstdarstellung im Internet?
Es soll geklärt werden, inwiefern Nutzer je nach Plattform unterschiedliche Rollen einnehmen und welche Facetten des Selbst sie dabei präsentieren.
Was verstehen Wissenschaftler unter „Identitätsarbeit“?
Wissenschaftler wie Nicola Döring bezeichnen damit den Vorgang, bei dem Nutzer sich im Netz selbst managen und darstellen, um über sich selbst zu lernen.
Sind Online-Identitäten in sozialen Netzwerken heute transparent?
Obwohl verknüpfte Profile Identitäten scheinbar transparent machen, existieren Plattformen, die wenig Preisgabe erfordern und somit Raum für Fake-Identitäten bieten.
Welche soziologischen Identitätskonzepte werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet Identität als „Subjekt der Aufklärung“, „soziologisches Objekt“ und „postmodernes Subjekt“.
- Arbeit zitieren
- Susann Greve (Autor:in), 2016, Identität in Zeiten der sozialen und mobilen Medien. Die Versionen des Ich in sozialen Netzwerken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334366