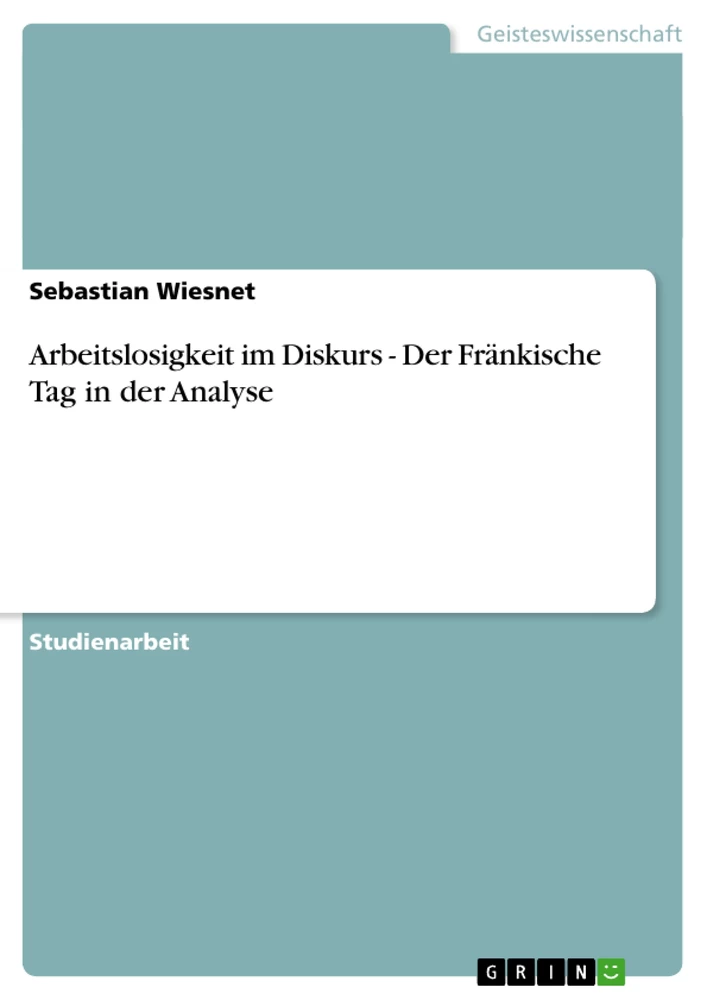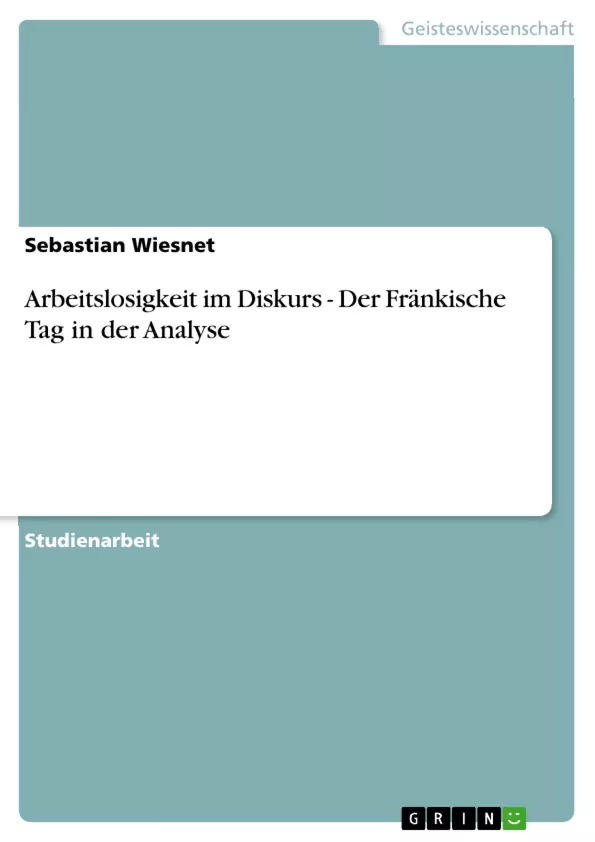Der Diskurs um die Arbeitslosigkeit hält die Nation in seinem Bann. Nicht nur, weil sich die Situation am Arbeitsmarkt dramatisch zuspitzt1, sondern auch weil jeder Bundesbürger direkt oder indirekt von der Erwerbslosigkeit betroffen ist. Seien es die Arbeitslosen selbst, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, seien es die Steuerzahler, welche für die zusätzlichen Belastungen aufkommen müssen, seien es die Rentner, welche sich mit faktischen Kürzungen ihrer Bezüge abfinden müssen, seien es Schüler und Studenten, die Einschnitten ins Bildungssystem fürchten müssen, seien es die Gewerkschaften, welche aufgrund gesunkener Mitgliederzahlen Legitimitätseinbußen hinzunehmen haben, oder seien es die Bundes- und Länderregierung(en), welche aufgrund ihres „Versagens“ um ihre Wiederwahl bangen müssen. Jedweder Diskurs – so auch derjenige um die Arbeitslosigkeit – wird von Sprechern und Repräsentanten verschiedener sozialer Gruppen getragen und über die Medien vermittelt2. Im Rahmen des Proseminars „Kommunikation, Medien und Kultur – Printmedien und öffentliche Diskurse“ stellten sich daher primär zwei Fragen: 1. Welche Funktionen erfüllen die einzelnen Printmedien im Diskurs bzw. beschränken sich diese Medien ausschließlich auf ihre Vermittlerfunktion? Und 2. Welche Funktion kommt den auftretenden Akteuren zu? Ziel der folgenden Ausführungen ist es, Antworten auf diese beiden Fragen zu finden. Um die abschließenden Ergebnisse nachvollziehen und beurteilen zu können, ist es jedoch nötig, sich zunächst einen Überblick über den exakten Forschungsgegenstand sowie über das geplante Vorgehen zu verschaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Daten und Vorgehen
- Das Vorverständnis des Forschers
- Quantitative Analyse
- Wichtigkeit/Relevanz des Themas
- Umfang der Berichte
- Aufmachung
- Standardisierung der Berichterstattung
- Komplexität der Sprache
- Drucktechnische Besonderheiten
- Einsatz von Mitteln zur Vereinfachung der Informationsverarbeitung
- Zusammenfassung
- Qualitative Analyse
- Themenstruktur
- globale Themenstruktur
- Haupt- und Nebenthemen
- Thematische Veränderungen
- Zusammenfassung
- Analyse der Berichterstattung
- Einzelanalyse der Berichte
- Kritik an der Einzelanalyse
- Zusammenfassung der Ergebnisse der Einzelanalyse
- Akteurszentrierte Analyse
- Auftretende Akteure
- Akteure im Wandel der Zeit
- Die Äußerungen der Akteure vor dem Hintergrund ihrer Interessen, Wertestrukturen und Funktionen
- Zusammenfassung
- Themenstruktur
- Fazit und abschließende Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Arbeitslosigkeit im „Fränkischen Tag“ zwischen 1964 und 2000. Ziel ist es, die Funktion der Zeitung im Diskurs um Arbeitslosigkeit zu analysieren und die Rolle der darin auftretenden Akteure zu beleuchten. Die Analyse kombiniert quantitative und qualitative Methoden.
- Die Darstellung von Arbeitslosigkeit in einer regionalen Zeitung.
- Quantitative und qualitative Analyse der Berichterstattung im „Fränkischen Tag“.
- Identifizierung und Analyse der im Diskurs auftretenden Akteure.
- Entwicklung der Berichterstattung über Arbeitslosigkeit im Laufe der Zeit.
- Die Funktion von Printmedien im Diskurs um soziale Themen.
Zusammenfassung der Kapitel
Daten und Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung. Aufgrund von zeitlichen und personellen Einschränkungen konzentrierte sich die Analyse auf Artikel des „Fränkischen Tags“, die im April nach der Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen erschienen. Es wird die Kombination quantitativer und qualitativer Methoden erläutert und die Herausforderungen einer solchen Analyse im Rahmen eines Proseminars beleuchtet, insbesondere die Limitationen hinsichtlich Intersubjektivität aufgrund der Arbeit an nur einem Medium durch einen einzelnen Studenten. Das Kapitel legt den Grundstein für die folgenden Analysen und verdeutlicht die Grenzen der Studie.
Das Vorverständnis des Forschers: Hier reflektiert der Autor sein eigenes Vorverständnis des Themas, welches durch seine zeitliche Distanz zu den untersuchten Jahren (1964-2000) geprägt ist. Er betont seinen Bezugspunkt als in einer globalisierten und informationsgesättigten Gesellschaft aufgewachsener Mensch und die daraus resultierende Perspektive auf die untersuchte Berichterstattung. Diese Reflexion dient der Transparenz und der kritischen Einordnung der Ergebnisse.
Quantitative Analyse: In diesem Kapitel werden die quantitativen Aspekte der Berichterstattung des „Fränkischen Tags“ analysiert. Hier werden Aspekte wie die Wichtigkeit des Themas, der Umfang der Berichte, die Aufmachung, die Standardisierung, die Komplexität der Sprache, die drucktechnischen Besonderheiten und der Einsatz von Mitteln zur Vereinfachung der Informationsverarbeitung untersucht. Die Ergebnisse dieser statistischen Auswertung liefern wichtige Grundlagen für die anschließende qualitative Analyse.
Qualitative Analyse: Dieses Kapitel beinhaltet eine qualitative Analyse, gegliedert in drei Teilabschnitte: die Themenstruktur, die Analyse der Berichterstattung anhand von "news schemata" nach van Dijk, und eine akteurszentrierte Analyse. Der erste Teil fokussiert auf die Themenschwerpunkte und deren Entwicklung. Der zweite Teil untersucht die Struktur und Funktionen der Berichterstattung einzelner Artikel. Der dritte Abschnitt analysiert die beteiligten Akteure, ihre Positionen und ihre Rolle im Diskurs. Die qualitative Analyse vertieft das Verständnis der Berichterstattung und deutet die Ergebnisse der quantitativen Analyse.
Schlüsselwörter
Arbeitslosigkeit, Diskursanalyse, Printmedien, „Fränkischer Tag“, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Akteure, Berichterstattung, Medienfunktion, Informationsgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Arbeitslosigkeitsberichterstattung im Fränkischen Tag (1964-2000)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Arbeitslosigkeit im „Fränkischen Tag“ zwischen 1964 und 2000. Ziel ist es, die Funktion der Zeitung im Diskurs um Arbeitslosigkeit zu analysieren und die Rolle der darin auftretenden Akteure zu beleuchten. Die Analyse kombiniert quantitative und qualitative Methoden.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden. Die quantitative Analyse untersucht Aspekte wie Umfang der Berichte, Aufmachung, Komplexität der Sprache und den Einsatz von Vereinfachungsmitteln. Die qualitative Analyse umfasst die Themenstruktur, die Analyse der Berichterstattung anhand von "news schemata" nach van Dijk und eine akteurszentrierte Analyse.
Welche Aspekte der Berichterstattung wurden quantitativ untersucht?
Die quantitative Analyse betrachtet die Wichtigkeit/Relevanz des Themas, den Umfang der Berichte, die Aufmachung, die Standardisierung der Berichterstattung, die Komplexität der Sprache, drucktechnische Besonderheiten und den Einsatz von Mitteln zur Vereinfachung der Informationsverarbeitung.
Wie wurde die qualitative Analyse durchgeführt?
Die qualitative Analyse gliedert sich in drei Teile: 1. Themenstruktur (globale Themenstruktur, Haupt- und Nebenthemen, thematische Veränderungen); 2. Analyse der Berichterstattung (Einzelanalyse der Berichte, Kritik an der Einzelanalyse, Zusammenfassung der Ergebnisse); 3. Aktteurszentrierte Analyse (Auftretende Akteure, Akteure im Wandel der Zeit, Äußerungen der Akteure vor dem Hintergrund ihrer Interessen, Wertestrukturen und Funktionen).
Welche Daten wurden verwendet?
Aufgrund von zeitlichen und personellen Einschränkungen konzentrierte sich die Analyse auf Artikel des „Fränkischen Tags“, die im April nach der Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen erschienen.
Welche Limitationen weist die Studie auf?
Die Studie weist Limitationen hinsichtlich der Intersubjektivität auf, da sie nur ein Medium (den „Fränkischen Tag“) und nur die Berichterstattung im April nach der Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen betrachtet, und von einem einzelnen Studenten durchgeführt wurde.
Welche Akteure wurden analysiert?
Die akteurszentrierte Analyse untersucht die im Diskurs auftretenden Akteure, ihre Positionen und ihre Rolle im Diskurs, sowie deren Wandel im Laufe der Zeit und die Hintergründe ihrer Äußerungen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu einem Fazit und einer abschließenden Kritik, die auf den Ergebnissen der quantitativen und qualitativen Analysen beruhen. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text der Arbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Arbeitslosigkeit, Diskursanalyse, Printmedien, „Fränkischer Tag“, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Akteure, Berichterstattung, Medienfunktion, Informationsgesellschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, eine Zusammenfassung der Kapitel (Daten und Vorgehen, Das Vorverständnis des Forschers, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Fazit und abschließende Kritik) und Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Sebastian Wiesnet (Author), 2004, Arbeitslosigkeit im Diskurs - Der Fränkische Tag in der Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33447