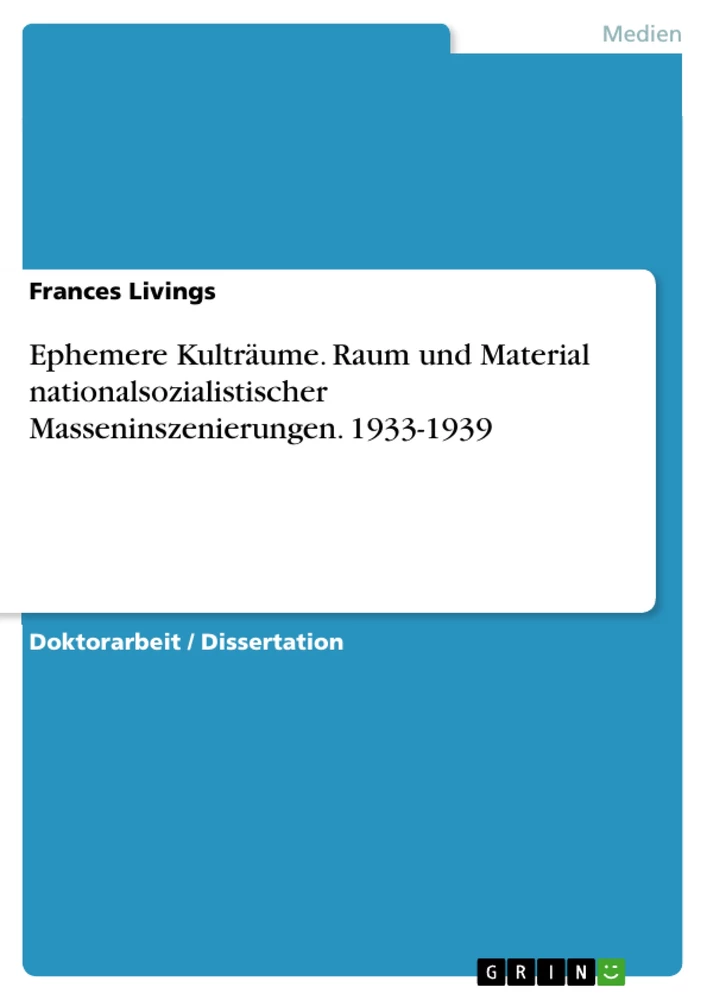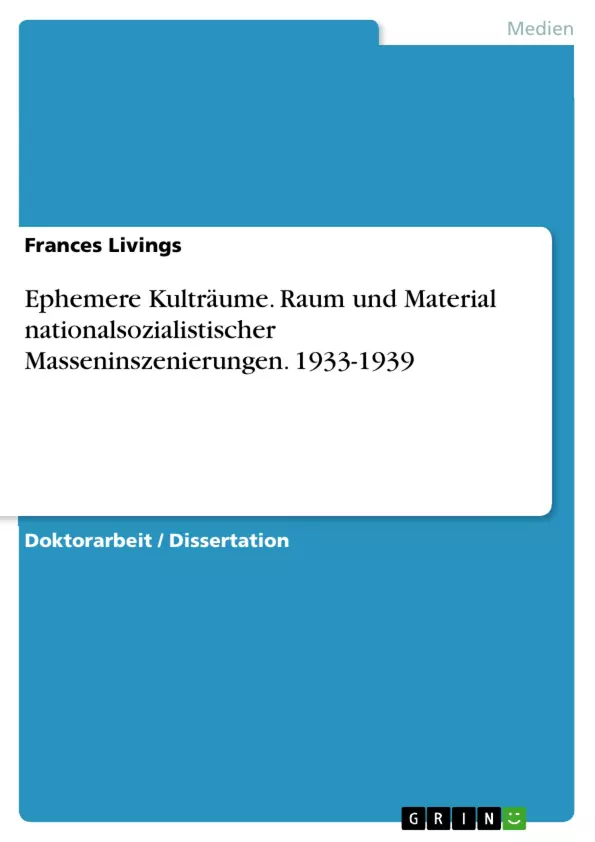Im Nationalsozialismus bildeten Festplätze und Paradestraßen unmenschlichen Maßstabes den Handlungsrahmen politischer Massenfeiern. An neu verordneten und kalendarisch fest verankerten Feiertagen wurde die Nation als Mythos beschworen. Dabei sollte an eine Opfer- und Vernichtungsbereitschaft appelliert werden, die sich teilweise sogar in inszenierten Kriegsspielen, vor allem aber in der ideologischen Umformung, Belegung und politischen Verwendung von Raum und Material artikulierte.
Ob zum Reichserntedankfest oder zum Heldengedenktag – alle Festplätze wurden reichsweit mit einem festgelegten und ritualisierten Schmückungsapparat „gleichgeschaltet“, den man in nur kurzer Zeit etabliert hatte, und der als Zeichen völkischer Verbundenheit dienen sollte. Entsprechend war die obligatorische und aktive Beteiligung der Bevölkerung an einer reichsweiten Schmückung zu lesen.
Analog zur Darstellung und Propagierung von Hitler als messianische Lichtgestalt wurden diese Feierstätten als quasi-religiöse Kulträume inszeniert: Einerseits durch eine liturgische Ausstattung, die den quasi-religiösen Handlungen diente, und andererseits durch ihre Abgrenzung von profanen Alltagsbezügen, wie von großstädtischen Kulissen. Ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist der konträre Umgang mit verschiedenen vorgegebenen Topografien und die Herrschaftsmerkmale, die sich daraus ergaben. Die bauliche Gestaltung der städtischen Festplätze war durchaus eine denkmalhafte Inszenierung – wie die Ruinen des Reichsparteitagsgeländes noch heute zeigen – und ihre auffälligsten Gestaltungsmerkmale und Materialien sind dauerhafter Art. Der nationalsozialistische Festraum erhielt jedoch seine vollkommenste Ausformung durch ephemere Mittel – wie Licht und Feuer, Fahnenbanner und „Menschenmaterial“. Denn die aus dauerhaftem Material geschaffenen Elemente, wie Pylonen oder Pflastersteine, fungierten vielfach lediglich als Platzhalter, Projektionsflächen oder gar Parameter.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1. Die Neuordnung von Zeit und Raum
- I. Der nationalsozialistische Festtagskalender: Die Neuordnung von Zeit
- 1. Die volkserzieherische Aufgabe der politischen Feier
- 2. Der Festtagskalender
- 2.1 Propagandistische Einheitskalender
- 3. Feste der Gemeinschaft: Die Okkupation von öffentlicher und privater Lebenssphäre
- 4. Zusammenfassung: Die Erzeugung von Tradition und Geschichte
- II. ‚Angewandter Nationalsozialismus‘
- III. Die Neuordnung von öffentlichem Raum
- IV. Der Festschmuck
- V. Der staatlich kontrollierte Schmückungsapparat
- I. Der nationalsozialistische Festtagskalender: Die Neuordnung von Zeit
- Kapitel 2. Der städtische Festraum
- I. Städtische Festplätze: Berlin
- 1. Das Erbe preußischer Ordnung und großstädtischer Unordnung
- 2. Die Ausgestaltung des Tempelhofer Feldes für die Feiern zum 1. Mai
- 2.1 Tribünenanlagen
- 3. Die Verlagerung des Hauptkundgebungsplatzes: Der Lustgarten
- 3.1 Leer Räumen, Pflastern, Ordnen und Markieren: Der Boden des Festplatzes
- 4. Die liturgische Struktur des Raums
- 4.1 Monumentale Freitreppen und Altäre
- 5. Fahnenwände: Die Isolation des Platzes und die Negation der Stadt
- 5.1 Die Bedeutung der Blutfahne
- 5.2 Von der ‚farbigen Architektur‘ zur uniformen Architektur
- 5.3 Dynamische Architektur?
- II. München: ‚Tod, Macht und Raum‘
- III. Monofunktionale Festplätze: Nürnberg
- IV. Zusammenfassung: Vom Feld zum Platz
- V. Die Feststraße
- I. Städtische Festplätze: Berlin
- Kapitel 3. Politische Kulträume in der Naturlandschaft
- Kapitel 4. ‚Utopia‘ – Feuerräume und Lichtarchitektur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ästhetische Ausformung zentraler Massenfeiern im Nationalsozialismus. Der Fokus liegt auf dem Umgang mit Raum und Material als Ausdrucksmittel autoritärer Herrschaftsgewalt, wobei sowohl dauerhafte als auch ephemerere Gestaltungsmittel betrachtet werden. Die Analyse konzentriert sich auf die exemplarische Untersuchung ausgewählter Feierraüme in Berlin, München, Nürnberg und Hameln.
- Die Neuordnung von Zeit und Raum durch den nationalsozialistischen Festtagskalender und die Schaffung von Ritualen.
- Die Gestaltung städtischer Kulträume (Berlin, München, Nürnberg).
- Die Inszenierung von Kulträumen in der Naturlandschaft (Bückeberg).
- Der Einsatz von Feuer und Licht als Gestaltungsmittel und ihre politische Symbolik.
- Die Rolle ephemerer Materialien im Vergleich zu dauerhaften Bauten.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die optische Präsenz der NSDAP im öffentlichen Raum nach der "Machtergreifung" und die Schaffung riesiger politischer Festräume. Sie erläutert den Forschungsstand und die Ziele der Arbeit, die sich auf die ästhetische Ausformung zentraler Massenfeiern und den Umgang mit Raum und Material konzentriert.
Kapitel 1. Die Neuordnung von Zeit und Raum: Dieses Kapitel behandelt die nationalsozialistische Neuordnung von Zeit und Raum durch die Einrichtung eines politischen Festtagskalenders, die Schaffung und Verankerung von Ritualen und die gesellschaftliche Bedeutung von Festräumen. Es analysiert den staatlich gelenkten Organisationsapparat und die Entwicklung eines spezifischen nationalsozialistischen Feierstils.
Kapitel 2. Der städtische Festraum: Dieses Kapitel untersucht die Gestaltung städtischer Festräume in Berlin, München und Nürnberg. Es analysiert die Umgestaltung bestehender Plätze und die Schaffung neuer Feierstätten, die Rolle von Tribünen, Fahnen und der Platzpflasterung, sowie die liturgische Struktur der Räume und die mediale Verbreitung der politischen Inszenierungen.
Kapitel 3. Politische Kulträume in der Naturlandschaft: Dieses Kapitel fokussiert auf die Inszenierung politischer Kulträume in der Natur, insbesondere die Reichserntedankfeste am Bückeberg. Es untersucht die Verwendung von Naturmaterialien, die Symbolik von Blut und Boden, und den Versuch, den Bückeberg als germanische Thingstätte zu etablieren.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Masseninszenierungen, Festräume, Festkultur, Architektur, Stadtplanung, Materialikonographie, Ephemeralität, Propaganda, Rituale, Symbolik, Licht, Feuer, Fahnen, Blut und Boden, Volksgemeinschaft, Führerkult, Olympia 1936, Reichsparteitage, Thingstätten, Bückeberg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ästhetische Ausformung zentraler Massenfeiern im Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ästhetische Gestaltung von Massenfeiern im Nationalsozialismus. Der Fokus liegt auf der Nutzung von Raum und Material als Mittel zur Darstellung autoritärer Herrschaft, sowohl bei dauerhaften als auch ephemeren Gestaltungselementen. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Feierraume in Berlin, München, Nürnberg und Hameln.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Neuordnung von Zeit und Raum durch den nationalsozialistischen Festtagskalender und die damit verbundenen Rituale. Sie analysiert die Gestaltung städtischer und natürlicher Kulträume, den Einsatz von Feuer und Licht als Gestaltungsmittel und deren politische Symbolik, sowie die Rolle ephemerer Materialien im Vergleich zu dauerhaften Bauten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, Kapitel 1 ("Die Neuordnung von Zeit und Raum"), Kapitel 2 ("Der städtische Festraum"), Kapitel 3 ("Politische Kulträume in der Naturlandschaft") und Kapitel 4 ("'Utopia' – Feuerräume und Lichtarchitektur"). Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten der Inszenierung nationalsozialistischer Massenfeiern.
Was wird im Kapitel 1 ("Die Neuordnung von Zeit und Raum") behandelt?
Kapitel 1 untersucht die nationalsozialistische Neuordnung von Zeit und Raum durch den Festtagskalender, die Schaffung von Ritualen und die gesellschaftliche Bedeutung von Festräumen. Es analysiert den staatlich gelenkten Organisationsapparat und die Entwicklung eines spezifischen nationalsozialistischen Feierstils.
Was wird im Kapitel 2 ("Der städtische Festraum") behandelt?
Kapitel 2 analysiert die Gestaltung städtischer Festräume in Berlin, München und Nürnberg. Es untersucht die Umgestaltung bestehender Plätze, die Schaffung neuer Feierstätten, die Rolle von Tribünen, Fahnen und der Platzpflasterung, die liturgische Struktur der Räume und die mediale Verbreitung der politischen Inszenierungen.
Was wird im Kapitel 3 ("Politische Kulträume in der Naturlandschaft") behandelt?
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Inszenierung politischer Kulträume in der Natur, insbesondere die Reichserntedankfeste am Bückeberg. Es untersucht die Verwendung von Naturmaterialien, die Symbolik von Blut und Boden, und den Versuch, den Bückeberg als germanische Thingstätte zu etablieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Nationalsozialismus, Masseninszenierungen, Festräume, Festkultur, Architektur, Stadtplanung, Materialikonographie, Ephemeralität, Propaganda, Rituale, Symbolik, Licht, Feuer, Fahnen, Blut und Boden, Volksgemeinschaft, Führerkult, Olympia 1936, Reichsparteitage, Thingstätten, Bückeberg.
Welche Städte werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht exemplarisch ausgewählte Feierraume in Berlin, München, Nürnberg und Hameln.
Welche Art von Materialien werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse berücksichtigt sowohl dauerhafte als auch ephemerere Gestaltungsmittel, um ein umfassendes Bild der ästhetischen Ausformung nationalsozialistischer Massenfeiern zu liefern.
Welchen Zweck verfolgt die Analyse der Raumgestaltung?
Die Analyse der Raumgestaltung zielt darauf ab, den Umgang mit Raum und Material als Ausdrucksmittel autoritärer Herrschaftsgewalt zu verstehen und zu untersuchen, wie diese Mittel eingesetzt wurden, um die politische Ideologie des Nationalsozialismus zu propagieren.
- Quote paper
- Frances Livings (Author), 2003, Ephemere Kulträume. Raum und Material nationalsozialistischer Masseninszenierungen. 1933-1939, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334546