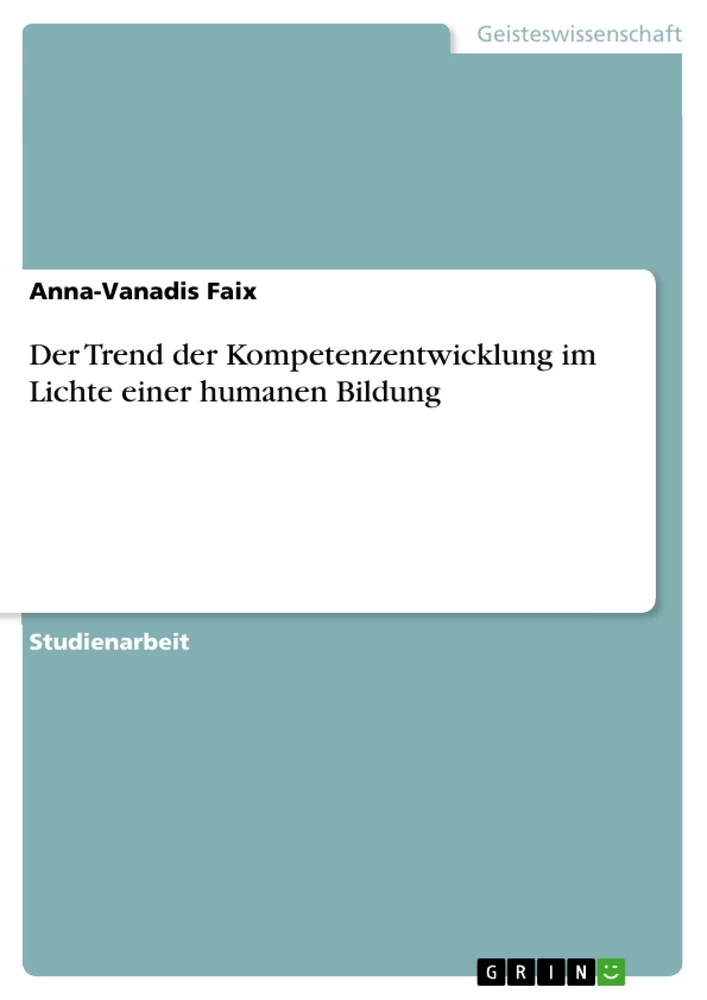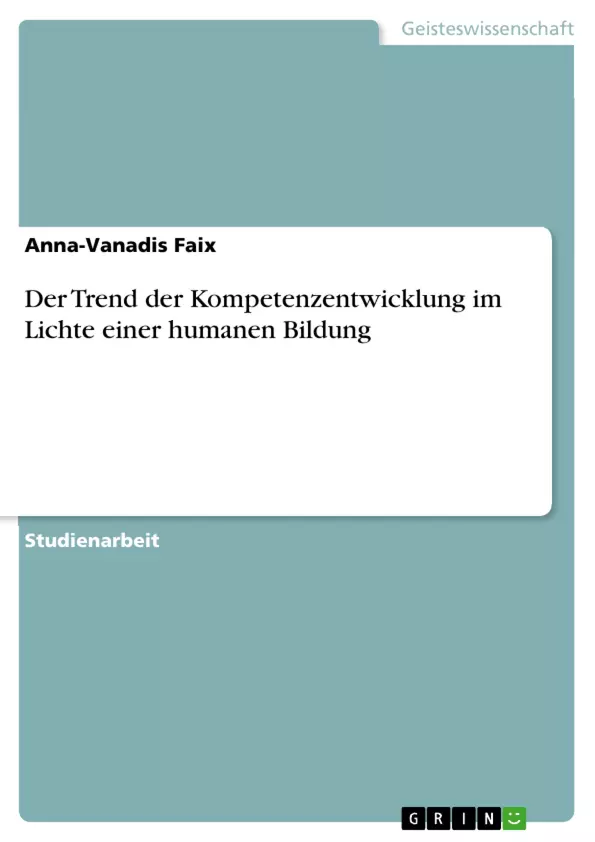Nicht erst seit PISA oder anderen Vergleichstests, wie dem TIMSS, wird über Bildung – also auch darüber was Schüler im Laufe ihrer Schulbahn lernen, was sie an Bildung erfahren und welche Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse sie erwerben sollen – nachgedacht. Die aktuelle Debatte und die implementierten Schulleistungsstudien haben dabei neue Begrifflichkeiten geschaffen, die den Fragenkatalog für die Umsetzung in der Schule sogar noch erweitern. So steht seitdem vor allem der Begriff der Kompetenz im Zentrum neuerer pädagogischer Überlegungen und findet dadurch Einzug auf nationaler und auch internationaler (Projekt-)Ebene.
Die Kontroverse um den Kompetenzbegriff will die vorliegende Arbeit näher im Lichte der angeschnittenen Konzeption einer humanen Bildung betrachten. Die Hauptthese dabei ist, dass durch eine Um- bzw. Neudefinition der Verwendung des Kompetenzbegriffes viel vor dem Hintergrund einer humanen Bildung gewonnen werden kann, und so überhaupt erst zu dem geforderten autonomen Menschen beiträgt, den wir aus Sicht der Humanität für anthropologisch wünschenswert halten.
In einem ersten Schritt soll dabei näher auf die vorrangig verwendete Definition der Kompetenzen und ihrer Praxis in der Bildung eingegangen werden, die vor allem seit der Bologna-Reform Einzug in das deutsche Bildungssystem hält. Hierzu wird genauer auf die Konzeption einer humanen Bildung nach Nida-Rümelin eingegangen. Vor diesem angestrebten Hintergrund zeigen sich dann deutlich die gravierenden Schwächen des Kompetenztrends. Allgemein argumentiert die Arbeit im Grundsatz für Nida-Rümelins humane Bildung, die sich wie fast alle humanen Bildungskonzepte an den Idealen Humboldts orientiert. Hierbei steht vor allem die derzeitige Instrumentalisierung der Bildung als Kritik im Vordergrund, und es wird ein Umdenken gefordert, welches die Bildung in ihrem Selbstwert sieht, den Mensch als ganze Persönlichkeit wahrnimmt und ihn zum Autor seines eigenen (kohärenten) Lebens macht.
Aus dieser Grundannahme heraus stellt sich die Frage, wie der Mensch zum Autor seines Lebens durch Bildung werden kann. Diese Frage soll weiter spezifiziert werden und an Nida-Rümelins-Ansatz anknüpfen: Wie kann die Autonomie einer Persönlichkeit überhaupt in der direkten Bildung gefördert werden? Hierzu wird ein Ansatz Kants betrachtet, der eine ausdifferenzierte Form in Neimans Thematik des Erwachsenwerdens findet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I.) Einleitung
- II.) Der aktuelle Bildungstrend: Kompetenz
- III.) Philosophie einer humanen Bildung
- III.1.) Humane Bildung nach Nida-Rümelin
- III.2.) Kritik am definierten Kompetenzbegriff
- IV.) Vom Erwachsenwerden und dem Reifungsprozess der Vernunft
- V.) Kompetenzen im Lichte der humanen Bildung
- VI.) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht die Kontroverse um den Kompetenzbegriff im Kontext der humanen Bildung. Sie argumentiert, dass eine Neudefinition des Kompetenzbegriffes im Sinne einer humanen Bildung zu einem autonomen Menschen beitragen kann, der als wünschenswert angesehen wird.
- Die aktuelle Definition des Kompetenzbegriffes im Bildungssystem, vor allem seit der Bologna-Reform.
- Die Konzeption einer humanen Bildung nach Nida-Rümelin und ihre Kritik am Kompetenztrend.
- Die Bedeutung des Erwachsenwerdens und der Urteilskraft für die Entwicklung eines autonomen Menschen.
- Die Relevanz von Kompetenzen für die Förderung der Autonomie in der Bildung.
- Eine alternative Definition von Kompetenzen als Disposition für selbstorganisiertes Handeln in unsicheren Situationen.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Grundthese der Arbeit vor und beleuchtet die aktuelle Debatte um Bildung und den Einfluss von Kompetenzkonzepten. Es wird auf die Notwendigkeit eines Umdenkens hingewiesen, welches Bildung im Sinne eines humanen Bildungsideals sieht, das den Menschen als Ganzes in den Blick nimmt.
Kapitel II beschreibt den aktuellen Trend des Kompetenzbegriffes und die dominierende Definition von Weinert, die die Anwendbarkeit von Wissen und Fähigkeiten in den Vordergrund stellt. Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Facetten des Kompetenzbegriffes und seine breite Anwendung in der Bildung.
Kapitel III stellt die Konzeption einer humanen Bildung nach Nida-Rümelin vor und kritisiert die Schwächen des Kompetenztrends. Es argumentiert für eine Bildung, die den Menschen als Autor seines eigenen Lebens sieht und die Entwicklung seiner Persönlichkeit in den Fokus stellt.
Kapitel IV widmet sich der Frage, wie der Mensch durch Bildung zum Autor seines Lebens werden kann. Es stellt den Ansatz Kants zur Förderung der Autonomie der Persönlichkeit vor und verknüpft diesen mit Neimans Thematik des Erwachsenwerdens.
Kapitel V beschäftigt sich mit der Relevanz von Kompetenzen im Lichte der humanen Bildung. Es entwickelt eine alternative Definition von Kompetenzen als Disposition für selbstorganisiertes Handeln, die in Verbindung mit dem Erwachsenwerden und der Urteilskraft die Entwicklung eines autonomen Menschen fördert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen humane Bildung, Kompetenzentwicklung, Autonomie, Erwachsenwerden, Urteilskraft und selbstorganisiertes Handeln. Sie beleuchtet die Kontroverse zwischen dem aktuellen Trend des Kompetenzbegriffes und einem humanen Bildungsideal.
Häufig gestellte Fragen zu Kompetenz und Bildung
Was wird am aktuellen Kompetenztrend in der Bildung kritisiert?
Kritisiert wird die Instrumentalisierung der Bildung, die den Menschen oft nur auf verwertbare Fertigkeiten reduziert, statt ihn als ganze Persönlichkeit zu fördern.
Was versteht Julian Nida-Rümelin unter „humaner Bildung“?
Humane Bildung orientiert sich an Humboldts Idealen und sieht Bildung als Selbstwert, der den Menschen zum Autor seines eigenen, kohärenten Lebens macht.
Wie definiert die Arbeit „Kompetenz“ alternativ?
Kompetenz wird als Disposition für selbstorganisiertes Handeln in unsicheren Situationen verstanden, was die Autonomie der Persönlichkeit stärkt.
Welchen Einfluss hatte die Bologna-Reform auf den Kompetenzbegriff?
Die Reform hat den Fokus im deutschen Bildungssystem verstärkt auf messbare Kompetenzen und die Anwendbarkeit von Wissen verschoben.
Wie hängen Autonomie und Erwachsenwerden zusammen?
Anknüpfend an Kant und Neiman wird das Erwachsenwerden als Reifungsprozess der Vernunft gesehen, der erst durch eine humane Bildung ermöglicht wird.
- Quote paper
- Anna-Vanadis Faix (Author), 2016, Der Trend der Kompetenzentwicklung im Lichte einer humanen Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334558