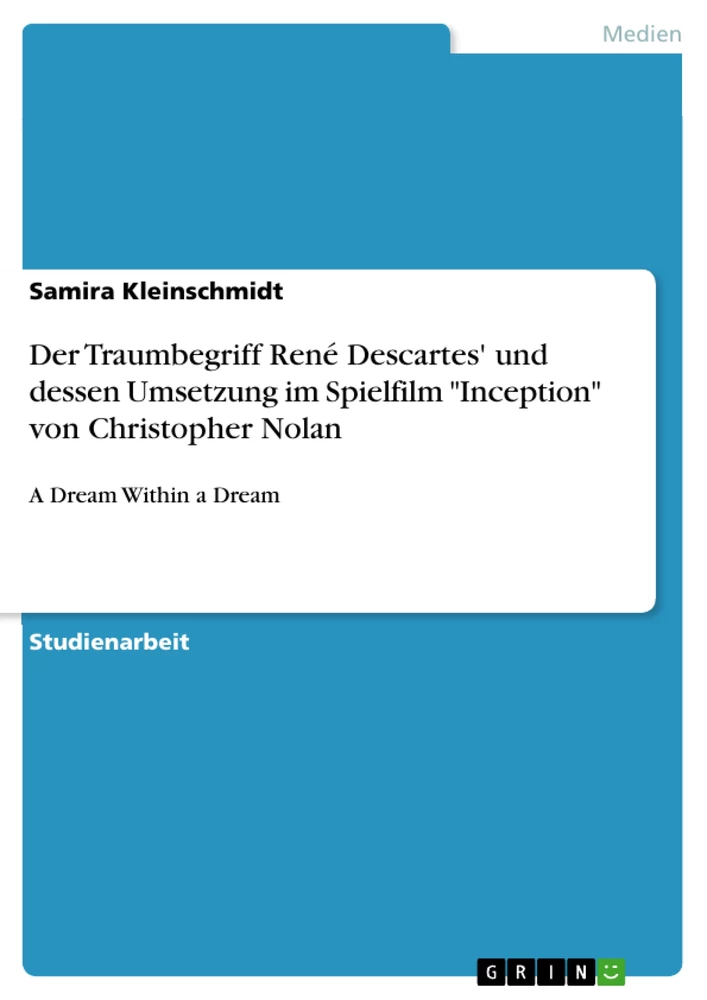In seinem Gedicht "A Dream within a Dream" beschreibt der Autor Edgar Allan Poe die Unwirklichkeit einer Begegnung. Sie scheint zeitgleich real und löst im Lyrischen Ich die Assoziation an einen Traum aus, so dass es sich nicht sicher sein kann, ob sie wahr ist oder nicht. Was ihm zuvor glasklar erscheint – dass alles, was wir sehen und was wir zu sein scheinen, nur ein Traum in einem Traum ist –, zieht es zum Schluss des Gedichts wieder in Zweifel. So ist letztendlich nichts gewiss; das Lyrische Ich bleibt in einem Zustand, in dem es sich nicht sicher sein kann, ob das, was es für wahr hält, nicht nur ein Traum ist und umgekehrt.
Um diese Ungewissheit soll es in der vorliegenden Arbeit gehen. Den Zweifel als Ausgangspunkt nehmend, findet man beim französischen Philosophen René Descartes eine aufklärerische Herangehensweise an die Fragen der Metaphysik. In Descartes‘ Meditationes de prima philosophia wird, genau wie in Poes Gesicht, in Zweifel gezogen, was mit den Sinnen erfahren wird. Eine radikale Erkenntnis dieser Sichtweise ist, dass nichts, was man für wahrhaftig hält, es auch tatsächlich ist. So könnten wir alle träumen, ohne es zu merken oder wach sein, in dem Glauben zu träumen. Diese Grundannahme, die in den Meditationes formuliert wird, dient in dieser Arbeit als Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Distinktion von Traum und Wirklichkeit in Christopher Nolans Spielfilm "Inception".
Der Spielfilm "Inception", der 2010 in die Kinos kam und eine der beliebtesten Arbeiten des amerikanischen Regisseurs ist, enthält eine ähnliche Lesart; am Ende von Christopher Nolans Film ist sich der Zuschauer nicht sicher, was von dem, was dem Protagonisten passiert ist, ein Traum und was wahr gewesen ist. In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie sich Descartes‘ diskursiver Ansatz in der Erzählstruktur und der daraus folgenden Konstruktion von Wirklichkeit und unterschiedlichen Bedeutungsebenen des Films wiederfindet, der über 500 Jahre später erschien.
INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis Anhang
1. Einleitung
2. Wirklichkeit und Traum bei Descartes
2.1. Über die Konstruktion von Wirklichkeit in den Meditationes de prima philosophia
2.2. Erörterung eines Traumbegriffs
3. Wirklichkeit und Traum in Inception
3.1. Vorikonographische Beschreibung der Handlung
3.2. Der Traum im Traum - Struktureller Aufbau des Spielfilms
3.3. Der Versuch einer Befestigung: Das Totem
4. Die Umsetzung des Traumbegriffs Descartes‘ in Inception
Anhang
Literaturverzeichnis
-
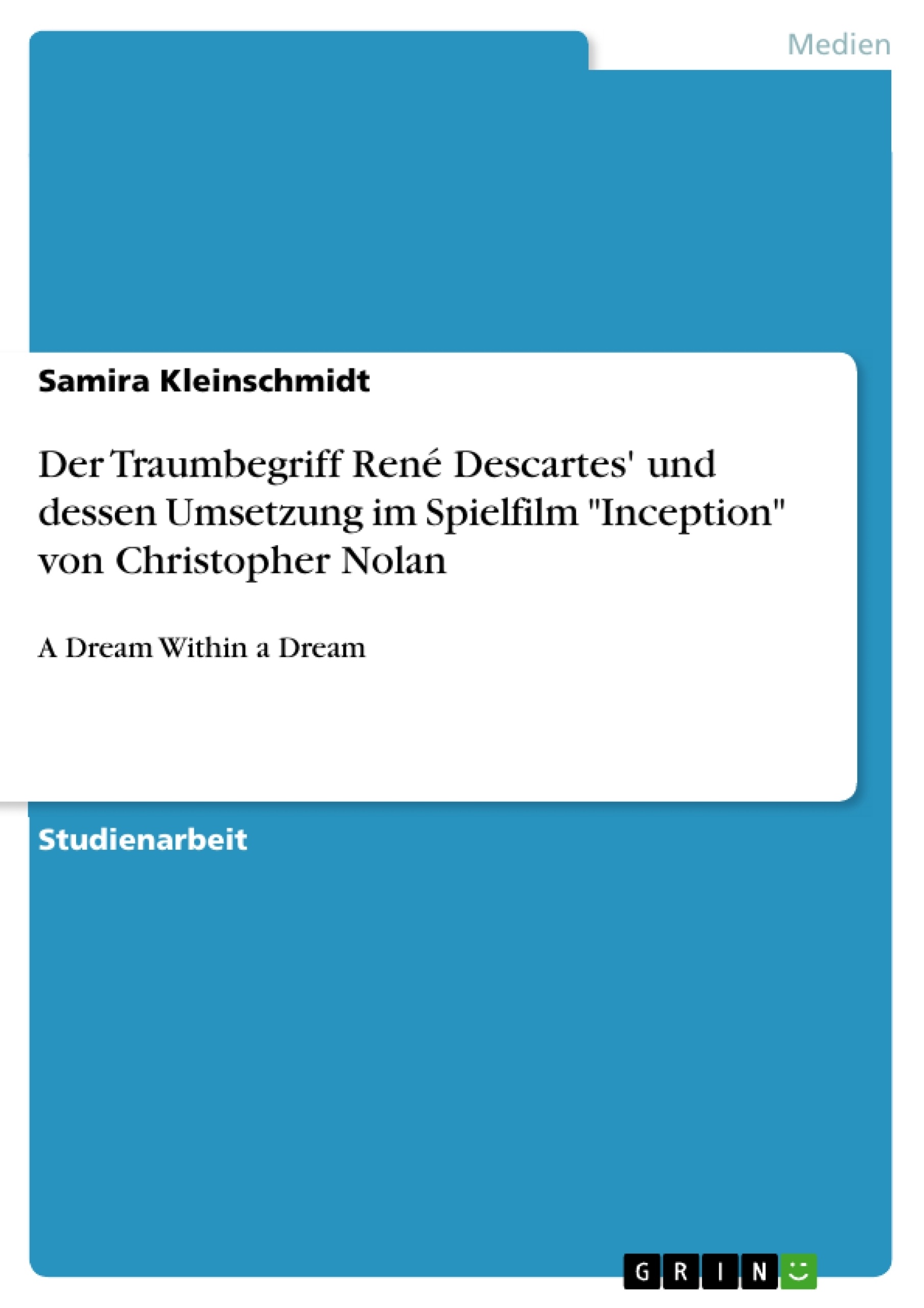
-

-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.