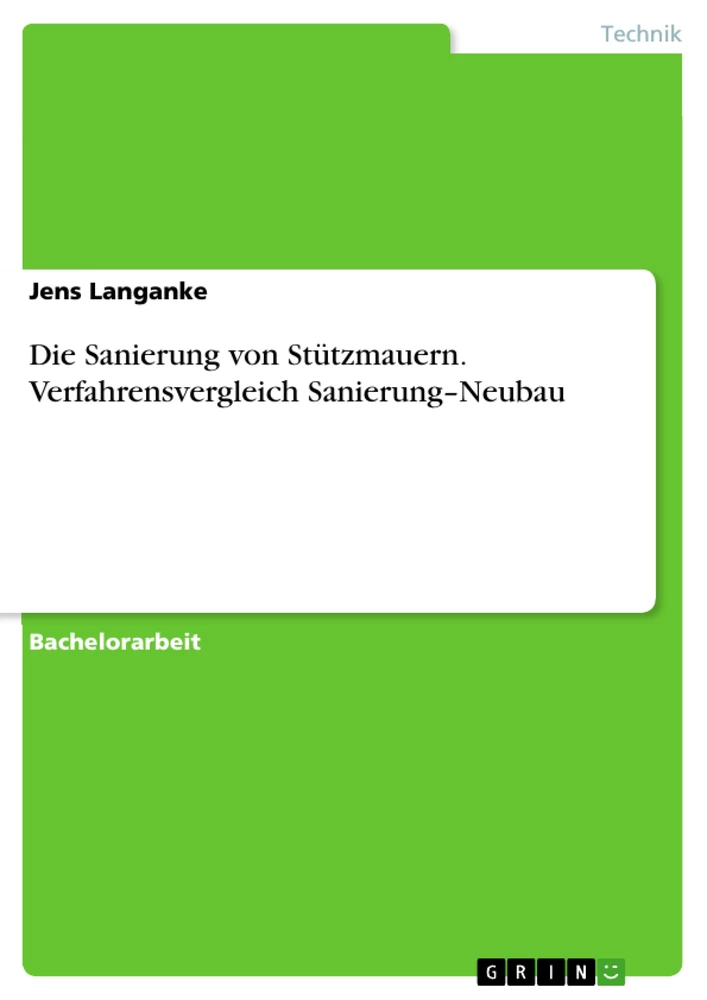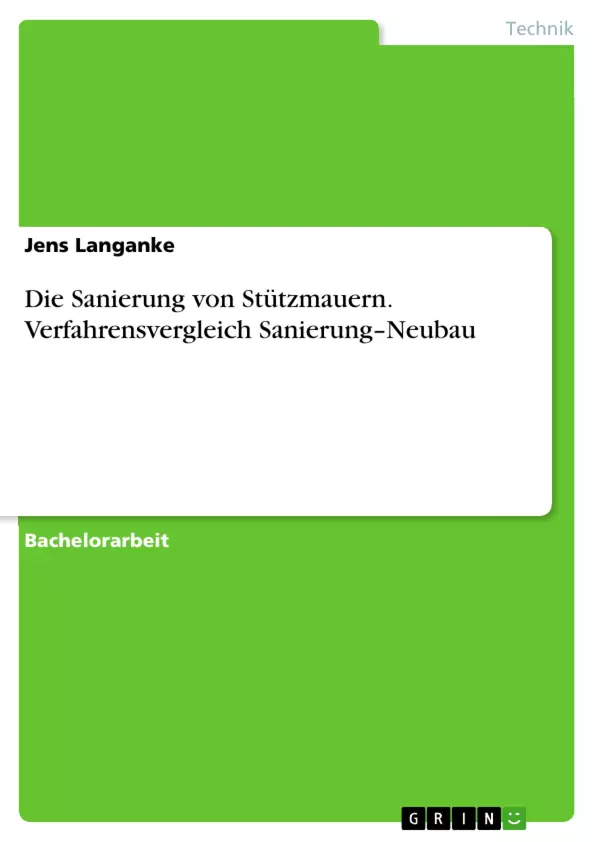Deutschlands marode Infrastruktur ist derzeit vermehrt in den Medien. Ob Brücken, Dämme oder Straßen: Zahlreiche Bauten sind sanierungsbedürftig. Jens Langanke lenkt in seiner Bachelorarbeit den Fokus auf den bestehenden Handlungsbedarf bei den oft weniger beachteten Stützmauern. Diese finden sich überall in Deutschland. Entlang Zufahrten und Flussläufen, Straßen in den Bergen oder aber im eigenen Garten schützen sie gegen eindringendes Wasser oder Erdrutsche. Doch durch Frost, Verformungen und Rissbildungen wird die Standsicherheit der Mauern gefährdet. Da ihr Versagen ernsthafte Risiken mit sich bringt, ist ihre Instandhaltung für jeden Grundstücksbesitzer und Bauleiter unverzichtbar.
Die Verantwortlichen sind mit der Frage konfrontiert, wie sie mit schadhaften Mauern verfahren sollen. Diese Bachelorarbeit gibt einen Überblick, wann eine Sanierung von Stützmauern nötig ist und wägt die Optionen Sanierung und Neubau gegeneinander ab. Welches Sanierungsverfahren ist bei welchen Schäden am ehesten zur Sicherung der Standsicherheit der Mauern geeignet? Welches sind die häufigsten Schadensbilder und -ursachen? Was ist bei der Errichtung von Stützmauern zu beachten und wie lassen sich Sanierungsmaßnahmen von vornherein herauszögern?
Eine Kostenvergleichsrechnung zeigt außerdem, ob die Investition in die Sanierung wirtschaftliche Vorteile gegenüber einem Neubau bringen kann. Abgerundet wird die Arbeit durch die Beschreibung mehrerer realer Sanierungsprojekte, die durch eine Spezialfirma ausgeführt werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Sanierung von Stützmauern, insbesondere Natursteinstützmauern, und vergleicht die Sanierung mit der Alternative eines Abrisses und Neubaus, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, Denkmalschutz, Umwelt- und Artenschutz sowie infrastruktureller Erfordernisse.
Welche Arten von Stützmauern werden betrachtet?
Der Fokus liegt auf Gewichtsstützmauern, insbesondere Natursteinstützmauern. Es werden aber auch andere Stützmauerarten wie Betonstützmauern, Winkelstützmauern und Gabionenmauern erwähnt. Stützwände im Sinne von Spundwänden oder Trägerbohlwänden werden abgegrenzt, da sie temporäre Baugrubensicherungen sind und i.d.R. keiner Sanierung bedürfen.
Welche Schadensmechanismen werden untersucht?
Die Arbeit geht auf Verwitterung, Frost, veränderte Lasteinwirkungen/Bauweise und sonstige Schadensmechanismen ein. Dabei wird stets der Einfluss von Wasser/Feuchtigkeit auf die Schadensprozesse hervorgehoben.
Welche Sanierungsverfahren werden vorgestellt?
Es werden Sanierungsverfahren für die Ansichtsfläche (Sanierung der Verfugung und Steinköpfe), den Wandquerschnitt (Querschnittsverpressung, Vernadelung von Mauerwerk), sowie Drainage und statische Sicherung (Bodenvernagelung, Querschnittsvergrößerung) erläutert.
Was ist die BST-Systemvernagelung?
Die BST-Systemvernagelung ist eine Weiterentwicklung der selbsttragenden Erdvernagelung, bei der Bodennägel durch die Stützmauer hindurch in das Erdreich eingebracht und mit Lastverteilungselementen im Rücken der Mauer verbunden werden. Rückverankerungselemente in Spül- und Ablaufbohrungen werden in das Lastverteilungselement eingebunden.
Was wird im Verfahrensvergleich Sanierung-Neubau untersucht?
Im Rahmen eines Verfahrensvergleichs werden ausgewählte Sanierungsverfahren (BST-Systemvernagelung und Pfeilerrücklagen) mit der Möglichkeit eines Abrisses mit anschließendem Neubau einer Stützmauer verglichen. Es werden u.a. die Kosten der verschiedenen Varianten gegenübergestellt und Randbedingungen wie Denkmalschutz und Umweltaspekte berücksichtigt.
Welche Empfehlungen werden für die allgemeine Anwendung gegeben?
Es werden Empfehlungen für die Berücksichtigung von Denkmalschutz, Umwelt- und Artenschutz, Verkehrswege und Bebauungen sowie Sanierungskosten gegeben. Bei der Sanierung sollte die Anwesenheit von Wasser in den Mauern besonders beachtet werden.
Welche Fallbeispiele werden genannt?
Es werden zwei Fallbeispiele vorgestellt: eine Stützmauer an der B28 bei Freudenstadt und eine Stützmauer am Forstamt Wiesbaden Chausseehaus.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Sanierung von maroden Stützmauern, insbesondere mit der BST-Systemvernagelung, ist in vielen Fällen wirtschaftlich vorteilhafter als ein Abriss mit anschließendem Neubau. Jedoch ist es im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung unter Berücksichtigung spezifischer Randbedingungen zu beurteilen.
- Quote paper
- Jens Langanke (Author), 2016, Die Sanierung von Stützmauern. Verfahrensvergleich Sanierung–Neubau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334667