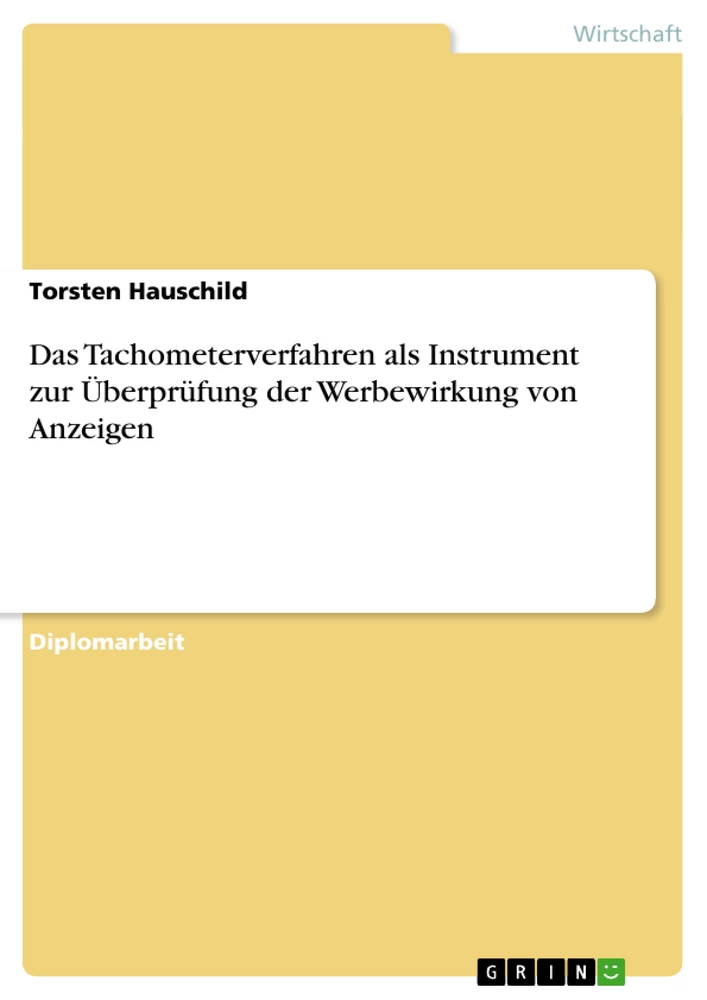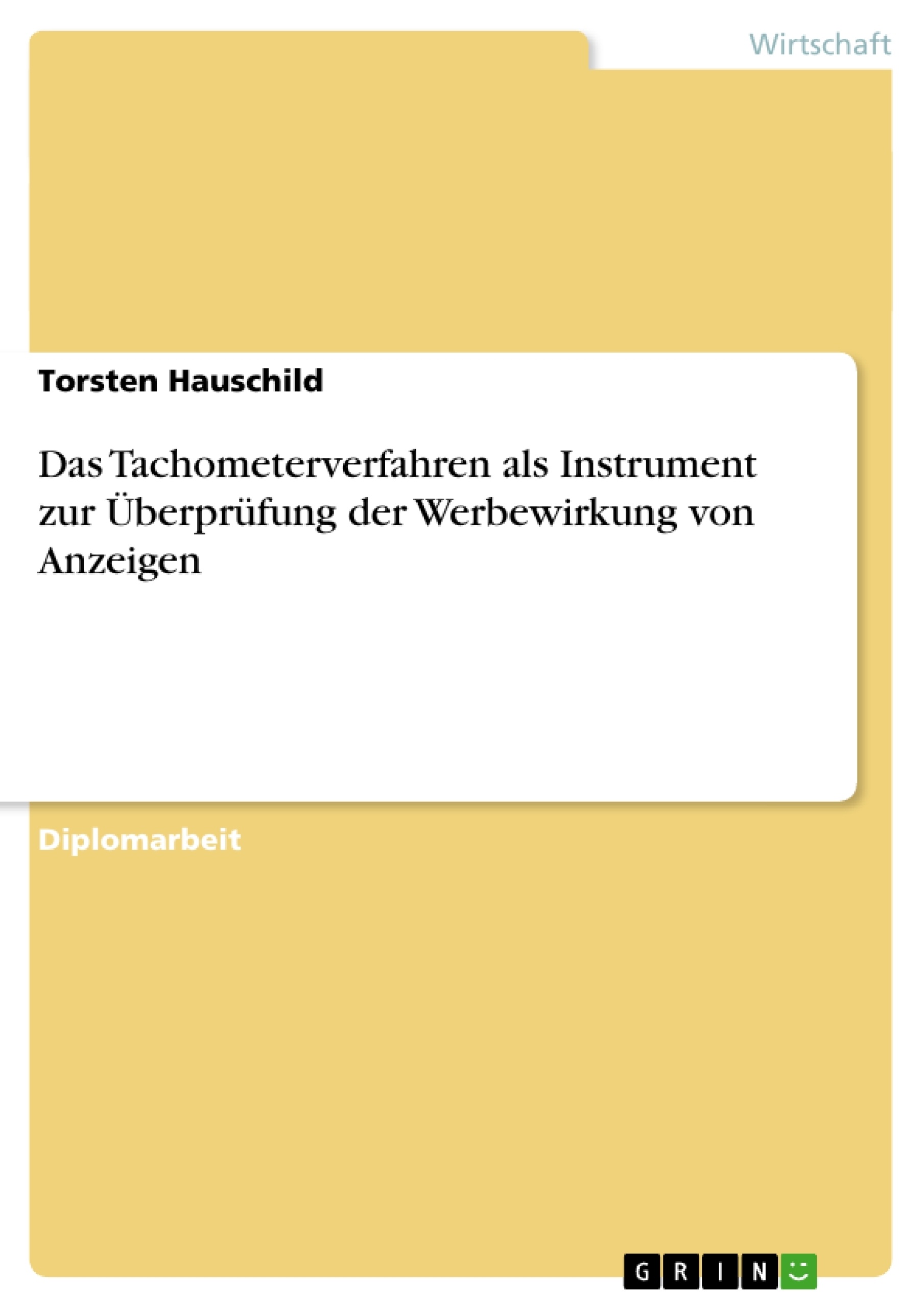In Deutschland beträgt die Informationsüberlastung bei Zeitschriften 94%. D.h. es werden nur 6% aller in Zeitschriften präsentierten Informationen von den Lesern wahrgenommen . Die durchschnittliche Betrachtungszeit für Anzeigen beträgt nur 2 Sekunden . Nur 3% bis 5% der Lesezeit, die für Anzeigen erforderlich wäre, wird für diese auch aufgewendet .
Die Märkte sind gesättigt und es herrscht allgemeine Werbeüberdrüssigkeit vor . Daher müssen Anzeigen "schneller" werden , d.h. die Werbewirkung von Anzeigen muß erhöht werden. Sonst sind sie fast effektlos. Merkmale schneller Anzeigen sind :
- Auslösung von spontaner hoher Aufmerksamkeit
- Vermittlung der Botschaft in wenigen Sekunden
- Sofortige Verständlichkeit
- Hohe Einprägsamkeit
- Sympathie und Überzeugungskraft auf den ersten Blick
Als Instrument zur Überprüfung dieser Merkmale dient das Tachometerverfahren, mit dem sich diese Arbeit beschäftigt. Mit ihm lassen sich außerdem die Schwachpunkte von Anzeigen offenlegen und Verbesserungsvorschläge ableiten.
Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Zuerst werden grundlegende Begriffe erläutert. Im Haupteil wird ausführlich auf die Prüfung von Informationsverarbeitung, Aktivierungspotential und Informationsaufnahme eingegangen. Zugunsten einer ausführlichen Darstellung dieser drei Komponenten, die sonst aufgrund der Seitenbeschränkung in dieser Form nicht möglich gewesen wäre, wird auf die Prüfung von Informationsspeicherung und Einstellungswirkung nur kurz eingegangen. Anschließend wird das Tachometerverfahren anhand von Fallbeispielen durchgeführt und abschließend kurz kritisch gewürdigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Begriffliche Grundlegung
- 2.1 Werbewirkung
- 2.2 Anzeigen
- 2.3 Wesen und Komponenten Tachometerverfahren
- 3. Das Tachometerverfahren
- 3.1 Prüfung der Verständlichkeit einzelner Anzeigenelemente
- 3.1.1 Verständlichkeit der Gesamtanzeige
- 3.1.1.1 Schnelle Verständlichkeit der Anzeige
- 3.1.1.2 Widersprüchlichkeit zwischen Text und Bild
- 3.1.2 Verständlichkeit des Bildes
- 3.1.2.1 Richtung der durch das Bild ausgelösten Assoziationen
- 3.1.2.2 Eigenständigkeit des Bildes
- 3.1.2.3 Prägnanz der Abbildung des Produktes
- 3.1.3 Verständlichkeit der Headline
- 3.1.3.1 Mißverständlichkeit der Headline
- 3.1.3.2 "Langsame" Formulierungen
- 3.1.4 Verständlichkeit des Fließtextes
- 3.1.1 Verständlichkeit der Gesamtanzeige
- 3.2 Prüfung des Aktivierungspotentials
- 3.2.1 Aktivierungspotential des Bildes
- 3.2.1.1 Emotionales Aktivierungspotential
- 3.2.1.2 Kognitives Aktivierungspotential
- 3.2.1.3 Physisches Aktivierungspotential
- 3.2.1.4 Aktivierungsprofil des Bildes
- 3.2.2 Aktivierungspotential der Headline
- 3.2.2.1 Aktivierungspotential der Schrift
- 3.2.2.2 Kontrastreichtum und Prägnanz der Headline
- 3.2.2.3 Emotionales Aktivierungspotential der Headline
- 3.2.1 Aktivierungspotential des Bildes
- 3.3 Prüfung der Informationsaufnahme
- 3.3.1 Informationsaufnahme der Gesamtanzeige
- 3.3.1.1 Horizontale Anordnung der Texte zum zentralen Bildelement
- 3.3.1.2 Vertikale Anordnung der Texte zum zentralen Bildelement
- 3.3.1.3 Verzichtbare Bilder oder Texte
- 3.3.2 Informationsaufnahme des Bildes
- 3.3.3 Informationsaufnahme der Headline
- 3.3.4 Informationsaufnahme des Absenders
- 3.3.4.1 Größengestaltung des Markennamens
- 3.3.4.2 Markennamen in der Headline
- 3.3.4.3 Plazierung des Absenders an üblicher Stelle
- 3.3.4.4 Auffällige Plazierung und Gestaltung des Absenders
- 3.3.5 Informationsaufnahme des Fließtextes
- 3.3.5.1 Kürzungsmöglichkeiten des Fließtextes
- 3.3.5.2 Formale Gestaltung des Fließtextes
- 3.3.6 Informationsaufnahme von doppelseitigen Anzeigen
- 3.3.1 Informationsaufnahme der Gesamtanzeige
- 3.4 Prüfung der anderen Komponenten
- 3.4.1 Informationsspeicherung
- 3.4.2 Einstellungswirkung
- 4. Fallbeispiele
- 4.1 Wasa
- 4.1.1 Analyse der Wasa-Anzeige
- 4.1.2 Optimierungsvorschläge für die Wasa-Anzeige:
- 4.2 Blaupunkt
- 4.2.1 Analyse der Blaupunkt -Anzeige
- 4.2.2 Optimierungsvorschläge für die Blaupunkt-Anzeige
- 4.1 Wasa
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Werbewirkung von Anzeigen mithilfe des Tachometerverfahrens zu analysieren und zu optimieren. Das Verfahren dient dazu, die Verständlichkeit, das Aktivierungspotential und die Informationsaufnahme von Anzeigen zu untersuchen.
- Informationsüberlastung und die Notwendigkeit schneller Anzeigen
- Das Tachometerverfahren als Instrument zur Überprüfung der Werbewirkung
- Analyse der Verständlichkeit, des Aktivierungspotentials und der Informationsaufnahme von Anzeigen
- Anwendung des Tachometerverfahrens anhand von Fallbeispielen
- Kritische Würdigung des Verfahrens und Ableitung von Optimierungsvorschlägen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Problematik der Informationsüberlastung im Bereich der Werbung und die Notwendigkeit schneller, einprägsamer Anzeigen erläutert. Anschließend werden grundlegende Begriffe wie Werbewirkung, Anzeigen und das Tachometerverfahren definiert.
Im Hauptteil wird das Tachometerverfahren im Detail vorgestellt. Es umfasst die Prüfung der Verständlichkeit einzelner Anzeigenelemente (Gesamtanzeige, Bild, Headline, Fließtext), des Aktivierungspotentials (Bild, Headline) und der Informationsaufnahme (Gesamtanzeige, Bild, Headline, Absender, Fließtext). Diese Komponenten werden anhand von Fallbeispielen analysiert, um die Anwendung des Tachometerverfahrens in der Praxis zu demonstrieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Tachometerverfahren, Werbewirkung, Anzeigen, Verständlichkeit, Aktivierungspotential, Informationsaufnahme, Informationsspeicherung, Einstellungswirkung, Fallbeispiele, Optimierungsvorschläge.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Tachometerverfahren in der Werbung?
Es ist ein Testverfahren zur Messung der Werbewirkung, bei dem Anzeigen für nur Bruchteile von Sekunden gezeigt werden, um die schnelle Verständlichkeit und Aufmerksamkeit zu prüfen.
Warum müssen Anzeigen heutzutage „schneller“ werden?
Aufgrund einer Informationsüberlastung von ca. 94 % und einer durchschnittlichen Betrachtungszeit von nur 2 Sekunden müssen Anzeigen ihre Botschaft sofort vermitteln, um wahrgenommen zu werden.
Was wird beim Aktivierungspotential einer Anzeige geprüft?
Es wird untersucht, wie stark Bild und Headline emotionale, kognitive oder physische Reize auslösen, die den Betrachter zur weiteren Auseinandersetzung mit der Anzeige motivieren.
Welche Rolle spielt die Headline im Tachometerverfahren?
Die Headline muss sofort verständlich sein und darf keine „langsamen“ Formulierungen enthalten. Sie sollte idealerweise den Markennamen enthalten, um die Informationsaufnahme zu sichern.
Was versteht man unter der Informationsaufnahme?
Es ist die Fähigkeit einer Anzeige, zentrale Botschaften und den Absender (Marke) in kürzester Zeit im Gedächtnis des Lesers zu verankern.
Welche Optimierungsvorschläge liefert das Verfahren?
Typische Vorschläge sind die Kürzung von Fließtexten, die Vergrößerung des Markennamens oder die Beseitigung von Widersprüchen zwischen Bild und Text.
- 3.1 Prüfung der Verständlichkeit einzelner Anzeigenelemente
- Quote paper
- Diplom-Kaufmann Torsten Hauschild (Author), 1995, Das Tachometerverfahren als Instrument zur Überprüfung der Werbewirkung von Anzeigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33472