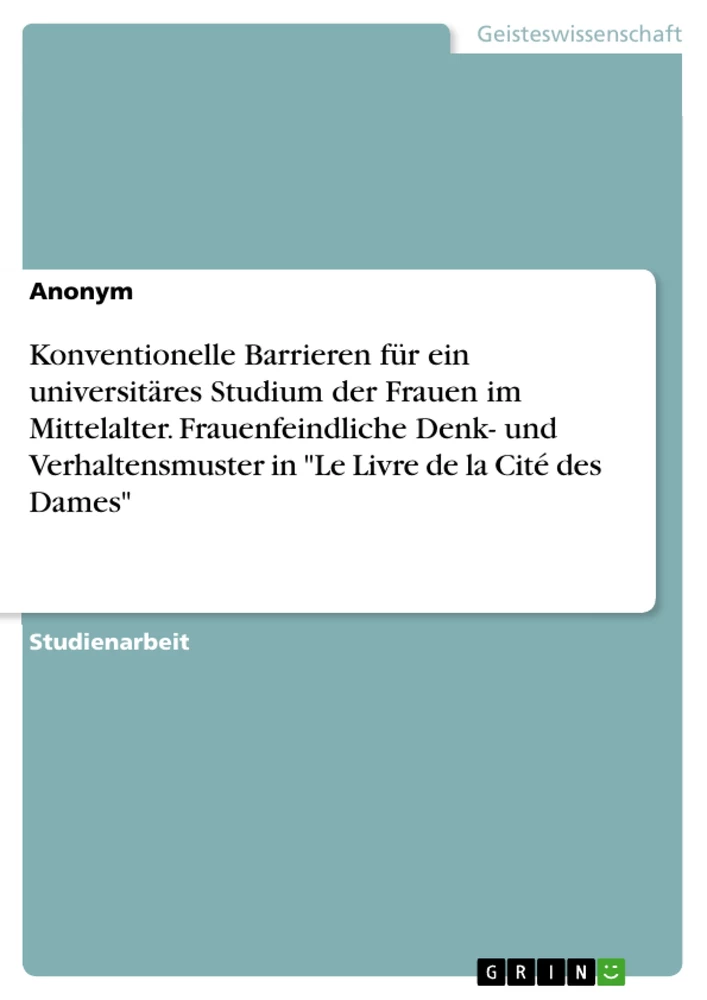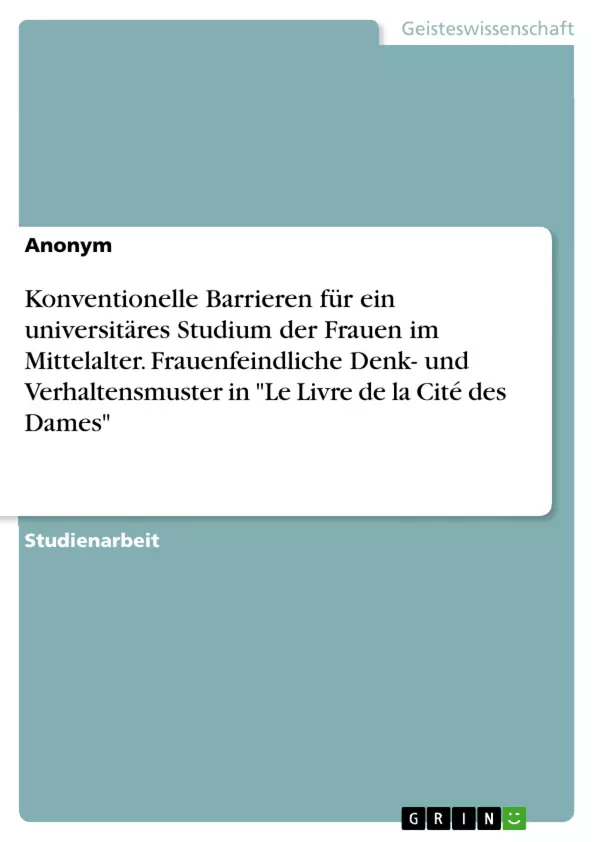Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit Frauen im 15. Jahrhundert in ihren Möglichkeiten zu studieren eingeschränkt wurden. Dies geschah nicht nur durch Denk- und Verhaltensmuster der mittelalterlichen Gesellschaft, sondern auch durch ein Frauenverachtendes Credo in der Literatur.
Hierzu wird im Folgenden das damalige Bildungsverständnis untersucht, und mit Christine de Pizans Biographie kontextualisiert. Anschließend wird bei der Analyse ihres Buches La Cité des Dames die Hypothese argumentativ gestützt, dass vorherrschende, von Dichotomien geprägte Weltanschauungen ein ausschlaggebendes Hindernis für Frauen auf ihrem Weg zur Individuation durch die Ergreifung eines Studiums darstellten.
Zu Lebzeiten sowie in dem Jahrhundert nach ihrem Tod genoss Christine de Pizans Literatur große Aufmerksamkeit, bis sie lange Zeit in Vergessenheit geriet und erst Ende des 18. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde. Abwechselnd hoch gelobt und ebenso stark verunglimpft wurde sie von einer vorurteilgeladenen Literaturkritik, welche sie auf ihre Rolle als Frau reduzierte, anstatt sie als bemerkenswert innovative Schreiberin zu wertschätzen. Neuzeitliche Feministinnen rezipierten sie mit Begeisterung, wogegen wiederum die literaturwissenschaftliche Forschung in Frankreich ihr aufgrund ihrer Intellektualität Verachtung schenkte. Der Romanist Gustave Lanson betitulierte Christine de Pizan noch im 19. Jahrhundert herablassend als „Blaustrumpf“. Nach Charity Cannon Willard seien beide Seiten der Beurteilung in vielen Fällen „based on an inadequate knowledge of what Christine wrote“. Erst in der Hälfte des letzten Jahrhunderts wurden ihrer Ansicht nach ernsthafte Anstrengungen unternommen, daran etwas zu ändern und so eine solide Basis für die Beurteilung ihrer Arbeit zu schaffen.
Die mittelfranzösische Originalausgabe des 1405 fertig gestellten La Cité des Dames wurde schon damals viel gelesen und auch schon in andere Sprachen übersetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Wandel des Bildungsverständnisses im 15. Jahrhundert
- Christine de Pizan im Kontext ihrer Zeit
- Analyse: Le Livre de la Cité des Dames
- Fazit
- Literatur
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Hürden, die Frauen im 15. Jahrhundert im Hinblick auf ein Universitätsstudium entgegenstanden. Dabei liegt der Fokus nicht auf offiziellen Verboten, sondern auf unsichtbaren Konventionen, Denk- und Verhaltensmustern der mittelalterlichen Gesellschaft sowie auf einem frauenverachtenden Credo in der Literatur. Die Arbeit untersucht das damalige Bildungsverständnis und kontextualisiert es mit Christine de Pizans Biografie. Durch die Analyse ihres Buches "La Cité des Dames" wird die Hypothese gestützt, dass vorherrschende, von Dichotomien geprägte Weltanschauungen ein entscheidendes Hindernis für Frauen auf ihrem Weg zur Individuation durch die Ergreifung eines Studiums darstellten.
- Wandel des Bildungsverständnisses im 15. Jahrhundert
- Christine de Pizans Leben und Werk
- Analyse von "La Cité des Dames"
- Frauenfeindliche Denk- und Verhaltensmuster im Mittelalter
- Die Rolle von Bildung für die Emanzipation von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Fokus auf unsichtbare Konventionen und frauenverachtende Denk- und Verhaltensmuster. Sie führt Christine de Pizan als zentrale Figur der Untersuchung ein. Der Hauptteil beginnt mit einer Analyse des Wandels des Bildungsverständnisses im 15. Jahrhundert, wobei die Rolle der Kirche und die Entstehung des "neuen Menschen der Renaissance" beleuchtet werden. Im Anschluss wird Christine de Pizan in den Kontext ihrer Zeit eingeordnet, ihre Biografie und ihre literarische Bedeutung dargestellt. Der dritte Teil analysiert "La Cité des Dames" und untersucht die darin präsentierten Argumente gegen die damalige Frauenfeindlichkeit. Das Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Frauen und Bildung im Mittelalter, Christine de Pizan, "La Cité des Dames", frauenverachtende Denk- und Verhaltensmuster, Dichotomien, Individuation, Bildungsverständnis, Universitäten, Kirche, Renaissance, Humanismus, Spätmittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Christine de Pizan und warum ist sie bedeutend?
Christine de Pizan war eine wegweisende Schriftstellerin des 15. Jahrhunderts, die als eine der ersten Frauen aktiv gegen die Frauenfeindlichkeit in der Literatur und Gesellschaft ihrer Zeit anschrieb.
Worum geht es in ihrem Werk "La Cité des Dames"?
In dem Buch baut sie symbolisch eine Stadt für tugendhafte Frauen auf, um die intellektuelle und moralische Gleichwertigkeit von Frauen gegenüber den damals vorherrschenden Vorurteilen zu beweisen.
Welche Barrieren hinderten Frauen im Mittelalter am Studium?
Neben offiziellen Verboten waren es vor allem unsichtbare Konventionen, ein frauenverachtendes Credo in der Literatur und die starre Rollenverteilung der Kirche, die Bildung für Frauen erschwerten.
Was bedeutete der Wandel zum Humanismus für Frauen?
Obwohl der Humanismus den "neuen Menschen" feierte, blieb der Zugang zu Universitäten für Frauen weitgehend verschlossen, da das Bildungsideal weiterhin männlich konnotiert war.
Warum wurde Christine de Pizan als "Blaustrumpf" bezeichnet?
Im 19. Jahrhundert nutzten Kritiker wie Gustave Lanson diesen Begriff herablassend, um sie auf ihre Rolle als Frau zu reduzieren und ihre intellektuelle Leistung abzuwerten.
Wie wird "La Cité des Dames" heute bewertet?
Heute gilt das Werk als frühes Zeugnis feministischer Literaturkritik und als wichtiges Dokument für den Kampf um weibliche Bildung und Individuation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Konventionelle Barrieren für ein universitäres Studium der Frauen im Mittelalter. Frauenfeindliche Denk- und Verhaltensmuster in "Le Livre de la Cité des Dames", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334914