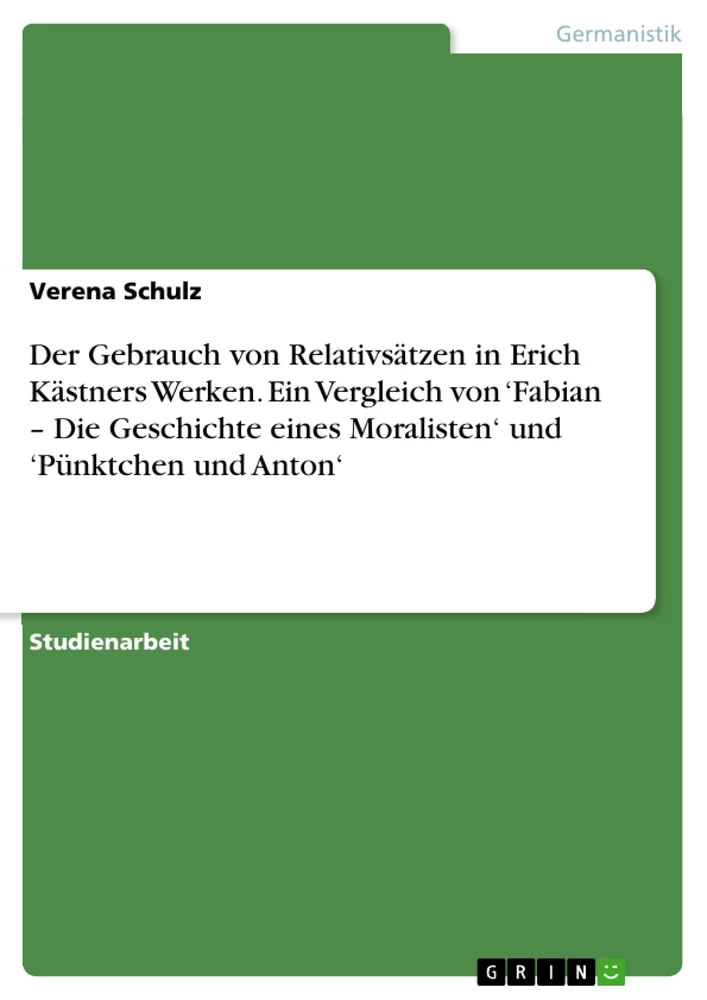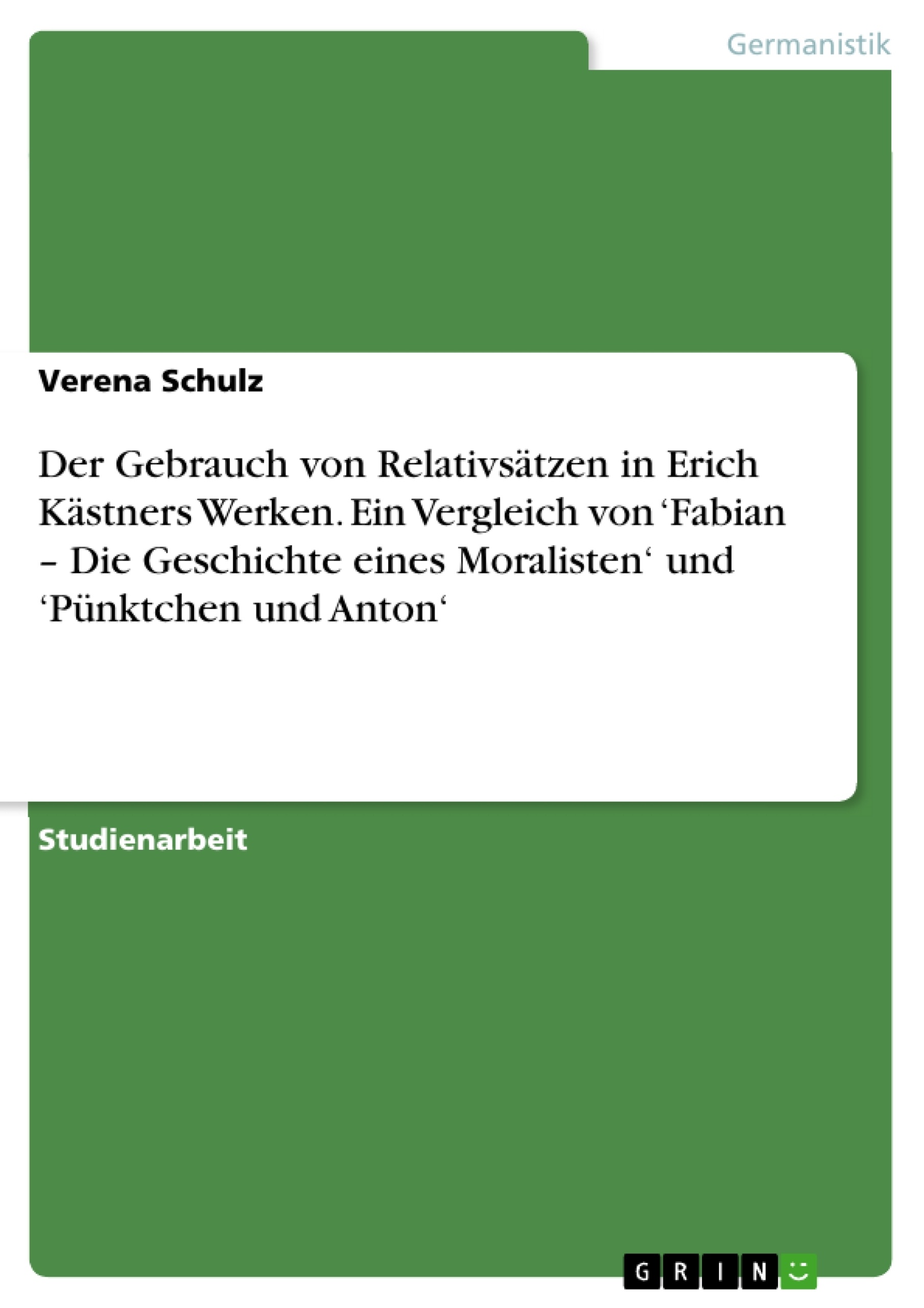Die Anforderung dieser Arbeit besteht darin den Gebrauch von Relativsätzen in Erich Kästners Werken ‘Fabian – Die Geschichte eines Moralisten‘ und ‘Pünktchen und Anton‘ sinnvoll aufzugliedern, eine Übersicht zu den sprachwissenschaftlichen Grundlagen von Relativsätzen zu schaffen und eine linguistische Analyse auszuführen, die beide Werke sinnvoll gegenüberstellt.
Wie häufig werden Relativsätze verwendet? Welche semantische Funktion verfolgen die Relativsätze; werden diese eher genutzt, um erforderliche Informationen einzustreuen oder um Bildlichkeit zu gewährleisten? Welche Besonderheiten lassen sich in beiden Werken analysieren? Welche Gattungen von Relativsätzen werden genutzt? Gibt es Unregelmäßigkeiten in der Nutzung von Relativsätzen in den jeweiligen Werken? Lassen sich durch die genutzten Relativsätze adressatenspezifische Merkmale analysieren? Und welche Rolle spielt die Epoche der Neuen Sachlichkeit für den Gebrauch von Relativsätzen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematik der Relativsätze
- Charakteristika der Relativsätze
- Semantische Funktion von Relativkonstruktionen
- Das Korpus
- Methodisches Vorgehen
- Analyse
- Relativsätze in 'Fabian – Die Geschichte eines Moralisten'
- Nach der semantischen Funktion von gebrauchten Relativsätzen
- Relativsätze in der wörtlichen Rede
- Sonstige Besonderheiten
- Relativsätze in 'Pünktchen und Anton'
- Nach der semantischen Funktion von gebrauchten Relativsätzen
- Relativsätze im Paratext
- Sonstige Besonderheiten
- Auswertung und Zusammenfassung
- Relativsätze in 'Fabian – Die Geschichte eines Moralisten'
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Gebrauch von Relativsätzen in Erich Kästners Werken 'Fabian – Die Geschichte eines Moralisten' und 'Pünktchen und Anton'. Die Analyse zielt darauf ab, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Gebrauch von Relativsätzen in beiden Werken zu untersuchen und den Einfluss der Epoche der Neuen Sachlichkeit auf den Sprachgebrauch zu beleuchten.
- Untersuchung der Häufigkeit und Funktion von Relativsätzen in den beiden Werken
- Analyse der semantischen Funktion von Relativsätzen (restriktiv vs. nicht-restriktiv)
- Beurteilung der Rolle von Relativsätzen in der wörtlichen Rede und im Paratext
- Identifizierung von Besonderheiten im Gebrauch von Relativsätzen in den jeweiligen Werken
- Erarbeitung von Schlussfolgerungen zum Einfluss der Neuen Sachlichkeit auf den Gebrauch von Relativsätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Analyse von Relativsätzen in Erich Kästners Werken dar und erläutert die Ziele und Fragestellungen der Arbeit. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die sprachwissenschaftlichen Grundlagen von Relativsätzen, einschließlich ihrer Charakteristika und semantischen Funktionen. Kapitel 3 beschreibt das Korpus der Analyse, bestehend aus den beiden Werken 'Fabian – Die Geschichte eines Moralisten' und 'Pünktchen und Anton'. Kapitel 4 erläutert das methodische Vorgehen der Analyse. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Analyse der Relativsätze in beiden Werken, wobei die jeweiligen Besonderheiten und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht Schlussfolgerungen zum Einfluss der Neuen Sachlichkeit auf den Gebrauch von Relativsätzen.
Schlüsselwörter
Relativsätze, Erich Kästner, Neue Sachlichkeit, Sprachvergleich, 'Fabian – Die Geschichte eines Moralisten', 'Pünktchen und Anton', semantische Funktion, Restriktivität, Nicht-Restriktivität, wörtliche Rede, Paratext, Sprachwissenschaft, Linguistik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Vergleichs der beiden Kästner-Werke?
Die Arbeit untersucht linguistisch, wie Erich Kästner Relativsätze in einem Erwachsenenroman (Fabian) und einem Kinderbuch (Pünktchen und Anton) unterschiedlich einsetzt.
Welche semantischen Funktionen haben Relativsätze in den Texten?
Es wird analysiert, ob sie primär restriktiv (notwendige Information) oder nicht-restriktiv (zusätzliche Bildlichkeit/Beschreibung) verwendet werden.
Wie beeinflusst die Neue Sachlichkeit Kästners Sprachgebrauch?
Die Epoche der Neuen Sachlichkeit steht für eine klare, schnörkellose Sprache, was sich im gezielten und funktionalen Einsatz von Relativkonstruktionen widerspiegelt.
Gibt es Unterschiede bei Relativsätzen in der wörtlichen Rede?
Die Analyse prüft, ob Kästner in Dialogen Relativsätze anders nutzt, um adressatenspezifische Merkmale oder eine natürliche Umgangssprache zu erzeugen.
Was sind die Besonderheiten im Paratext von „Pünktchen und Anton“?
Die Untersuchung betrachtet auch Vorworte oder Zwischenbemerkungen (Paratexte), um festzustellen, ob dort eine andere Frequenz von Relativsätzen vorliegt als im Haupttext.
- Quote paper
- Verena Schulz (Author), 2016, Der Gebrauch von Relativsätzen in Erich Kästners Werken. Ein Vergleich von ‘Fabian – Die Geschichte eines Moralisten‘ und ‘Pünktchen und Anton‘, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334954