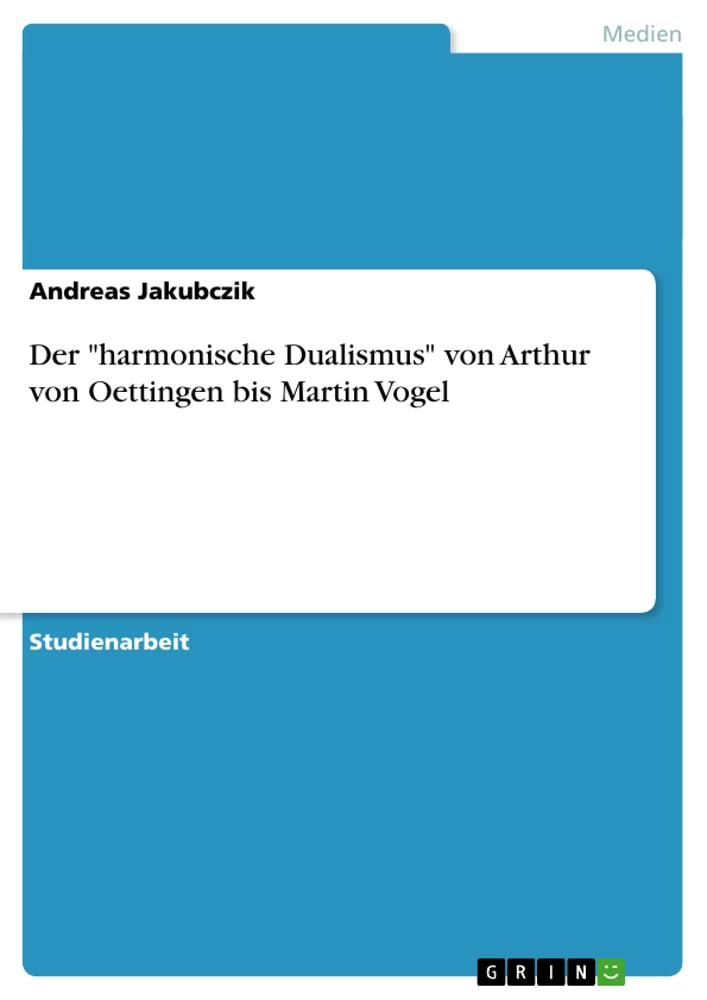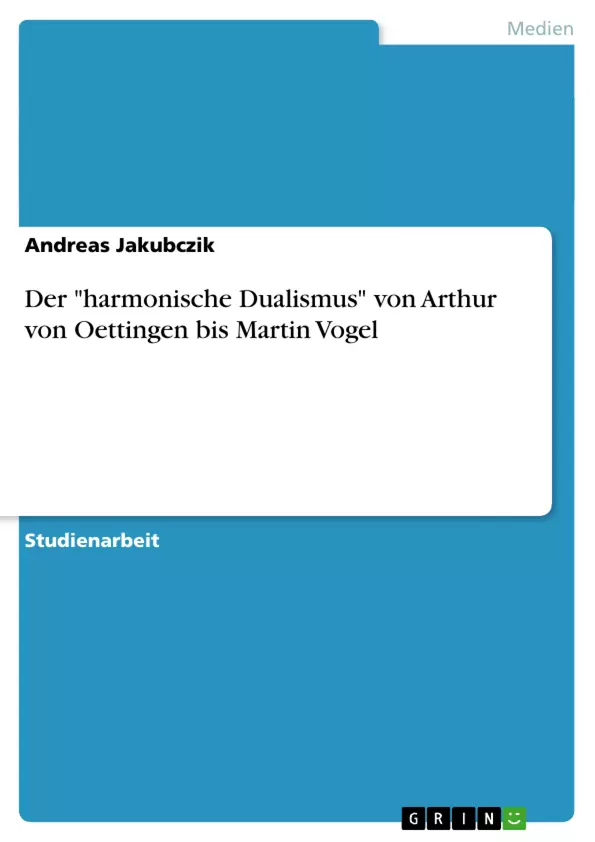Unter dem Begriff „harmonischer Dualismus“ etablierte sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland eine Letztbegründungsbewegung innerhalb der Musiktheorie. Anlass war das bisherige Versagen aller namhaften Musiktheoretiker, das Mollgeschlecht als neben dem Durgeschlecht gleichberechtigten Pfeiler der harmonischen Tonalität herzuleiten. Zwar gab es schon lange vor Rameau diesbezügliche Versuche (vgl. R 1921, 389 ff.). Jedoch gilt als der erste, der die „Tonalität in ihrer Dualität als Dur [und] Moll“ (R 1914, 49) systematisch herzuleiten versucht hat, Arthur von Oettingen (1836-1920). Seine früheste Ausarbeitung zu diesem Thema erschien 1866 unter dem Titel Harmoniesystem in dualer Entwickelung (Oe 1866). Der dort zutage tretende Letztbegründungsanspruch forderte in den darauffolgenden Jahrzehnten die namhaftesten Musiktheoretiker in Deutschland zu Anknüpfungen oder kritischen Stellungnahmen heraus. Bis heute bedeutsam sind hierbei Carl Stumpf (1848-1936) und Hugo Riemann (1849-1919). – Nach Riemanns Eintreten für den „harmonischen Dualismus“ wurde es jedoch still um denselben. Die auf die musikalische Praxis des Komponierens und Instrumentalspiels abgestellte Musiktheorie an den staatlichen Hochschulen für Musik meinte, auf diesen teilweise sehr komplizierten theoretischen Überbau verzichten zu müssen, da er die musikalische Praxis eher behindere als fördere. – In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war dagegen Martin Vogel (geb. 1923) bestrebt, die Erbschaft Oettingens und Riemanns wiederzubeleben, zu erweitern und für die musikalische Praxis und Theorie fruchtbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zum Thema
- 1.2 Vorgehensweise und Ziel
- 2. Oettingens System
- 2.1 Herleitung der Klangverwandtschaft
- 2.1.1 Verwandtschaft innerhalb von akustischen Klängen und Mehrklängen
- 2.1.2 Klangvertretung
- 2.1.3 Tonizität und Phonizität
- 2.2 Das Tonnetz der reinen Stimmung
- 2.3 Grundlagen der harmonischen Modulation
- 2.3.1 Verwandtschaftsarten
- 2.3.2 „Dissonanz und Auflösung“: Terminologie
- 2.3.3 Verwandtschaftskreis der reinen Tongeschlechter
- 3. Reaktionen
- 3.1 Stumpfs Kritik
- 3.2 Riemanns Modifizierungen
- 3.3 Ausblick auf Vogel
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Arthur von Oettingens System des harmonischen Dualismus, seine Rezeption durch namhafte Musiktheoretiker wie Carl Stumpf und Hugo Riemann, und dessen spätere Relevanz im Werk von Martin Vogel. Das Hauptziel ist es, Oettingens Ansatz zur Herleitung der Moll-Tonalität als gleichberechtigtem Gegenpart zur Dur-Tonalität zu analysieren und seine Bedeutung für die Musiktheorie zu beleuchten.
- Oettingens Theorie des harmonischen Dualismus und seine Herleitung der Klangverwandtschaft.
- Die Kritik von Carl Stumpf an Oettingens System.
- Riemanns Modifikationen und Weiterentwicklungen des harmonischen Dualismus.
- Die Rolle der akustischen und musikalischen Konsonanz in Oettingens System.
- Der Einfluss von Oettingens Werk auf spätere musiktheoretische Ansätze, insbesondere bei Martin Vogel.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung etabliert den Kontext des "harmonischen Dualismus" als eine musiktheoretische Bewegung des 19. Jahrhunderts, die versuchte, die Moll-Tonalität systematisch herzuleiten. Sie führt Arthur von Oettingen als zentralen Protagonisten ein und skizziert die Reaktionen von Stumpf und Riemann, sowie den späteren Bezug durch Vogel. Die Vorgehensweise der Arbeit wird umrissen, welche sich auf Oettingens zweite und vierte Fassung seines Systems konzentriert und die Reaktionen von Stumpf, Riemann und Vogel aufzeigt.
2. Oettingens System: Dieses Kapitel beschreibt Oettingens System des harmonischen Dualismus. Es beleuchtet seine methodische Herangehensweise, die Klärung des Konsonanzbegriffs und die Ableitung der Klangverwandtschaft basierend auf Helmholtz' akustischer Theorie. Das Kapitel geht auf die zentralen Aspekte von Oettingens System ein: die Herleitung der Klangverwandtschaft basierend auf dem Konsonanzprinzip, das Tonnetz der reinen Stimmung als Grundlage und die Prinzipien der harmonischen Modulation. Die Unterscheidung zwischen akustischer und musikalischer Konsonanz wird detailliert erläutert, ebenso wie die Rolle der Obertonreihen in der Konsonanzbestimmung.
3. Reaktionen: Dieses Kapitel widmet sich den Reaktionen auf Oettingens System. Es skizziert kritische Auseinandersetzungen von Stumpf, modifizierende Ansätze von Riemann, und einen Ausblick auf Vogels Bemühungen, Oettingens Erbe wiederzubeleben und weiterzuentwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen Perspektiven und deren Einfluss auf die Entwicklung der Musiktheorie. Die Kapitel beschreiben die jeweiligen kritischen Punkte, Anpassungen und Erweiterungen, die aus den unterschiedlichen Betrachtungsweisen resultieren.
Schlüsselwörter
Harmonischer Dualismus, Arthur von Oettingen, Carl Stumpf, Hugo Riemann, Martin Vogel, Klangverwandtschaft, Konsonanz, Dissonanz, Tonnetz, reine Stimmung, harmonische Modulation, Musiktheorie, Obertonreihe, Helmholtz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des harmonischen Dualismus nach Oettingen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Arthur von Oettingens System des harmonischen Dualismus, seine Rezeption durch bedeutende Musiktheoretiker wie Carl Stumpf und Hugo Riemann, und dessen spätere Relevanz im Werk von Martin Vogel. Der Fokus liegt auf Oettingens Ansatz zur Herleitung der Moll-Tonalität als gleichberechtigtes Gegenstück zur Dur-Tonalität und dessen Bedeutung für die Musiktheorie.
Welche Aspekte von Oettingens System werden behandelt?
Die Arbeit untersucht detailliert Oettingens methodische Herangehensweise zur Herleitung der Klangverwandtschaft, basierend auf Helmholtz' akustischer Theorie. Schwerpunkte sind die Klärung des Konsonanzbegriffs, das Tonnetz der reinen Stimmung als Grundlage seines Systems, und die Prinzipien der harmonischen Modulation. Die Unterscheidung zwischen akustischer und musikalischer Konsonanz und die Rolle der Obertonreihen werden ebenfalls erläutert.
Wie wird die Rezeption von Oettingens System dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die kritischen Auseinandersetzungen von Carl Stumpf mit Oettingens System, die modifizierenden Ansätze von Hugo Riemann und gibt einen Ausblick auf Martin Vogels Bemühungen, Oettingens Erbe weiterzuentwickeln. Die unterschiedlichen Perspektiven und deren Einfluss auf die Entwicklung der Musiktheorie werden dargestellt, inklusive der jeweiligen kritischen Punkte, Anpassungen und Erweiterungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt den Kontext des harmonischen Dualismus vor und beschreibt die Vorgehensweise der Arbeit. Kapitel 2 (Oettingens System) beschreibt detailliert Oettingens Theorie. Kapitel 3 (Reaktionen) analysiert die Reaktionen von Stumpf, Riemann und Vogel. Kapitel 4 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die zentralen Schlüsselwörter sind: Harmonischer Dualismus, Arthur von Oettingen, Carl Stumpf, Hugo Riemann, Martin Vogel, Klangverwandtschaft, Konsonanz, Dissonanz, Tonnetz, reine Stimmung, harmonische Modulation, Musiktheorie, Obertonreihe, Helmholtz.
Welches ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse von Oettingens Ansatz zur Herleitung der Moll-Tonalität als gleichberechtigtes Gegenstück zur Dur-Tonalität und die Beleuchtung seiner Bedeutung für die Musiktheorie.
- Quote paper
- Andreas Jakubczik (Author), 2003, Der "harmonische Dualismus" von Arthur von Oettingen bis Martin Vogel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33519