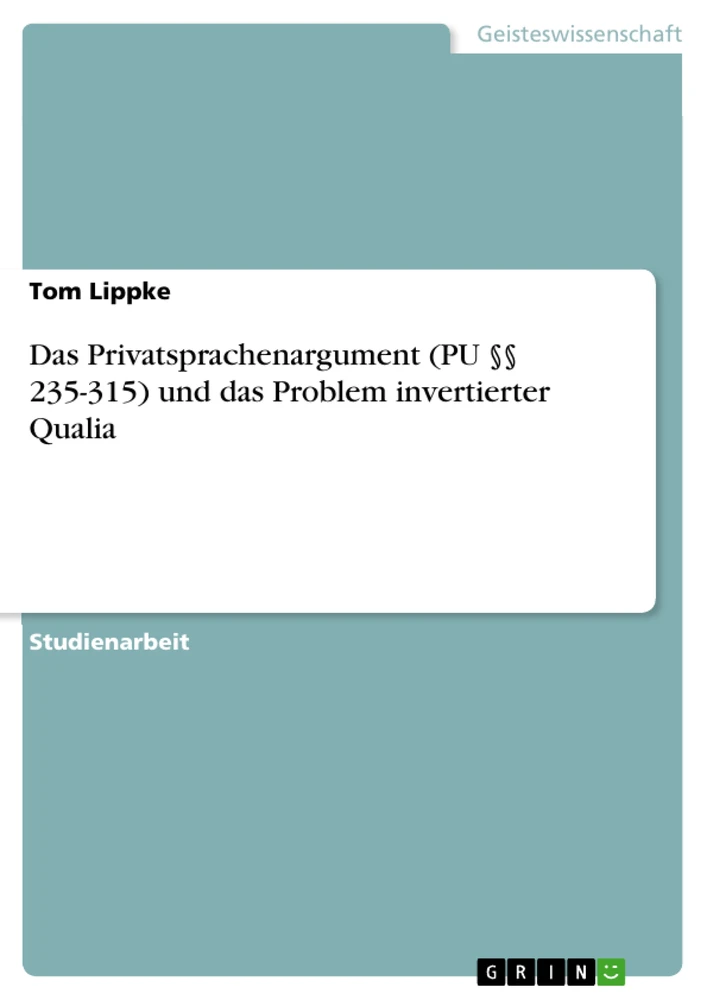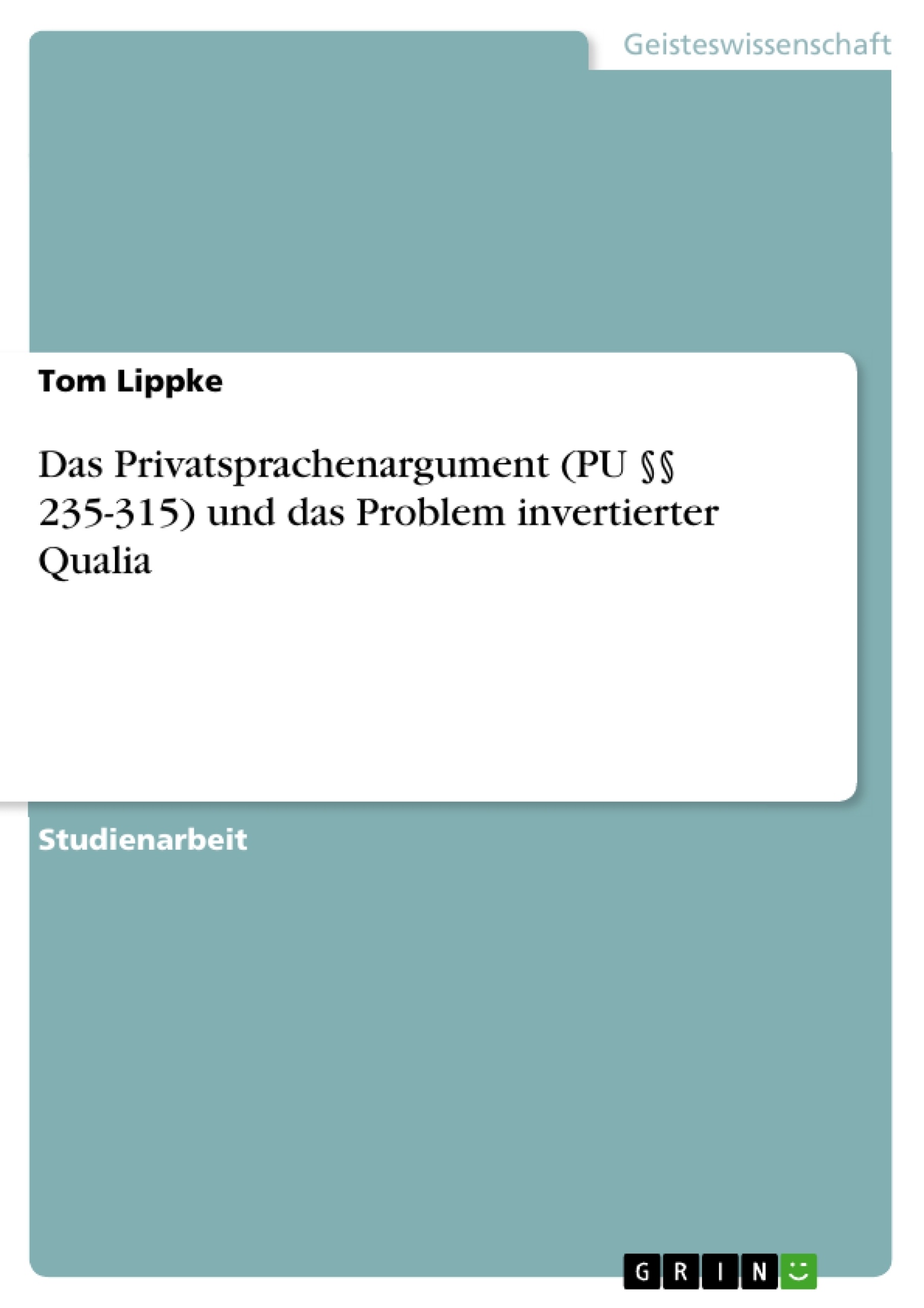Weit verbreitet ist die Annahme, psychische Eigenschaften seien einzig im Rahmen einer erste-Personen-Ontologie beschreibbar. Daraus würde folgen, dass Gefühle nur einer Person – nämlich dem Empfindenden – direkt zugänglich sind. Aus einer solchen Sichtweise leitet sich notwendigerweise eine starker Subjektivismus ab, der die Existenz anderer Ich-Individuen zwar nicht leugnet, aber bezweifelt. Denn wenn ich nur von mir weiß, was zum Beispiel Freude bedeutet, kann ich nicht wissen, ob es bei einem anderen dieselbe Bedeutung annimmt oder überhaupt vorhanden ist.
Man kann von diesem Zweifel an der Existenz von Fremdpsychischem solange nicht lassen, wie ich nicht davon überzeugt bin, dass Bedeutungsmuster universal sind. Zumindest auf Begriffe, die ihr Korrelat an physischen Gegenständen haben, sind die Bedeutungen durchaus universal. Wenn es allerdings um psychische Gegenständen geht, ist die Auffassung verbreitet, diese würden ihre Bedeutung durch einen introspektiven Vorgang erhalten. Insofern sei nur jeweils einem gegeben, zu wissen, was ein Gefühlsausdruck (z.B. der des „Schmerzes“) bedeutet. Es wäre demzufolge aber völlig unklar, ob ein Empfindungsausdruck stets mit demselben phänomenalen Gehalt korrespondiert. Wollte man an der Annahme festhalten, die Bedeutung zumindest einiger Begriffe würde subjektiv bestimmt, so müsste man eingestehen, dass es völlig unmöglich ist, Gewissheit darüber zu erlangen, ob Farbeindrücke z.B. invertiert sind, d.h. ob nicht etwa bei zwei Personen dieselbe Farbtafel unterschiedlicher Qualität für die Betrachter ist. Denn schließlich sei es unmöglich, fremde Empfindungen nachzuvollziehen, weil diese eine individuell unterschiedliche Bedeutung erhalten könnten.
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, den oben dargestellten Standpunkt mithilfe des von Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen entwickelten Privatsprachenarguments zu entkräften. Der Autor geht davon aus, dass eine wesentliche Absicht Wittgensteins gewesen ist, zu zeigen, dass Erkenntnis von Fremdpsychischen gegeben sei. Es sei demnach möglich zu wissen, dass die Empfindungen eines anderen Menschen nicht völlig anders geartet seien als die eigenen. In der Tat vermeint man schließlich, die Empfindungen anderer nachvollziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die private Sprache
- III. Das Problem des Wissens vom Fremdpsychischen
- IV. Eine Theorie der Bedeutung
- V. Ein Argument gegen die Kommunikationsskepsis
- VI. Schlussbetrachtung
- VII. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Privatsprachenargument aus Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen und dessen Relevanz für das Problem des Wissens vom Fremdpsychischen. Der Autor analysiert Wittgensteins Kritik an der Idee einer privaten Sprache, die ausschließlich einem Individuum zugänglich ist, und zeigt auf, wie dieser Ansatz eine Lösung für die Kommunikationsskepsis bietet, die aus der Annahme resultiert, dass Empfindungen nur von einer Person direkt erfahrbar sind.
- Das Privatsprachenargument
- Die Kritik an der Vorstellung von privaten Empfindungen
- Das Problem des Wissens vom Fremdpsychischen
- Wittgensteins Theorie der Bedeutung
- Die Überwindung der Kommunikationsskepsis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Einleitung
Die Einleitung präsentiert den Ausgangspunkt der Arbeit, nämlich die Annahme, dass psychische Eigenschaften nur im Rahmen einer erste-Personen-Ontologie beschreibbar sind. Daraus resultiert die Frage, ob wir tatsächlich wissen können, ob andere Menschen dieselben Empfindungen erleben wie wir oder ob es sich um „invertierte Qualia“ handelt.
Kapitel II: Die private Sprache
Dieses Kapitel analysiert das Konzept der privaten Sprache, wie es von Wittgenstein beschrieben wird. Es wird gezeigt, dass Wittgenstein eine Sprache meint, die nicht auf objektiven Kriterien, sondern auf subjektiven Empfindungen basiert. Dieser Ansatz wird in Verbindung mit dem Cartesianismus gebracht.
Kapitel III: Das Problem des Wissens vom Fremdpsychischen
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Problem des Wissens vom Fremdpsychischen, das sich aus der Annahme einer privaten Sprache ergibt. Es wird erörtert, wie die Kommunikationsskepsis entsteht, wenn man davon ausgeht, dass Empfindungen nur einem Individuum zugänglich sind.
Kapitel IV: Eine Theorie der Bedeutung
Dieses Kapitel stellt Wittgensteins Theorie der Bedeutung vor, die auf dem Konzept des Sprachspiels basiert. Es wird gezeigt, wie Bedeutung durch den sozialen Gebrauch von Wörtern und Sätzen entsteht und nicht durch eine subjektive, private Erfahrung.
Kapitel V: Ein Argument gegen die Kommunikationsskepsis
In diesem Kapitel wird dargelegt, wie Wittgensteins Theorie der Bedeutung dazu beiträgt, die Kommunikationsskepsis zu überwinden. Es wird argumentiert, dass wir aufgrund des sozialen Charakters von Sprache und Bedeutung tatsächlich wissen können, dass andere Menschen ähnliche Empfindungen erleben wie wir.
Schlüsselwörter
Das Privatsprachenargument, Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Fremdpsychisches, Kommunikationsskepsis, Bedeutung, Sprachspiel, Empfindungen, Qualia, Invertiertes Farbenspektrum, Cartesianismus, res cogitans, res extensa.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Privatsprachenargument von Wittgenstein?
Es ist der Nachweis, dass eine Sprache, die sich nur auf private Empfindungen bezieht und keine objektiven Kriterien hat, logisch unmöglich ist.
Was wird unter „invertierten Qualia“ verstanden?
Die hypothetische Vorstellung, dass zwei Personen beim Betrachten derselben Farbe völlig unterschiedliche innere Empfindungen haben könnten.
Wie löst Wittgenstein das Problem des Fremdpsychischen?
Er argumentiert, dass Bedeutung durch den sozialen Gebrauch in Sprachspielen entsteht, was privatem Subjektivismus die Grundlage entzieht.
Warum ist Kommunikationsskepsis laut dieser Arbeit unbegründet?
Weil Sprache eine öffentliche Institution ist; verstünde jeder unter Schmerz etwas völlig anderes, könnte das Wort gar nicht sinnvoll verwendet werden.
Was kritisiert Wittgenstein am Cartesianismus?
Die strikte Trennung von Geist (res cogitans) und Körper (res extensa), die zu der falschen Annahme führt, Empfindungen seien rein „innere“ Vorgänge.
- Arbeit zitieren
- Tom Lippke (Autor:in), 2015, Das Privatsprachenargument (PU §§ 235-315) und das Problem invertierter Qualia, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335269