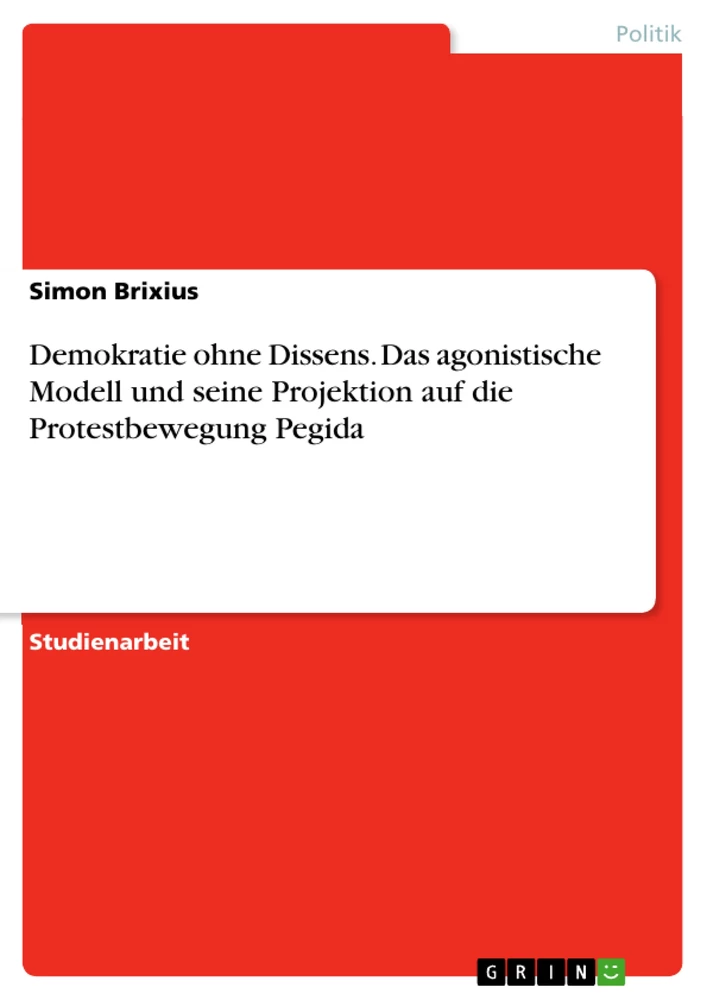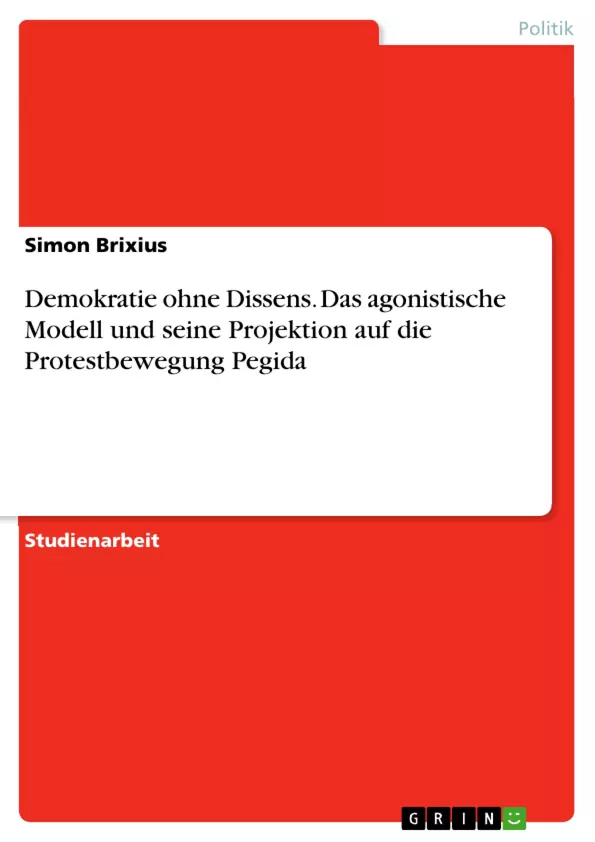Warum tauchen rechte politische Bewegungen auf, welche demokratietheoretischen Defizite weist unsere Gesellschaft auf und wie kann diesen entgegengewirkt werden? Chantal Mouffe hat in ihrer Theorie der Agonistik einen Ansatz entwickelt, welcher hervorragend geeignet ist um sich dem Thema Rechtspopulismus anzunähern.
Sie diagnostiziert ein ursächliches, systemisches Defizit in der Demokratie, welche ohne Antagonismen stattfindet und somit keinen Dissens zulässt. Zusätzlich gibt es eine politische Alternativlosigkeit und Verdrossenheit der Gesellschaft, auf dessen Nährboden der Rechtspopulismus fällt und aufkeimt. Zwar existieren auch linke Bewegungen und Parteien, doch sind diese nicht in der Lage dem globalen, liberalen Kapitalismus einen Gegenentwurf zu präsentieren. Durch die mangelnden Alternativen ist der Demokratie mit breitem Konsens ein Defizit inhärent, welches sich durch rechtspopulistische Bewegungen beobachten lässt. Mit dieser Hypothese wird sich die Hausarbeit beschäftigen.
Anhand der Protestbewegung Pegida soll die Theorie mit einem Fallbeispiel unterstrichen werden. Zunächst werde ich das agonistische Modell, eine demokratietheoretische Alternative von Chantal Mouffe, erläutern. Hierbei soll ein besonderer Fokus auf der Erklärung der Theorie liegen. Die Begriffe Hegemonie, konstitutives Außen, Antagonismus, Agonistik und deren logische Zusammenhänge werden erklärt. Anschließend werde ich das Zusammenwachsen der parlamentarischen Parteien erläutern und der Frage einer mangelnden linken, beziehungsweise die Möglichkeit der rechtspopulistischen Alternative nachgehen. Der letzte Teil der Arbeit veranschaulicht die Pegida-Bewegung und zeigt die Besonderheit dieser auf.
Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Demokratietheorie nach Mouffe werden auf die Bewegung übertragen und somit auf ihre Erklärungskraft geprüft. Inwieweit der Erfolg der Bewegung auf dem Scheitern des demokratischen Systems beruht, wird dabei einen besonderen Einfluss haben. Die Kernfrage der Hausarbeit lautet also: Inwiefern kann die Demokratietheorie von Chantal Mouffe ein demokratisches Defizit erklären, welches für das Zustandekommen der rechten Bewegung Pegida verantwortlich ist?
Im Fazit wird ein kurzer Ausblick auf andere politische Ebenen mit ähnlicher Problematik geworfen und versucht die These auf andere Ebenen zu projizieren. Außerdem wird eine kurze Kritik an Mouffes Ideen einfließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Agonistik - Ein neues demokratisches Modell
- Diskurs und Hegemonie
- Das Politische und seine Konfrontation mit dem liberalen Denken
- Das Agonistische Modell
- Demokratie ohne Alternativen
- Zusammenwachsen der parlamentarischen Parteien
- Alternativlosigkeit der Linken
- Rechtspopulismus, eine Alternative?
- Pegida- Ergebnis einer Demokratie ohne Dissens
- Pegida Was ist das?
- Das Profil der Demonstranten
- Ein Erklärungsversuch nach Mouffe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These, dass die rechte Protestbewegung Pegida ein Symptom für ein demokratisches Defizit ist, das durch die Abwesenheit von Dissens und die fehlenden politischen Alternativen entsteht. Dabei wird das agonistische Modell von Chantal Mouffe als theoretischer Rahmen genutzt, um dieses Defizit zu analysieren.
- Die Theorie der Agonistik und ihre Kernelemente: Hegemonie, konstitutives Außen, Antagonismus.
- Die These der Demokratie ohne Alternativen und ihre Folgen für die politische Landschaft.
- Die Rolle des Rechtspopulismus als vermeintliche Alternative in einer Demokratie ohne Dissens.
- Die Pegida-Bewegung als Fallbeispiel für die Anwendung der agonistischen Theorie.
- Die Frage, inwieweit die Pegida-Bewegung ein Ergebnis des Scheiterns des demokratischen Systems ist.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Rechtspopulismus im Kontext der Flüchtlingskrise dar und führt die Pegida-Bewegung als Fallbeispiel ein. Kapitel 2 erläutert das agonistische Modell von Chantal Mouffe, wobei die Konzepte von Hegemonie, konstitutivem Außen und Antagonismus im Detail erklärt werden. Kapitel 3 beleuchtet das Zusammenwachsen der parlamentarischen Parteien und die damit einhergehende Alternativlosigkeit, die sowohl die Linke als auch die Demokratie insgesamt schwächen. Kapitel 4 analysiert die Pegida-Bewegung im Lichte der agonistischen Theorie und untersucht, inwieweit diese Bewegung ein Ergebnis des demokratischen Defizits ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Demokratietheorie, Rechtspopulismus, Agonistik, Hegemonie, Antagonismus, konstitutives Außen, Pegida-Bewegung, politische Alternativen, und die Auswirkungen von Dissens und Alternativlosigkeit auf die Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „agonistische Modell“ der Demokratie?
Ein von Chantal Mouffe entwickelter Ansatz, der besagt, dass Demokratie lebendigen Dissens und den Streit zwischen politischen Alternativen benötigt.
Warum sieht Mouffe ein Defizit in der heutigen Demokratie?
Sie diagnostiziert eine „Alternativlosigkeit“ und einen breiten Konsens der Mitte, der keinen Raum für echten politischen Streit (Antagonismus) lässt.
Wie erklärt die Theorie den Erfolg von Pegida?
Pegida wird als Symptom gesehen: Wenn parlamentarische Parteien keine Alternativen bieten, suchen sich Bürger rechtspopulistische Bewegungen als Ventil für ihren Dissens.
Was bedeutet der Begriff „konstitutives Außen“?
Ein zentrales Element von Mouffes Theorie, das beschreibt, dass Identität und politische Gruppen sich immer durch die Abgrenzung von einem „Anderen“ definieren.
Welche Kritik wird an Mouffes Modell geäußert?
Die Arbeit schließt mit einer kritischen Betrachtung ihrer Ideen und prüft deren Erklärungskraft für moderne rechte Bewegungen.
- Quote paper
- Simon Brixius (Author), 2016, Demokratie ohne Dissens. Das agonistische Modell und seine Projektion auf die Protestbewegung Pegida, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335448