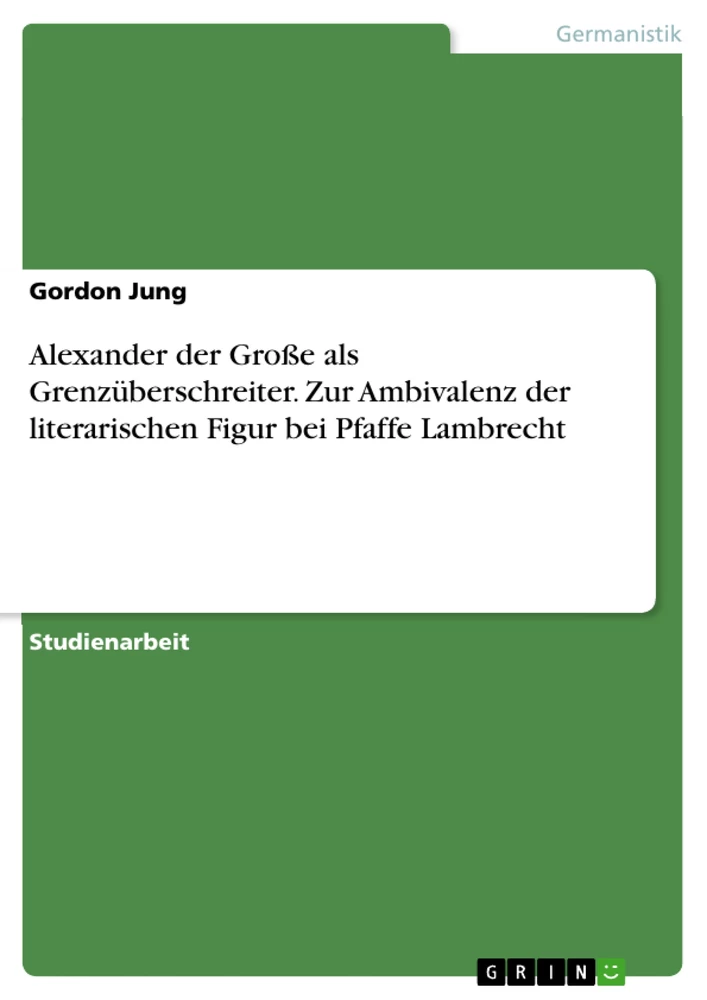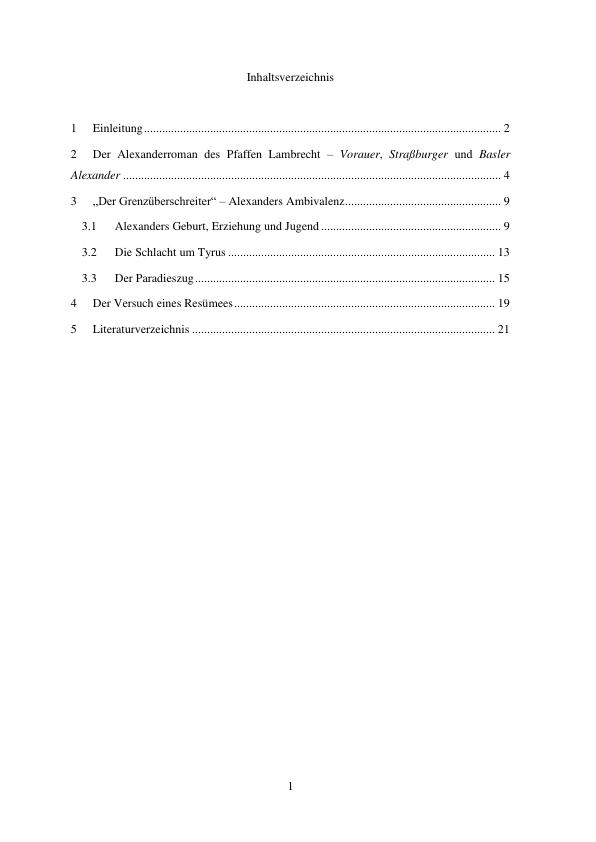Das literarische Alexanderbild erscheint selten eindeutig, sondern zumeist sehr ambivalent, widersprüchlich, wodurch Jan Cölln zutreffend kostatiert: „Das Herrscherexempel Alexander bietet wie kaum ein anderes die Möglichkeit, Tugenden und Untugenden eines Herrschers in einer schlüssigen, plausiblen und herausragenden Erzählfigur zu gestalten.“
Diese These soll im Folgenden anhand ausgewählter Textpassagen des Alexanderromans des Pfaffen Lambrecht in der Straßburger Ableitung textimmanent untersucht werden.
Des Weiteren fügt Trude Ehlert hierzu an:
Der Grenzüberschreiter […] steht vielfach als Negativexempel für superbia (sic. Hochmut) […] [und] sein früher Tod für die vanitas (sic. Eitelkeit), Nichtigkeit und Vergänglichkeit irdischer Herrlichkeit. Die disparaten Deutungen und Wertungen stehen oft unverbunden nebeneinander. Eben jene Wertungen werden vom Autor des Straßburger Alexanders am meisten vorgenommen.
Im Kontext der Untersuchung zur Polarität des Protagonisten wird zudem aufgezeigt, inwiefern Alexander als Ikone der Superbia, Hybris, Vanitas sowie curiositas (Neugier) verstanden werden kann. Dem zuvor steht ein kurzer Abriss der Textgenese und -exegese zur Verdeutlichung des uneinheitlichen Alexanderstoffes und Differenzierung von historischem und literarisch-, epischem Alexander. Abschließend folgt der Versuch eines Resümees dieser Arbeit, ob und weshalb der literarische Alexander als moralisch- und affektive Kontrastfigur skizziert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht - Vorauer, Straßburger und Basler Alexander
- „Der Grenzüberschreiter“ - Alexanders Ambivalenz
- Alexanders Geburt, Erziehung und Jugend
- Die Schlacht um Tyrus
- Der Paradieszug
- Der Versuch eines Resümees
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ambivalente Darstellung Alexanders des Großen im Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht und seinen verschiedenen Versionen (Vorauer, Straßburger, Basler Alexander). Die Zielsetzung ist es, die Vielschichtigkeit des literarischen Alexanderbildes zu beleuchten und dessen moralische und affektive Bedeutung im Kontext des mittelalterlichen Denkens zu analysieren.
- Die Textgenese und die verschiedenen Fassungen des Alexanderromans
- Die ambivalente Darstellung Alexanders als Held und Antiheld
- Der Einfluss biblischer und geistlicher Traditionen auf die Darstellung Alexanders
- Die Rolle von Superbia, Hybris und Vanitas im literarischen Alexanderbild
- Alexander als Symbol für die „translatio imperii“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Bedeutung Alexanders des Großen als historische und literarische Figur heraus. Sie betont die Ambivalenz des Alexanderbildes und die Notwendigkeit, historische und literarische Perspektiven zu unterscheiden. Der Fokus liegt auf der anhaltenden Rezeption des Alexanderstoffes im Mittelalter, seiner Erwähnung im Alten Testament und der damit verbundenen heilsgeschichtlichen Bedeutung. Die Einleitung begründet die Wahl des Alexanderromans des Pfaffen Lambrecht als Untersuchungsgegenstand und skizziert die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf ausgewählte Textpassagen der Straßburger Ableitung konzentriert.
Der Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht - Vorauer, Straßburger und Basler Alexander: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Alexanderromans, beginnend bei den lateinischen und volkssprachlichen Vorläufern bis hin zu den drei erhaltenen deutschen Fassungen: Vorauer, Straßburger und Basler Alexander. Es wird die Bedeutung von Quellen wie Quintus Curtius Rufus und Julius Valerius hervorgehoben, sowie die Rolle des ersten deutschen Alexanderromans von Pfaffe Lambrecht, der eine einzigartige Kombination aus geistlicher und weltlicher Erzähltradition aufweist. Der Fokus liegt auf der Vielfalt der Fassungen und ihren spezifischen Merkmalen, die auf unterschiedliche Entstehungszeiten und -kontexte zurückzuführen sind. Das Kapitel analysiert die unterschiedlichen Quellen und wie diese in die verschiedenen Versionen integriert werden.
„Der Grenzüberschreiter“ - Alexanders Ambivalenz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die ambivalente Darstellung Alexanders im Alexanderroman. Es wird analysiert, wie Alexander sowohl als positives Beispiel für Größe und Macht, als auch als negatives Beispiel für Hochmut, Hybris und die Vergänglichkeit irdischer Herrlichkeit präsentiert wird. Die Analyse beleuchtet die widersprüchlichen Charakterzüge Alexanders und deren Bedeutung im Kontext des mittelalterlichen Weltbildes. Die verschiedenen Facetten seines Charakters werden im Detail betrachtet, wobei die Kapitel auf die verschiedenen literarischen Strategien eingehen, die zur Schaffung dieses vielschichtigen Bildes verwendet werden. Das Kapitel untersucht sowohl Alexanders Tugenden als auch seine Laster, und zeigt, wie diese im Roman aufeinanderprallen und eine komplexe Figur erschaffen.
Schlüsselwörter
Alexander der Große, Alexanderroman, Pfaffe Lambrecht, Mittelalter, Antikenroman, Ambivalenz, Superbia, Hybris, Vanitas, translatio imperii, Textgenese, mittelhochdeutsche Literatur, geistliche Tradition, weltliche Literatur, historische Figur, literarische Figur.
Häufig gestellte Fragen zum Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die ambivalente Darstellung Alexanders des Großen im Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht und seinen verschiedenen Versionen (Vorauer, Straßburger, Basler Alexander). Der Fokus liegt auf der Vielschichtigkeit des literarischen Alexanderbildes und dessen moralische und affektive Bedeutung im Kontext des mittelalterlichen Denkens.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Textgenese und die verschiedenen Fassungen des Alexanderromans, die ambivalente Darstellung Alexanders als Held und Antiheld, den Einfluss biblischer und geistlicher Traditionen, die Rolle von Superbia, Hybris und Vanitas im literarischen Alexanderbild, und Alexander als Symbol für die „translatio imperii“.
Welche Versionen des Alexanderromans werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht in seinen drei erhaltenen deutschen Fassungen: Vorauer, Straßburger und Basler Alexander. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen Versionen untersucht, sowie deren jeweilige Entstehungszeiten und -kontexte.
Wie wird Alexander dargestellt?
Alexander wird ambivalent dargestellt, sowohl als positives Beispiel für Größe und Macht, als auch als negatives Beispiel für Hochmut, Hybris und die Vergänglichkeit irdischer Herrlichkeit. Die Arbeit analysiert die widersprüchlichen Charakterzüge Alexanders und deren Bedeutung im mittelalterlichen Weltbild.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf lateinische und volkssprachliche Vorläufer des Alexanderromans, sowie auf die Quellen von Quintus Curtius Rufus und Julius Valerius. Der Fokus liegt auf der einzigartigen Kombination aus geistlicher und weltlicher Erzähltradition im Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit konzentriert sich auf ausgewählte Textpassagen der Straßburger Ableitung des Alexanderromans. Sie analysiert die literarischen Strategien, die zur Schaffung des vielschichtigen Bildes Alexanders verwendet werden, und untersucht sowohl seine Tugenden als auch seine Laster.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alexander der Große, Alexanderroman, Pfaffe Lambrecht, Mittelalter, Antikenroman, Ambivalenz, Superbia, Hybris, Vanitas, translatio imperii, Textgenese, mittelhochdeutsche Literatur, geistliche Tradition, weltliche Literatur, historische Figur, literarische Figur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel über den Alexanderroman des Pfaffen Lambrecht und seine verschiedenen Versionen, ein Kapitel über die ambivalente Darstellung Alexanders, und einen abschließenden Versuch eines Resümees.
- Arbeit zitieren
- Gordon Jung (Autor:in), 2016, Alexander der Große als Grenzüberschreiter. Zur Ambivalenz der literarischen Figur bei Pfaffe Lambrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335460