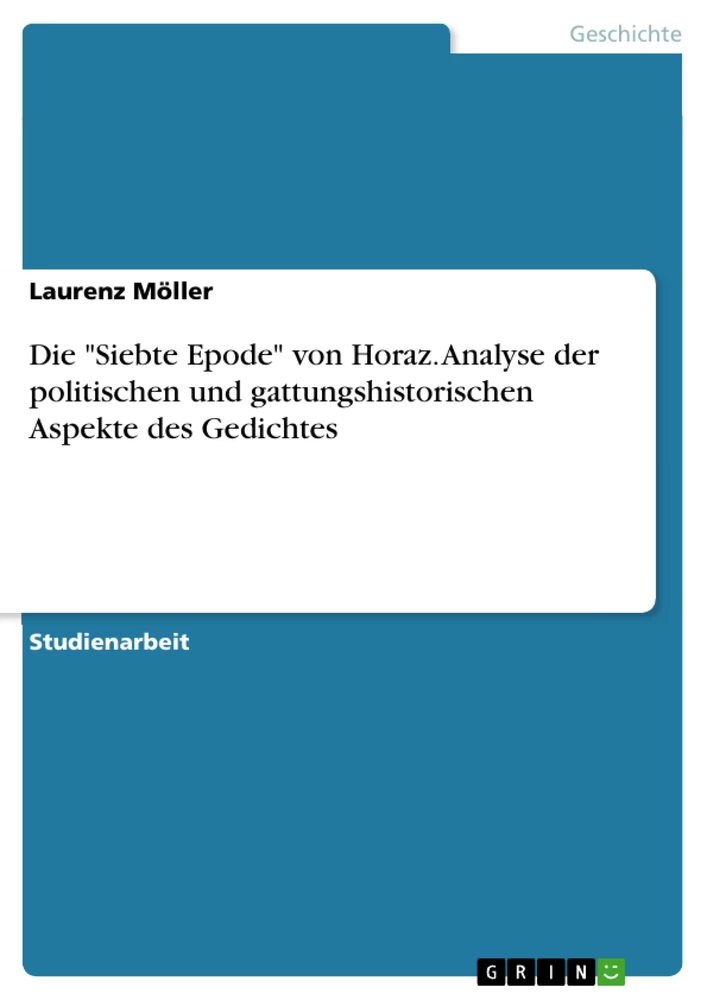In der vorliegenden Arbeit wird die "siebte Epode" von Horaz unter inhaltlichen, zeitgeschichtlichen, biographischen sowie gattungs- und literarhistorischen Aspekten betrachtet.
Was wir über den Dichter Horaz wissen, erschließt sich uns zum größten Teil aus seinen Werken selbst. Daher könnte man annehmen, dass auch seine politische Position darin ersichtlich wird. Um eine solche Position zu finden, ist es sinnvoll, Frühwerke, die vor dem „Augusteischen Frieden“ entstanden sind, zu betrachten. Dies ist deshalb sinnvoll, da zu dieser Zeit weit mehr politische Turbulenzen bestanden und Horaz in weniger engem Kontakt zu seinem späteren Förderer Maecenas und vermutlich gar keinem Kontakt zu Augustus stand, denen dann spätere Werke oft gewidmet waren.
Möglicherweise liegt ein solches Gedicht mit politischen Tendenzen bei der siebten Epode vor. Jedoch ist es fraglich, ob die Aussagen im Gedicht tatsächlich als politisch gewertet werden können und es ist daher ebenso fraglich, ob Horaz zur damaligen Zeit seine Meinung in Gedichten veröffentlicht hätte.
Ziel dieser Arbeit ist es daher unter literarhistorischen Gesichtspunkten zunächst zu untersuchen, ob der Inhalt als politisch oder vielleicht auch nur gesellschafts- oder zeitkritisch bewertet werden kann. In einem nächsten Schritt soll das Gedicht dann in die Biographie des Horaz‘ eingeordnet werden, um zu klären, in wie weit sich der Inhalt des Gedichts überhaupt vom Sprecher auf den Autor übertragen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung und Thematik der Quelle
- Äußere Aspekte der Quelle
- Inhaltliche Aspekte
- Die Kernaussage der Epode vor dem Hintergrund der Biographie
- Künstlerische Hintergründe der Epodendichtung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die siebte Epode des römischen Dichters Horaz unter literarhistorischen Gesichtspunkten. Ziel ist es, den Inhalt des Gedichts auf seine politischen oder gesellschaftlichen Implikationen zu untersuchen und ihn in die Biographie Horazs einzubinden. Dabei soll geklärt werden, inwieweit die Aussagen des Gedichts auf den Autor selbst übertragen werden können.
- Politische Dimension der Epode
- Einordnung in die Biographie Horazs
- Literarische Gattung der Epodendichtung
- Künstlerische Hintergründe der Epoden
- Rezeption der Epode in der Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den Kontext der siebten Epode in Horaz' Gesamtwerk. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Thematik der Epode, wobei die äußeren und inhaltlichen Aspekte beleuchtet werden. Das dritte Kapitel untersucht die Kernaussage der Epode vor dem Hintergrund von Horaz' Biographie und betrachtet die möglichen politischen und gesellschaftlichen Implikationen des Gedichts. Das vierte Kapitel widmet sich den künstlerischen Hintergründen der Epodendichtung und analysiert die gattungsspezifischen Merkmale der Epode.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der römischen Literatur wie der politischen und gesellschaftlichen Dimension von Dichtung, der Biographie des römischen Dichters Horaz, der Gattung der Epodendichtung sowie der Rezeption der Epode in der Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der siebten Epode von Horaz?
Die siebte Epode befasst sich mit den politischen Turbulenzen und dem Bürgerkrieg in Rom. Sie wird oft als gesellschafts- oder zeitkritisch interpretiert.
Warum ist die Untersuchung von Horaz' Frühwerken besonders aufschlussreich?
In seinen Frühwerken, die vor dem „Augusteischen Frieden“ entstanden, war Horaz noch nicht so eng an seine späteren Förderer Maecenas und Augustus gebunden, weshalb seine politische Position dort deutlicher hervortreten könnte.
Lässt sich der Sprecher des Gedichts mit dem Autor Horaz gleichsetzen?
Dies ist eine zentrale Forschungsfrage der Arbeit. Es wird untersucht, inwieweit die im Gedicht geäußerten Meinungen tatsächlich die persönliche politische Haltung des Autors widerspiegeln.
Was kennzeichnet die Gattung der Epode?
Epoden sind eine Form der lyrischen Dichtung, die oft durch einen aggressiven oder spöttischen Ton (Iambos-Tradition) gekennzeichnet sind und zur Kritik an sozialen oder politischen Zuständen genutzt wurden.
In welchem historischen Kontext entstand das Gedicht?
Es entstand in der Zeit der römischen Bürgerkriege, einer Phase großer Instabilität vor der Etablierung des Prinzipats unter Augustus.
- Quote paper
- Laurenz Möller (Author), 2015, Die "Siebte Epode" von Horaz. Analyse der politischen und gattungshistorischen Aspekte des Gedichtes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335546