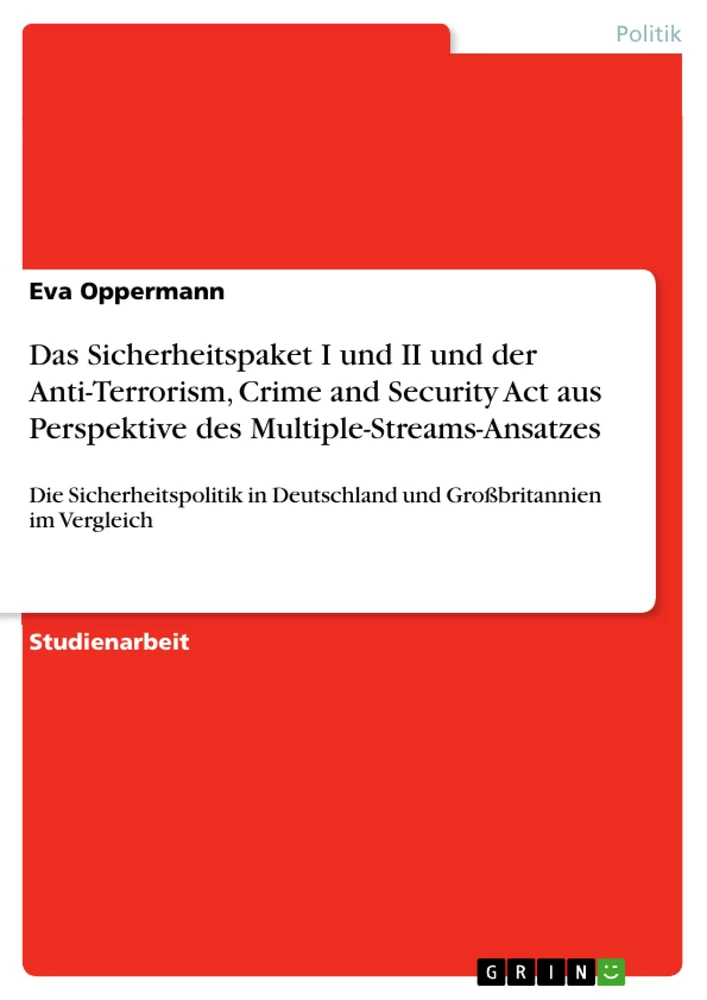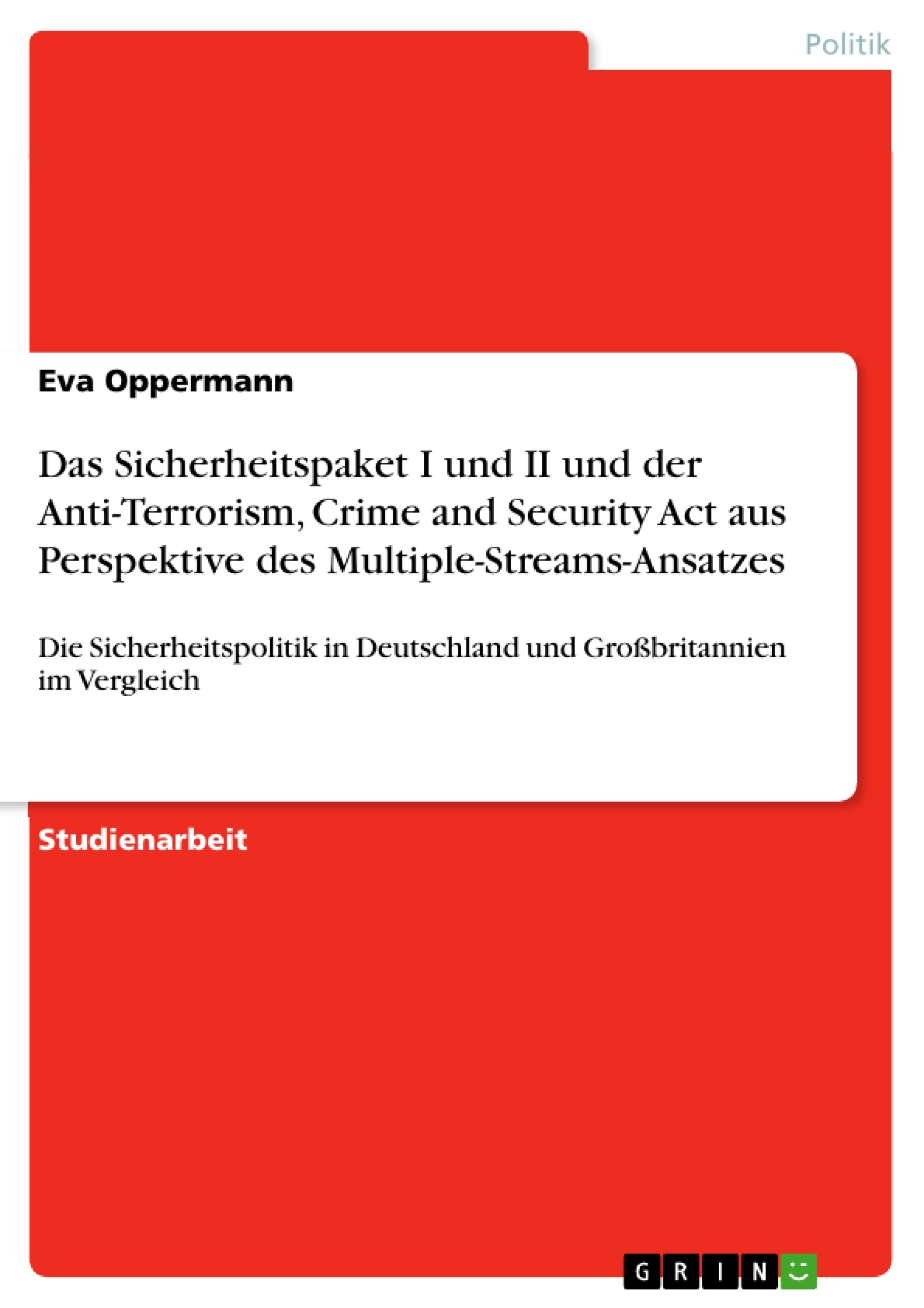Der 11. September 2001 – ein Datum, das einen radikalen Wandel in der Welt markiert. Anschläge gab es freilich schon vor diesem Datum, wir sprechen hier zum Beispiel von der Roten Armee Fraktion oder der Irisch-Republikanischen Armee. Doch die Qualität war nun eine ganz andere. Die Zahl der Opfer war immens, die Medienresonanz noch während der Ereignisse war überwältigend, der ganzen Welt schien der Atem zu stocken angesichts einer solchen Tat.
Die Reaktionen auf diese Anschläge waren in vielen Ländern sehr weitgreifend. Gesetze wurden erlassen um dem Terror Einhalt zu gebieten, militärische Gegenschläge geplant, sogar zum ersten Mal der NATO-Bündnisfall laut Artikel fünf des NATO-Vertrages ausgerufen.
Mit den Gesetzesänderungen kämpften Deutschland und Großbritannien nicht gegen eine tatsächliche, messbare Bedrohung im eigenen Land. Vielmehr gaben die Geheimdienste Entwarnung und versicherten, dass das Risiko eines Anschlages äußerst gering sei. Dennoch fühlten sich beide Länder genötigt, umfassende Änderungen beziehungsweise Erweiterungen in ihren Terrorismusbekämpfungsgesetzen herbeizuführen. Damit begegneten sie einer potenziellen Gefahr und antworteten auf ein Gefühl der Angst.
In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie zwei Länder mit so unterschiedlicher politischer Struktur und Tradition in sicherheitspolitischen Fragen, zu recht ähnlichen Gesetzesanpassungen und -änderungen kommen konnten. Dabei werden zunächst beide Länder für sich betrachtet, hinsichtlich ihrer Politik der inneren Sicherheit vor den Anschlägen, der Wahrnehmung der Anschläge innerhalb der Regierung und der anschließenden Gesetzesänderungen. Danach werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede erläutert um dann in einem dritten Schritt ein theoretisches Konzept auszumachen, das die Vorgänge sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien erklärt.
Die Bearbeitung dieser Frage ist aus verschiedenen Gründen äußerst interessant. Zum einen ist die Gefahr durch Terrorismus ein sehr aktuelles Thema mit großer Medienpräsens. Einige Beispiele für Anschläge mit radikal-islamistischem Hintergrund sind Charlie Hebdo im Februar 2015, Paris im November 2015 und Brüssel im März 2016.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Fall Großbritannien
- Tradition der Sicherheitspolitik
- Die Wahrnehmung der Terroranschläge
- Der Anti-Terrorism, Crime and Security Act
- Der Fall Deutschland
- Tradition der Sicherheitspolitik
- Die Wahrnehmung der Terroranschläge
- Die Sicherheitspakete I und II
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie zwei Länder mit unterschiedlichen politischen Strukturen und Traditionen in Sicherheitsfragen zu ähnlichen Gesetzesanpassungen und -änderungen im Bereich der Terrorismusbekämpfung kamen, insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September 2001.
- Die Tradition der Sicherheitspolitik in Deutschland und Großbritannien vor den Anschlägen
- Die Wahrnehmung der Terroranschläge in den Regierungen beider Länder
- Die Gesetzesänderungen in Deutschland (Sicherheitspakete I und II) und Großbritannien (Anti-Terrorism, Crime and Security Act)
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Gesetzesänderungen
- Eine theoretische Erklärung der Gemeinsamkeiten im Kontext der Politikentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel beleuchtet die globalen Auswirkungen der Anschläge vom 11. September 2001 und die Notwendigkeit, die Reaktionen von Deutschland und Großbritannien auf diese Ereignisse zu untersuchen. Es wird auf die weitreichenden Gesetzesänderungen eingegangen, die in beiden Ländern verabschiedet wurden, obwohl keine unmittelbare Bedrohung bestand. Der Fokus der Arbeit liegt darauf, die ähnlichen Gesetzesänderungen trotz unterschiedlicher politischer Strukturen zu erklären.
- Der Fall Großbritannien: Dieses Kapitel behandelt die britische Tradition der Terrorismusbekämpfung, die durch den Konflikt in Nordirland geprägt ist. Es wird die Bedeutung des Prevention of Terrorism Act von 1974 hervorgehoben und die Reaktion Großbritanniens auf die Anschläge vom 11. September, die zur Verabschiedung des Anti-Terrorism, Crime and Security Act führte.
- Der Fall Deutschland: Dieser Abschnitt analysiert die deutsche Tradition der Sicherheitspolitik und die Reaktion auf die Anschläge vom 11. September. Es werden die Sicherheitspakete I und II als Reaktion auf die Anschläge beleuchtet und die Gesetzgebungsprozesse in Deutschland erläutert.
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Dieses Kapitel vergleicht die Reaktionen Deutschlands und Großbritanniens auf die Anschläge und untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Gesetzesänderungen. Es werden die Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Ausweitung der Überwachungsmaßnahmen und die Stärkung der Polizeivollmachten hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themengebiete innere Sicherheitspolitik, Terrorismusbekämpfung, Anti-Terrorismusgesetzgebung, Sicherheitspakete I und II, Anti-Terrorism, Crime and Security Act, Multiple Streams Ansatz, Most-Different-Same-Outcome-Design (MSDO), Vergleichende Fallstudie, Deutschland, Großbritannien.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Sicherheitspakete I und II?
Es handelt sich um deutsche Gesetzesänderungen zur Terrorismusbekämpfung, die als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 verabschiedet wurden.
Was ist der Anti-Terrorism, Crime and Security Act?
Dies ist das britische Pendant zu den deutschen Sicherheitspaketen, welches ebenfalls nach den Anschlägen von 2001 umfassende Sicherheits- und Überwachungsbefugnisse einführte.
Welchen theoretischen Ansatz nutzt die Arbeit zur Erklärung der Gesetzesänderungen?
Die Arbeit nutzt den Multiple-Streams-Ansatz (MSA), um zu erklären, wie unterschiedliche politische Systeme zu ähnlichen gesetzlichen Lösungen kommen konnten.
Gab es vor den Gesetzen eine messbare Bedrohung in Deutschland oder UK?
Nein, die Geheimdienste gaben oft Entwarnung; die Gesetze waren eher eine Antwort auf ein diffuses Angstgefühl und eine potenzielle Gefahr nach den Ereignissen in den USA.
Wie unterschieden sich die Traditionen der Sicherheitspolitik?
Großbritannien war stark durch den Nordirland-Konflikt geprägt, während Deutschland eine andere rechtliche und historische Herangehensweise an die innere Sicherheit hatte.
- Quote paper
- Eva Oppermann (Author), 2016, Das Sicherheitspaket I und II und der Anti-Terrorism, Crime and Security Act aus Perspektive des Multiple-Streams-Ansatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335556