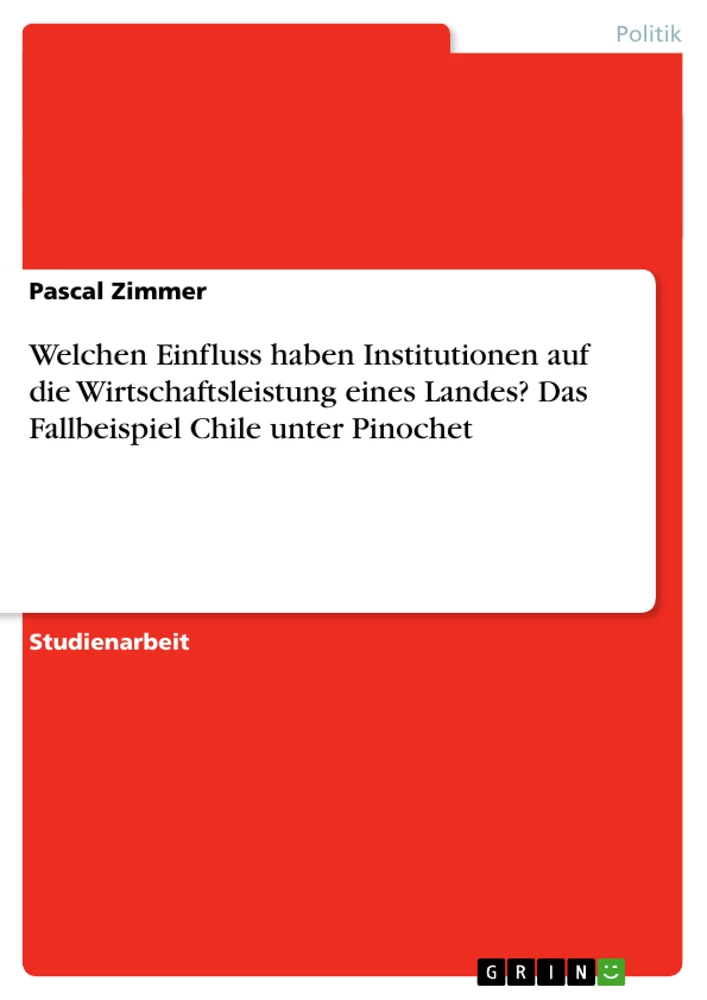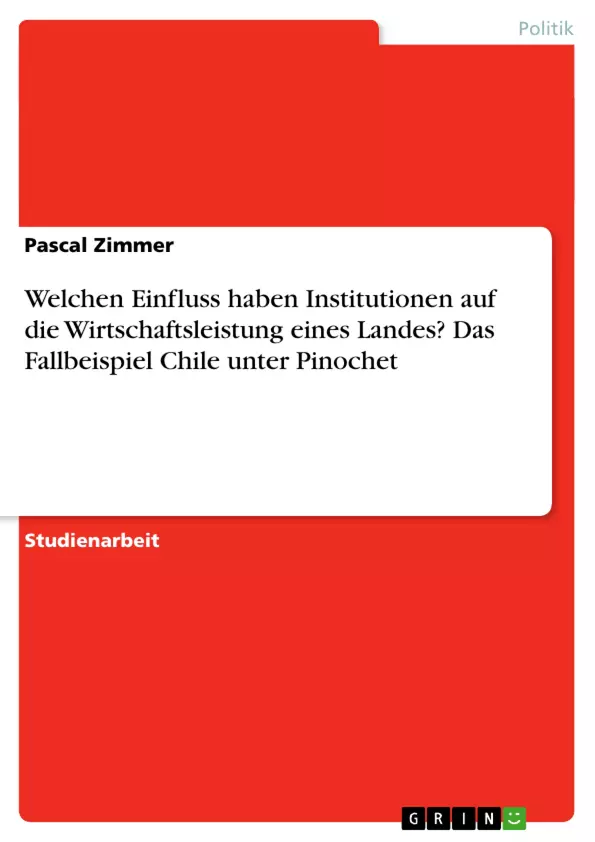Diese Frage hat sich vielleicht jeder Mensch in seinem Leben schon einmal gestellt. Und etwas anders formuliert beinhaltet sie auch gleich das Problem, mit dem sich Ökonomen hauptsächlich, Wissenschaftler anderer Disziplinen aber gelegentlich auch beschäftigen, nämlich welche Faktoren bestimmen den Wohlstand der Nationen? Wirtschaftliche Zusammenhänge sind komplex und nicht leicht zu durchschauen.
Deshalb verwundert es auch nicht, dass es unzählige Ansätze gibt, die unser Problem zu erörtern versuchen. Klassische Vertreter der Ökonomie betrachteten nur einige wenige Variablen, wie Kapital, Boden und Arbeitskraft, um die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft zu erklären. Dass dieser Ansatz zu kurz greift, ist mittlerweile gemeinhin anerkannt und es wurde nach neuen Erklärungsansätzen gesucht. Eine recht junge Theorie ist die Neue Institutionenökonomie (NIÖ). Sie lehnt die klassischen Prämissen der Ökonomie ab, wie etwa das Menschenbild des homo oeconomicus und die vollkommene Rationalität von Individuen. Stattdessen nimmt sie an, dass die Strukturen einer Gesellschaft, die dort gültigen Normen und Wertvorstellungen, sowie deren Verhältnis zur Struktur des Herrschaftssystems und den gültigen Gesetzen - im Sprachgebrauch der NIÖ handelt es sich bei all diesen Dingen um Institutionen - das Netz bilden, in dem Individuen in Kooperation miteinander treten. Oder auch eben nicht.
Um diese Theorie an einem empirischen Beispiel anzuwenden, bietet es sich an, ein Land auszuwählen, in dem dieses Verhältnis von internen und externen Institutionen innerhalb kürzester Zeit verändert wurde. Ein solches Land ist Chile 1973 nach der Machtübernahme der Militärs unter General Augusto Pinochet gewesen. Die Fragestellung, der ich in dieser Arbeit nachgehen werde, lautet also: „Welchen Einfluss haben Institutionen auf die Wirtschaftsleistung eines Landes? Das Fallbeispiel Chile unter Pinochet.“ Dazu werden zunächst die theoretischen Grundlagen der NIÖ vorgestellt. Danach folgt eine Darstellung der Maßnahmen, die vor dem Hintergrund der Theorie durchgesetzt wurden, um eine höhere Wirtschaftsleistung zu erzielen. Ob diese auch den vorhergesagten Erfolg hatten, wird im Anschluss erörtert. Die Ergebnisse werden dann im letzten Kapitel noch einmal pointierend zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II.1 Theoretische Grundlagen
- II.2 Vor dem Hintergrund der Theorie durchgeführte Maßnahmen
- II.3 Ergebnisse der ergriffenen Maßnahmen
- III. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Institutionen auf die Wirtschaftsleistung eines Landes, wobei Chile unter der Herrschaft von General Augusto Pinochet als Fallbeispiel dient. Ziel ist es, die Theorie der Neuen Institutionenökonomie (NIÖ) anhand dieses Beispiels zu veranschaulichen und zu analysieren, wie politische und wirtschaftliche Veränderungen im Kontext von Institutionen die Wirtschaftsleistung beeinflussen können.
- Die Rolle von Institutionen in der Wirtschaftsleistung
- Die theoretischen Grundlagen der Neuen Institutionenökonomie (NIÖ)
- Die wirtschaftlichen Maßnahmen in Chile unter Pinochet im Kontext der NIÖ
- Die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen für die chilenische Wirtschaft
- Die Auswirkungen von Institutionen auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Welchen Einfluss haben Institutionen auf die Wirtschaftsleistung eines Landes? Es wird die Komplexität wirtschaftlicher Zusammenhänge betont und die Notwendigkeit neuer Erklärungsansätze hervorgehoben, wobei die NIÖ als ein vielversprechender Ansatz vorgestellt wird.
Kapitel II.1 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der NIÖ. Es werden die zentralen Annahmen der Theorie erläutert, insbesondere die Kritik am klassischen Menschenbild des homo oeconomicus und die Betonung der beschränkten Rationalität von Individuen. Der Begriff der Transaktionskosten wird eingeführt und im Zusammenhang mit der Entstehung von Institutionen diskutiert. Es wird argumentiert, dass Institutionen dazu dienen, Transaktionskosten zu senken und die Unsicherheit in Interaktionssituationen zu minimieren. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird die Rolle von Institutionen bei der Steigerung der Produktivität und der Wohlfahrtssteigerung auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet.
Kapitel II.2 befasst sich mit den konkreten Maßnahmen, die vor dem Hintergrund der NIÖ in Chile unter Pinochet durchgeführt wurden. Die Arbeit geht nicht auf die Details der Maßnahmen ein, sondern konzentriert sich auf die grundlegenden Prinzipien der NIÖ, die diesen Maßnahmen zugrunde lagen.
Kapitel II.3 analysiert die Ergebnisse der in Chile unter Pinochet durchgeführten Maßnahmen. Die Arbeit befasst sich nicht mit detaillierten ökonomischen Daten, sondern beleuchtet die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Wirtschaft in Bezug auf die zentrale Fragestellung der Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Konzepten der Neuen Institutionenökonomie (NIÖ), wie Transaktionskosten, beschränkte Rationalität, Institutionen, und deren Einfluss auf die Wirtschaftsleistung eines Landes. Sie betrachtet Chile unter Pinochet als ein Fallbeispiel, um diese Konzepte zu illustrieren. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Institutionen für die wirtschaftliche Entwicklung und die Gestaltung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Neue Institutionenökonomie (NIÖ)?
Die NIÖ untersucht, wie gesellschaftliche Normen, Werte und Gesetze (Institutionen) die wirtschaftliche Leistung eines Landes beeinflussen.
Warum dient Chile unter Pinochet als Fallbeispiel?
In dieser Zeit wurden interne und externe Institutionen radikal verändert, was eine Analyse der Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung ermöglicht.
Was sind Transaktionskosten?
Transaktionskosten sind Kosten, die bei der Nutzung des Marktes entstehen. Institutionen helfen dabei, diese Kosten zu senken und Unsicherheiten zu minimieren.
Welche Kritik übt die NIÖ am "Homo Oeconomicus"?
Sie lehnt die Annahme vollkommener Rationalität ab und geht stattdessen von einer beschränkten Rationalität der Individuen aus.
Wie steigern Institutionen die Produktivität?
Durch die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen fördern sie Kooperationen und Investitionen, was zu einer höheren gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt führt.
- Arbeit zitieren
- Pascal Zimmer (Autor:in), 2004, Welchen Einfluss haben Institutionen auf die Wirtschaftsleistung eines Landes? Das Fallbeispiel Chile unter Pinochet, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33565