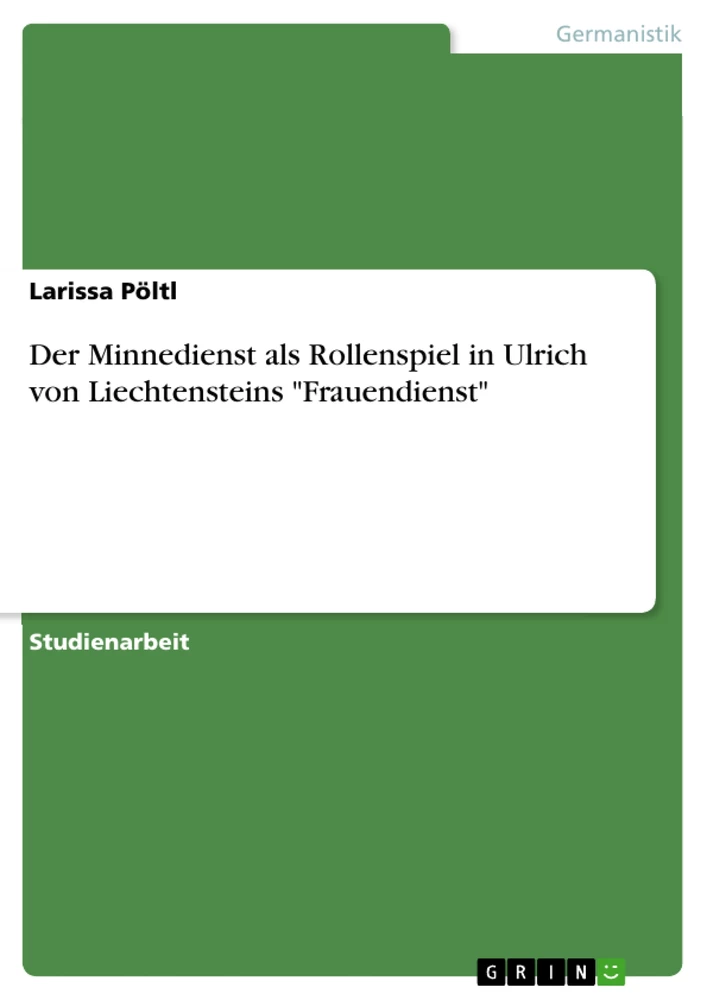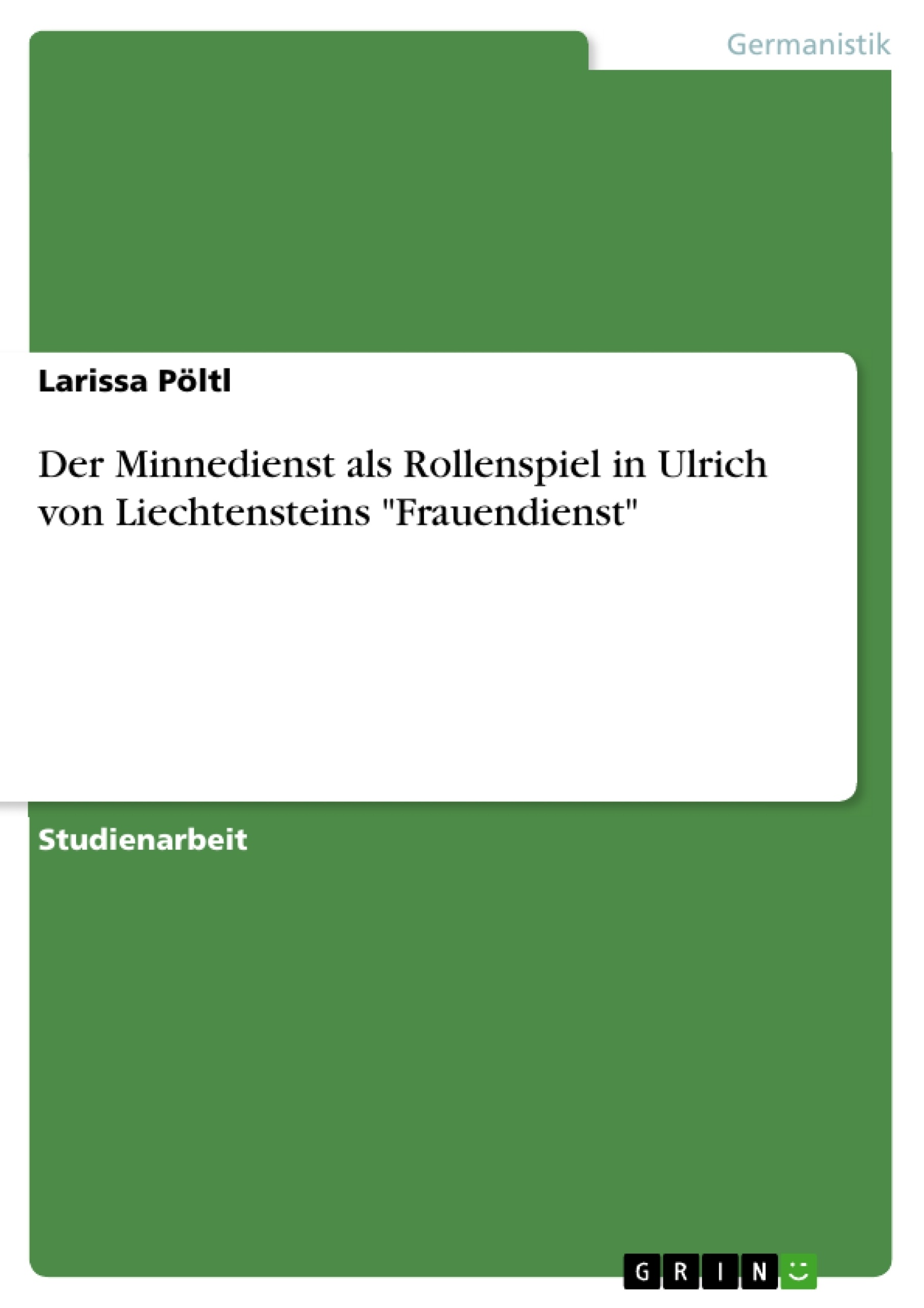Im Folgenden soll erläutert werden, inwiefern der Minnedienst Ulrich von Liechtensteins an seine Dame mit den gängigen Minnediensten jener Zeit einhergeht und was für eine Rolle die Ehefrau dabei spielt.
Dieser Frauendienst wird von ihr nicht erwidert, egal wie sehr Ulrich sich bemüht. Er unterstellt sich der Dame bis zur gänzlichen Selbstaufgabe und macht sich dadurch fast lächerlich. Sein einziges Ziel scheint die Liebe der Herrin zu sein und dafür tut er alles. Diese Handlung passt perfekt in die damalige Form des Minnedienstes; ein Mann versucht, eine ihm höher gestellte Dame für sich zu gewinnen und stellt sich in ihren Dienst. Im Frauendienst gibt es in Bezug auf dieses höfische Ideal aber einen Makel: Ulrich ist, scheinbar glücklich, verheiratet. Diese Ehefrau steht aber seiner Liebe zur Dame nicht im Weg, sie ist nur eine Randfigur. Wie passt sie dann in die Handlung? Ein weiterer Dorn im Auge ist, dass die Herrin ebenfalls verheiratet ist. Nun kommt noch das Motiv des vermeidlichen Ehebruchs in die Geschichte. Dieser wird jedoch nie ausgeführt, da die Dame nicht auf Ulrichs Avancen eingeht. Ulrich hingegen scheint kein Problem mit dem Ehebruch zu haben, er will ja sogar Geschlechtsverkehr mit der Herrin haben.
Zuerst wird das daher das Prinzip des Minnedienstes und dann das der Ehe erläutert. Danach wird anhand des Frauendienst analysiert, wie diese beiden historischen Konzepte im Buch angewendet werden. Es soll argumentiert werden, dass der Frauendienst nur eine Rolle ist, die Ulrich annimmt. Für ihn ist es nicht unüblich, jemand anderen darzustellen. In der Venusfahrt verkleidet er sich komplett als Frau. Somit hat er eine Tendenz zu Rollenspielen. Der Minnedienst ist nur eine weitere öffentliche Darstellung, ein öffentliches Schauspiel. Die Dame steigt in dieses Spiel mit ein, indem sie ihn hinhält und immer wieder Hoffnungen macht, ihn aber nie an sich ranlässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Minne als Dienstleistung
- Die Rolle der Ehefrau
- Minne und Ehe im Frauendienst
- Theoretische Aspekte
- Textanalyse Frauendienst
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Minnedienst in Ulrich von Liechtensteins „Frauendienst“ im Kontext der höfischen Minne des Mittelalters. Im Fokus steht die Analyse der Rolle Ulrichs und seiner Ehefrau innerhalb dieses Minnedienstes, der trotz Ehebindung ausgelebt wird. Die Arbeit beleuchtet die Frage, inwieweit Ulrichs Handlungen den Konventionen des Minnedienstes entsprechen und wie die Figur der Ehefrau in dieses Konzept integriert wird.
- Der Minnedienst als gesellschaftliches Phänomen
- Die Rolle der Ehefrau im Kontext des Minnedienstes
- Ulrichs Darstellung des Minnedienstes als Rollenspiel
- Die Verbindung von Minne und Ehe in Ulrichs Handlungen
- Die literarische und gesellschaftliche Bedeutung des „Frauendienstes“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Minnedienstes in Ulrich von Liechtensteins „Frauendienst“ ein. Sie stellt die zentrale Frage nach der Rolle der Ehefrau im Kontext von Ulrichs unerwiderter Liebe zu seiner Dame und dem daraus resultierenden, scheinbar widersprüchlichen Verhalten. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der eine Analyse des Minnedienstes im historischen Kontext mit einer detaillierten Textanalyse verbindet, um Ulrichs Handeln als Rollenspiel zu interpretieren.
Die Minne als Dienstleistung: Dieses Kapitel untersucht das Konzept der höfischen Minne im Mittelalter. Es beleuchtet die Verehrung der Dame als Göttin und die damit verbundene Dienstleistung des Mannes, die sich in Liedern und Handlungen äußert. Der Text analysiert verschiedene Arten höfischer Liebe, ihre gesellschaftliche Funktion und die oft unerfüllte Natur des Dienstes, der trotz der Zurückweisung der Dame fortgesetzt wird. Der Fokus liegt auf den ambivalenten Aspekten der Minne, die sowohl gesellschaftliche Normen bestärken als auch ein Streben nach persönlicher Vollkommenheit repräsentieren können. Die Ambivalenz wird in Bezug auf hohe und niedere Minne, sowie "gute" und "schlechte" Liebe beleuchtet.
Schlüsselwörter
Minnedienst, höfische Minne, Ulrich von Liechtenstein, Frauendienst, Ehe, Rollenspiel, gesellschaftliche Normen, Textanalyse, Mittelalter, Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu Ulrich von Lichtensteins "Frauendienst"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Minnedienst in Ulrich von Liechtensteins "Frauendienst" im Kontext der höfischen Minne des Mittelalters. Der Fokus liegt auf der Rolle Ulrichs und seiner Ehefrau innerhalb dieses Minnedienstes, der trotz Ehebindung ausgelebt wird. Es wird untersucht, inwieweit Ulrichs Handlungen den Konventionen des Minnedienstes entsprechen und wie die Figur der Ehefrau in dieses Konzept integriert wird.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte des Minnedienstes, darunter den Minnedienst als gesellschaftliches Phänomen, die Rolle der Ehefrau im Kontext des Minnedienstes, Ulrichs Darstellung des Minnedienstes als Rollenspiel, die Verbindung von Minne und Ehe in Ulrichs Handlungen und die literarische und gesellschaftliche Bedeutung des "Frauendienstes". Die Analyse umfasst theoretische Aspekte der höfischen Minne und eine detaillierte Textanalyse des "Frauendienstes".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Minne als Dienstleistung, ein Kapitel über die Rolle der Ehefrau, ein Kapitel über Minne und Ehe im Frauendienst (mit Unterkapiteln zu theoretischen Aspekten und der Textanalyse des Frauendienstes) und einen Schluss.
Wie wird der Minnedienst in der Arbeit betrachtet?
Der Minnedienst wird als komplexes gesellschaftliches Phänomen betrachtet, das sowohl gesellschaftliche Normen widerspiegelt als auch individuelle Strebungen nach persönlicher Vollkommenheit ausdrückt. Die Arbeit analysiert die ambivalenten Aspekte der Minne, einschließlich der Unterscheidung zwischen hoher und niederer Minne sowie "guter" und "schlechter" Liebe.
Welche Rolle spielt die Ehefrau in der Analyse?
Die Rolle der Ehefrau im Kontext des Minnedienstes ist ein zentraler Aspekt der Arbeit. Die Analyse untersucht, wie die Figur der Ehefrau in das Konzept des Minnedienstes integriert wird und wie sich Ulrichs Handlungen zu seiner Ehefrau in Bezug auf die höfischen Minnekonventionen verhalten.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine Analyse des Minnedienstes im historischen Kontext mit einer detaillierten Textanalyse des "Frauendienstes". Ulrichs Handeln wird als Rollenspiel interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Minnedienst, höfische Minne, Ulrich von Liechtenstein, Frauendienst, Ehe, Rollenspiel, gesellschaftliche Normen, Textanalyse, Mittelalter, Literatur.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Minnedienst in Ulrich von Liechtensteins "Frauendienst" zu untersuchen und die Rolle der Ehefrau in diesem Kontext zu analysieren. Es geht darum, Ulrichs Handlungen zu interpretieren und ihre Bedeutung im Hinblick auf die höfischen Minnekonventionen und die gesellschaftlichen Normen des Mittelalters zu beleuchten.
- Quote paper
- Larissa Pöltl (Author), 2014, Der Minnedienst als Rollenspiel in Ulrich von Liechtensteins "Frauendienst", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335850