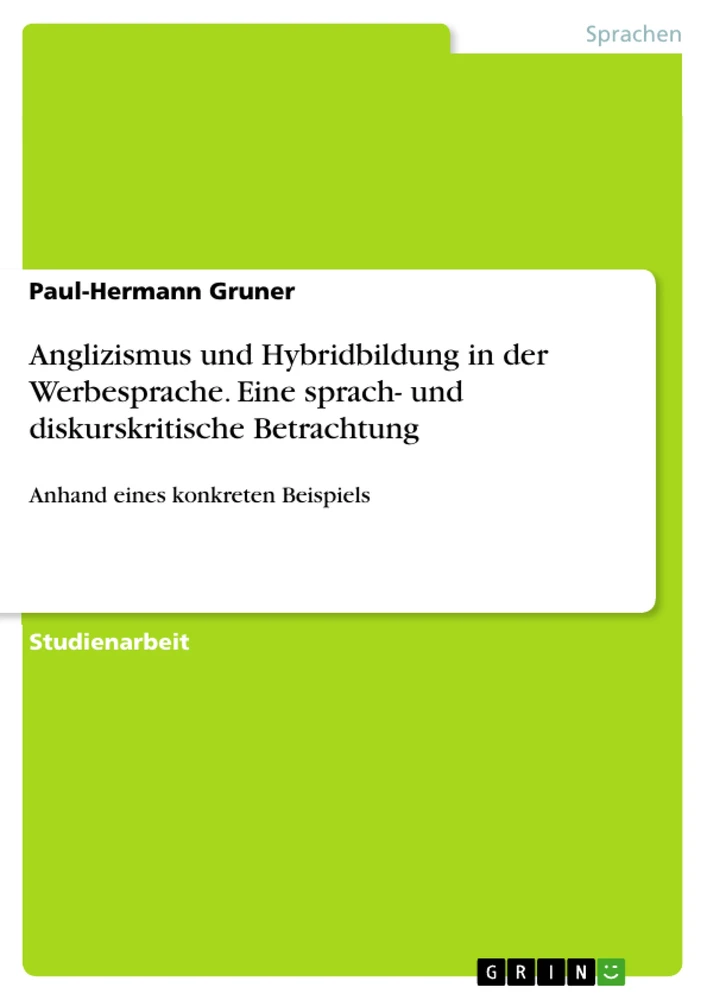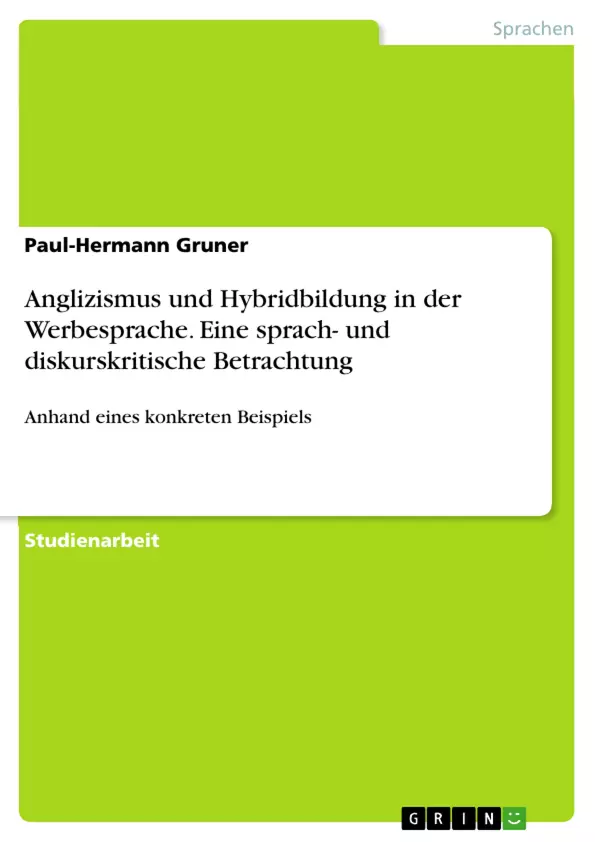Die Arbeit widmet sich sprachreflexiv und diskurskritisch einer einzelnen kurzen Sentenz aus der Domäne der Wirtschaftskommunikation.
Das Deutsche im Kontext von Globalisierung und Denglisch-Okkurenz steht zur Debatte, ebenso Sprachinnovationen als Ausdruck von Trendkommunikation. Auch jene muss sich eine Kritik im Hinblick auf ausgewählte Sprachnormen und Konversationsmaximen sowie eine Prüfung ihrer werbesprachlichen Funktion gefallen lassen.
Die Betrachtung der Phrase "My Back & Coffee" (Teil einer gastronomischen Außenwerbung im Bezirk Neukölln/Berlin) berücksichtigt die sozialen, kulturellen und ethnischen Zusammenhänge im lebensräumlichen Milieu, betrachtet die sich gegenseitig stimulierenden Wirkflächen von Alltagssprache, Umgangssprache, Werbesprache, Kiezsprache und ethnolektalen Varietäten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Einleitung: „My Back & Coffee“ – Blick auf Zusammenhänge zwischen Umgangssprache, Werbesprache, Kiezsprache und Ethnolekt
- Methodischer Ansatz dieser Betrachtung
- Pragmatik
- Semantik
- Diskurshermeneutik und Mentalitätsforschung
- „My Back & Coffee“: Das Deutsche im Kontext der Globalisierung und der Denglisch-Okkurenz
- Das äußere Druckmoment
- Das innere Druckmoment
- Das Phänomen „Denglisch“
- „My Back & Coffee“: Sprachinnovation als Ausdruck von Trendkommunikation
- Textualität und Phrase
- … to go: Ein Sprachtrend und seine kurze Historie
- „My Back & Coffee: Eine Sprachkritik im Hinblick auf ausgewählte Sprachnormen, Konversationsmaximen, werbesprachliche Funktionen
- Zusammenfassung und Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die sprachliche und diskurskritische Bedeutung der Phrase „My Back & Coffee“, die als Werbeanzeige für ein Bistro in Neukölln dient. Sie analysiert die Sprache im Kontext von Neukölln als ein von Migrationsbewegungen geprägtes Stadtviertel. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss von Umgangssprache, Kiezsprache, Ethnolekten und Werbesprache auf die Phrase. Sie befasst sich mit dem Phänomen des Denglisch und analysiert das Sprachspiel der Phrase anhand von ausgewählten Sprachnormen und Konversationsmaximen.
- Die Entwicklung von Kiezsprache und Ethnolekten in Neukölln
- Die sprachliche und diskurskritische Analyse der Phrase „My Back & Coffee“
- Die Bedeutung von Anglizismen und Denglisch in der deutschen Sprache
- Die Funktion von Werbesprache im Kontext von Sprachinnovation
- Die Analyse der Phrase anhand von Sprachnormen und Konversationsmaximen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Vorbemerkung skizziert den soziokulturellen Kontext von Neukölln als ein von Migrationsbewegungen geprägtes Stadtviertel. Die Einleitung analysiert die Phrase "My Back & Coffee" als ein Beispiel für die Verschränkung von Umgangssprache, Werbesprache, Kiezsprache und Ethnolekten.
Der methodische Ansatz der Arbeit beinhaltet pragmatische, semantische und diskurshermeneutische Perspektiven. Das Kapitel über "My Back & Coffee" im Kontext der Globalisierung und der Denglisch-Okkurenz untersucht die äußeren und inneren Druckmomente, die das Deutsche im Kontext von Globalisierung, Weltwirtschaft und Sprachvereinheitlichung beeinflussen.
Das Kapitel über Sprachinnovation analysiert die Phrase als ein Beispiel für Trendkommunikation und beleuchtet den Einfluss der "to go"-Konstruktion auf die deutsche Sprache.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sprachkritik, Werbesprache, Kiezsprache, Ethnolekten, Anglizismen, Denglisch, Sprachinnovation, Neukölln und Globalisierung. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Phrase "My Back & Coffee" als ein Beispiel für die sprachlichen und diskursiven Prozesse, die in einem multikulturellen und globalisierten Kontext stattfinden.
- Quote paper
- Paul-Hermann Gruner (Author), 2016, Anglizismus und Hybridbildung in der Werbesprache. Eine sprach- und diskurskritische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335953