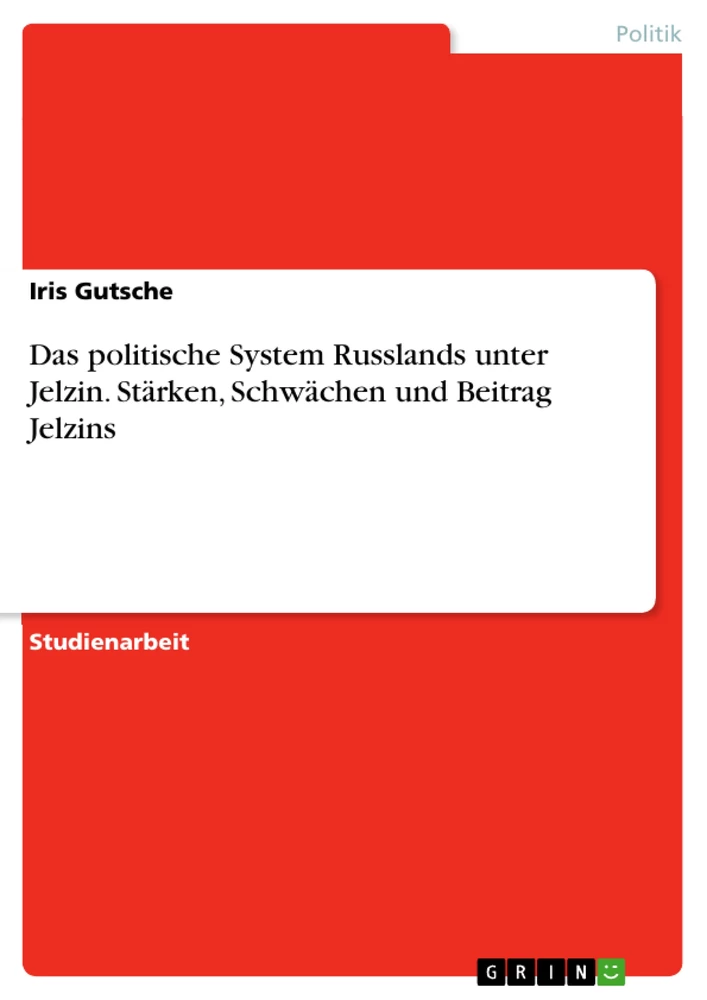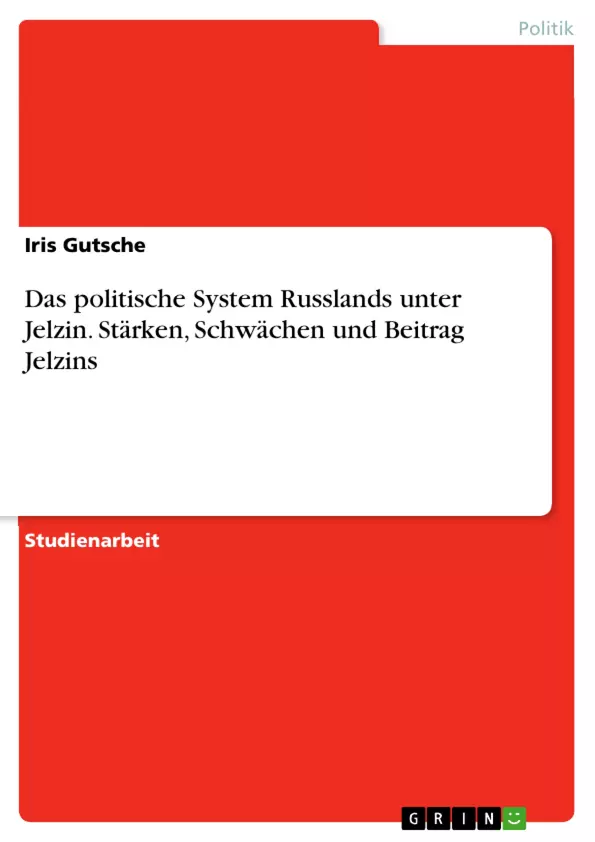Im Folgenden wird das politische System in der Ära Jelzins näher beleuchtet und analysiert. Insbesondere wird die Frage geklärt: „Inwieweit hat Jelzin zur Entwicklung des politischen Systems Russlands beigetragen“? Zudem wird erörtert, welche Stärken und Schwächen sich in seinem System wiederfinden.
Zu Beginn wird eine Biographie Jelzins vor seiner Regierungszeit dargestellt, welche einen Einblick in die wichtigsten Ereignisse zu der Zeit gibt und die Intention hat, auf einige bedeutende Informationen aus seiner Lebensgeschichte hinzuweisen. Im nächsten Schritt wird noch einmal ausführlich der Systemübergang unter Gorbatschow und Jelzin geschildert. Anlehnend daran wird Russland, unter der Regierung Jelzins vom Jahre 1991-1999, betrachtet. Nachfolgend wird explizit auf das politische System Russlands unter der Macht Jelzins eingegangen. Auch die Schwächen und die Stärken seines Systems werden in diesem Punkt eingehend diskutiert. Darüber hinaus ist Teil der Hausarbeit, das Vermächtnis Boris Jelzins, summarisch zu thematisieren. Zum Ende hin werden also die Konsequenzen, die sich aus der Regierungszeit Jelzins ergeben haben, dargestellt und erläutert. Die diskutierten Positionen werden noch einmal aufgegriffen und mit einem schlüssigen Fazit abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politische Biographie Jelzins vor seiner Präsidentschaft
- Systemübergang unter Gorbatschow und Jelzin: UdSSR/Russland
- Russland in der Ära Jelzins von 1991-1999
- Ziele, Legitimität und Machtabsicherung unter Jelzins Führung
- „Parteien der Macht“ und politische Opposition
- Das politische System Russlands unter der Macht Boris Nicolaijewitsch Jelzin
- Allgemeines
- Umfrage über Jelzins Regentschaft
- Stärken des politischen Systems
- Schwächen des politischen Systems
- Bilanz der Ära Jelzins
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das politische System Russlands während der Präsidentschaft von Boris Jelzin (1991-1999). Sie untersucht Jelzins Beitrag zur Entwicklung des politischen Systems, beleuchtet seine Stärken und Schwächen und ergründet die Folgen seiner Regentschaft für Russland.
- Der Systemübergang von der UdSSR zu Russland unter Gorbatschow und Jelzin
- Jelzins Ziele, die Legitimität seiner Macht und seine Strategien zur Machtabsicherung
- Die Rolle von „Parteien der Macht“ und politischer Opposition in Jelzins System
- Die Stärken und Schwächen des politischen Systems Russlands unter Jelzins Herrschaft
- Die Bilanz der Ära Jelzins und ihre Folgen für das politische System Russlands
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den historischen Kontext des Zusammenbruchs der Sowjetunion dar. Sie beleuchtet den Staatsstreich gegen Gorbatschow, die Gründung der GUS und Jelzins Aufstieg zur Präsidentschaft Russlands.
Kapitel 2 beleuchtet Jelzins politische Biographie vor seiner Präsidentschaft. Es gibt Einblicke in wichtige Ereignisse und beleuchtet bedeutende Stationen seiner Lebensgeschichte.
Kapitel 3 analysiert den Systemübergang von der UdSSR zu Russland unter Gorbatschow und Jelzin. Es untersucht die Herausforderungen und den Prozess der politischen Transformation.
Kapitel 4 befasst sich mit Russland während der Ära Jelzins von 1991-1999. Es untersucht Jelzins Ziele und Strategien zur Machtergreifung und -sicherung sowie die Rolle von „Parteien der Macht“ und politischer Opposition.
Kapitel 5 betrachtet das politische System Russlands unter der Macht Jelzins. Es analysiert die Stärken und Schwächen seines Systems sowie die Folgen seiner Entscheidungen für Russland.
Schlüsselwörter
Boris Jelzin, politische System, Russland, UdSSR, Gorbatschow, Systemübergang, „Parteien der Macht“, politische Opposition, Stärken, Schwächen, Machtabsicherung, Legitimität, Folgen, Bilanz.
- Quote paper
- Iris Gutsche (Author), 2016, Das politische System Russlands unter Jelzin. Stärken, Schwächen und Beitrag Jelzins, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336358