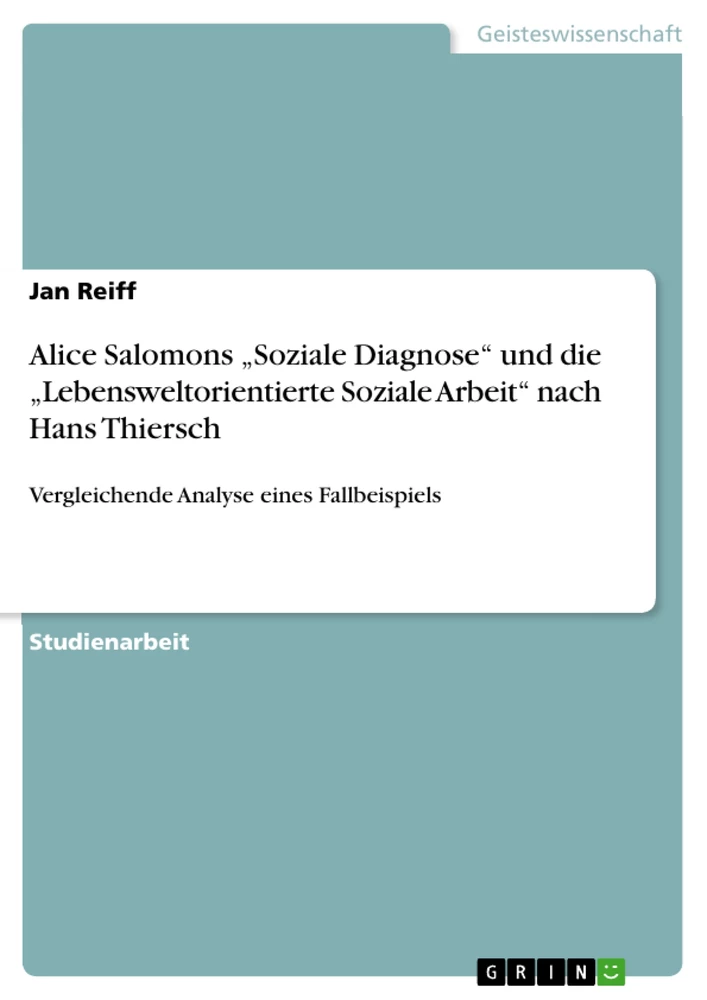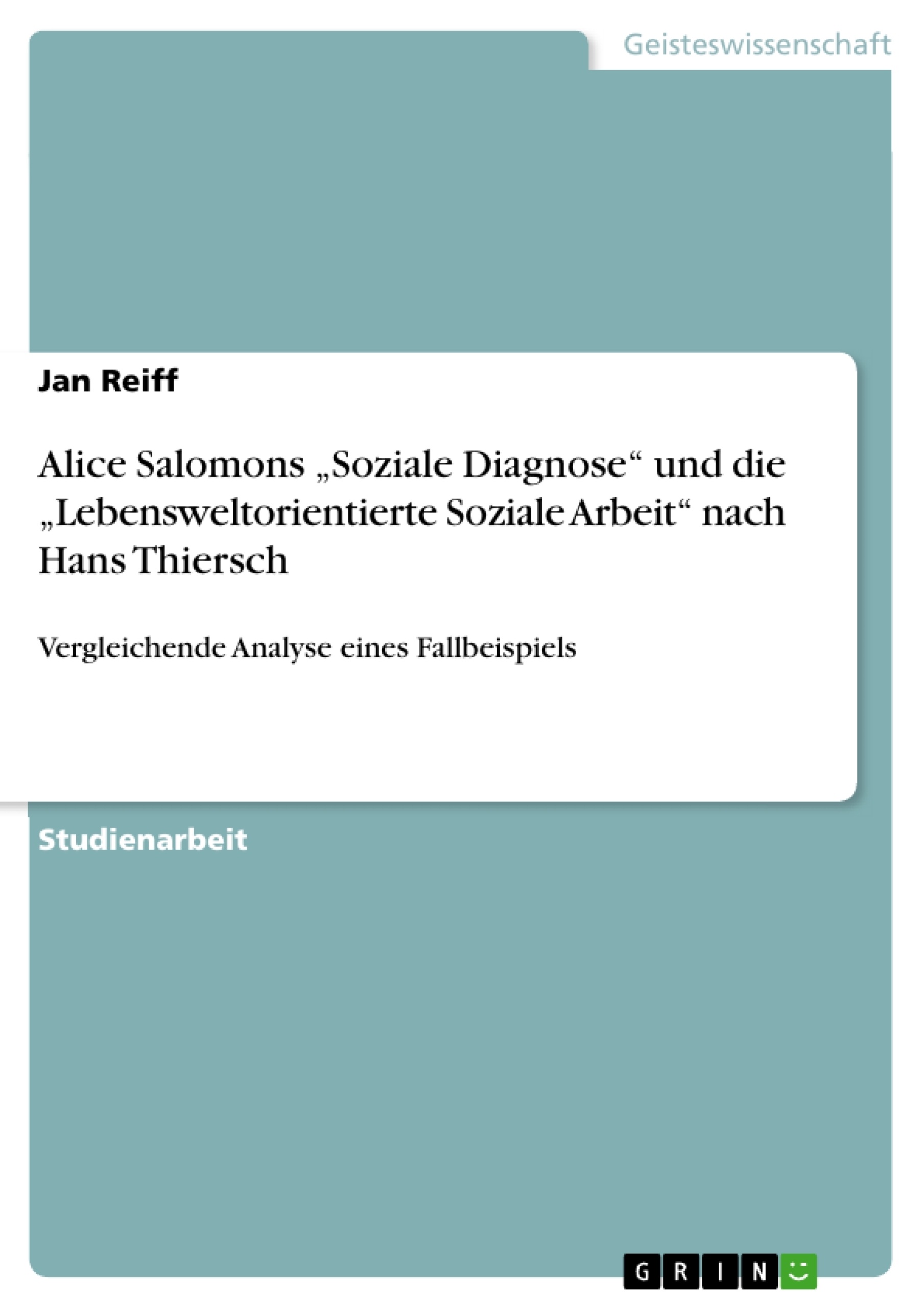In dieser Hausarbeit geht es darum, ein Fallbeispiel mit Hilfe von zwei Theorien der Sozialen Arbeit zu analysieren. Hierfür beschreibe ich zunächst den Fall „Schülerin“, welchen ich dann mit Hilfe der Theorien betrachten werde und die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten beleuchte. Für die Theorie von Alice Salomon und Hans Thiersch habe ich mich entschieden, da sie meiner Meinung nach beides Klassiker der Theorien sind. Besonders die Theorie der Lebensweltorientierung hat mich interessiert, da ich neben dem Studium in einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit beschäftig bin. Dort kommen die Theorien der Lebensweltorientierung häufig zum Einsatz, da sich einige Grundprinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit auf Leitlinien der Lebensweltorientierung berufen.
Ich werde nun zuerst den kurz erwähnten Fall beschreiben. Anschließend folgt die Beschreibung von Alice Salomons Theorie. Diese werde ich danach auf den Fall anwenden. Im Anschluss folgt die Beschreibung von Hans Thierschs Theorie der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit und deren Anwendung auf den Fall. Sowohl bei der Beschreibung, als auch bei der Anwendung der Theorien werde ich mich teilweise auf das Schema von Heiko Kleve berufen. Es wird also zuerst die phänomenale Erkenntnis behandelt, anschließend die kausale und abschließend die aktionale Erkenntnis. Das Schema hilft, um die Theorie, wie auch den Fall zu beschreiben, zu erklären und eine anschließende Handlung möglich zu machen. Als Letztes werde ich zu den Gemeinsamkeiten der Theorien kommen, ebenso wie zu den Unterschieden. Ebenfalls werde ich feststellen, ob und in wie fern sich die Theorien anwenden lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fallbeispiel „Schülerin“
- Theorieerläuterung von Alice Salomon
- Anwendung der Theorie von Alice Salomon
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch
- Anwendung der Theorie von Hans Thiersch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, ein Fallbeispiel mit Hilfe von zwei Theorien der Sozialen Arbeit zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten, die sich aus den Theorien von Alice Salomon und Hans Thiersch ergeben.
- Analyse eines Fallbeispiels aus der Sozialen Arbeit
- Anwendung der Theorie von Alice Salomon auf das Fallbeispiel
- Anwendung der Theorie der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch auf das Fallbeispiel
- Vergleich der beiden Theorien in Bezug auf das Fallbeispiel
- Bewertung der Anwendbarkeit der Theorien in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit dar.
Fallbeispiel „Schülerin“
Dieses Kapitel beschreibt den Fall einer 15-jährigen Schülerin, die aufgrund von familiären Problemen in eine schwierige Situation gerät.
Theorieerläuterung von Alice Salomon
Dieses Kapitel erläutert die Theorie „Soziale Diagnose“ von Alice Salomon. Die Theorie unterteilt die Überlegungen in drei Abschnitte: die Kunst „zu leben“, die Kunst „zu helfen“ und die „Funktion des Helfens“.
Anwendung der Theorie von Alice Salomon
Dieses Kapitel analysiert den Fall „Schülerin“ anhand der Theorie von Alice Salomon und zeigt mögliche Handlungsansätze auf.
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch
Dieses Kapitel beschreibt die Theorie der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Themenfeld der Sozialen Arbeit und analysiert ein Fallbeispiel anhand der Theorien von Alice Salomon und Hans Thiersch. Zentrale Begriffe sind: Soziale Diagnose, Lebensweltorientierung, Fallarbeit, Handlungsmöglichkeiten, Hilfe zur Selbsthilfe.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "Sozialer Diagnose" nach Alice Salomon?
Alice Salomons Theorie umfasst die Kunst des Helfens durch eine systematische Analyse der Lebensumstände, unterteilt in phänomenale, kausale und aktionale Erkenntnis.
Was ist die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch?
Dieser Ansatz stellt den Alltag und die konkreten Lebensverhältnisse der Klienten in den Mittelpunkt. Ziel ist es, die Selbsthilfekräfte der Menschen in ihrer spezifischen Umwelt zu stärken.
Wie unterscheiden sich die Ansätze von Salomon und Thiersch in der Praxis?
Während Salomon stärker auf die methodische Diagnose und die Strukturierung der Hilfe fokussiert, betont Thiersch die Alltagsnähe und die Orientierung an den unmittelbaren Bedürfnissen der Lebenswelt.
In welchen Bereichen wird die Lebensweltorientierung häufig eingesetzt?
Besonders in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind die Leitlinien der Lebensweltorientierung ein fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit.
Was ist das Ziel der Fallanalyse in dieser Arbeit?
Am Beispiel einer Schülerin wird gezeigt, wie unterschiedliche theoretische Ansätze zu verschiedenen Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven in der Sozialen Arbeit führen können.
- Arbeit zitieren
- Jan Reiff (Autor:in), 2016, Alice Salomons „Soziale Diagnose“ und die „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ nach Hans Thiersch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336458