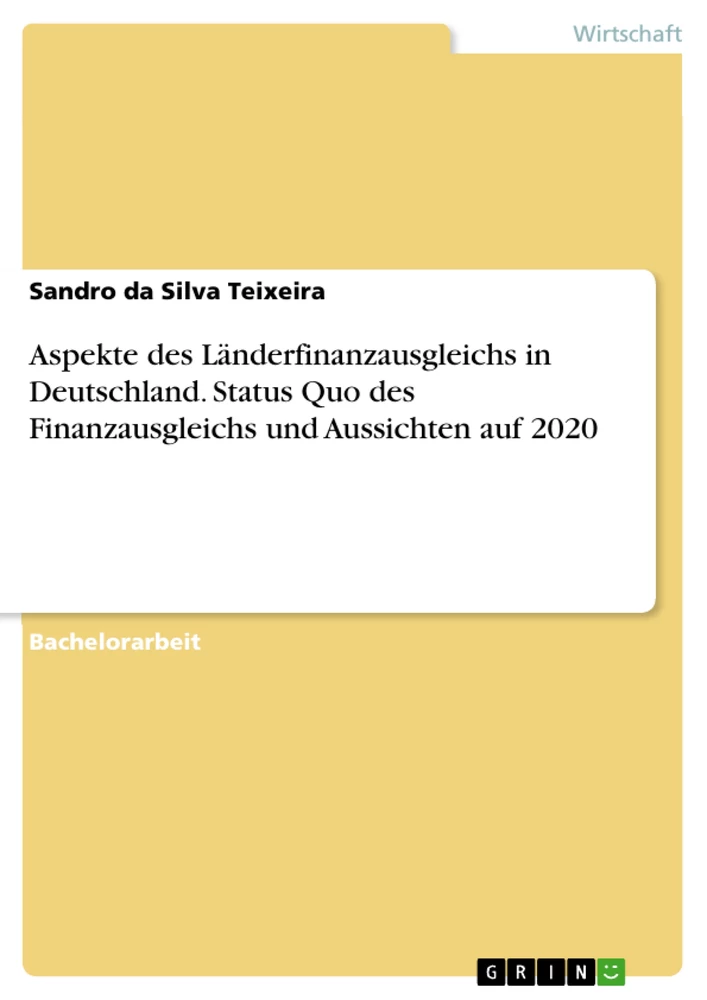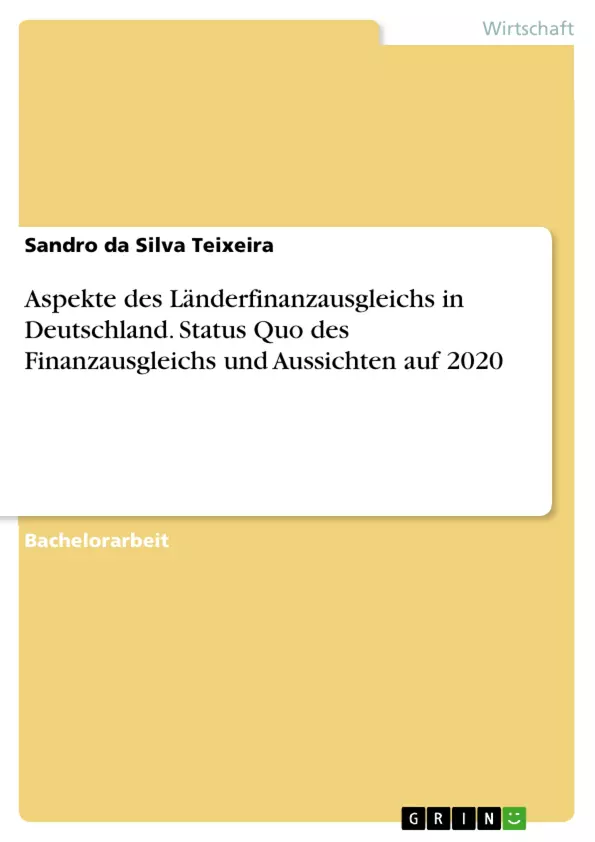Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist eine analytisch-deskriptive Anschauung des Länderfinanzausgleichs wie er derzeit besteht. Aus der kritischen Analyse soll eine Reform hervor gehen, die gemeinnützig, produktiv und umsetzbar ist. Des Weiteren soll eine Reform für das Jahr 2020 für alle Beteiligten möglichst zufriedenstellend sein. Fraglich ist ob sie vertretbar ist aber auch die gewünschten Ergebnisse liefert, oder liefern kann.
Um eine geeignete Reform zu präsentieren wird zunächst die aktuelle Gesetzgebung dargestellt, anschließend die Wirkung und Ziele des LFA erläutert. Folglich wird der LFA beschrieben wie er derzeit besteht und welche ökonomischen Anreize er schafft. Da es Sinngemäß in dieser Arbeit darum geht eine geeignete Reform zu präsentieren wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit nicht die Probleme des Finanzausgleichs bis ins kleinste Detail diskutiert werden. Viel mehr werden Lösungsvorschläge gesucht wie man eine Verbesserung für alle Beteiligten herbeiführen kann. Worum geht es in dieser Arbeit konkret? Nach der Föderalismuskommission II sollte die Föderalismuskommission III kommen, um den zukünftigen Herausforderungen im Föderalismus gewachsen zu sein.
Die politischen Diskussionen darüber fanden ab circa 2012 statt, allerdings nahm der Koalitionsvertrag der Regierung von 2013 diesbezüglich keine Stellung. Das Kernproblem der öffentlichen Finanzen ist, dass sämtliche Finanzbeziehungen zw. Bund, Ländern und Gemeinden mit Auslaufen des Solidarpakts II zum 31.12.2019 enden. Mit Auslaufen des Solidarpakts II sollte die deutsche Einheit wirtschaftlich geeint sein. Auch wenn die deutsche Einheit kulturell und sozial weitgehend verwachsen ist, zeigt sich in den öffentlichen Gebietskörperschaften noch eine weite Spreizung zw. West und Ost. Die Vielfalt und Einigkeit lässt sich nicht mehr in der Ausprägung Ost und West unterscheiden.
Zu den strukturellen Finanzunterschieden kommen noch hinzu, dass die Länder (alle BL) ab dem 01.01.2020 ausgeglichene Haushalte vorweisen müssen. Während sich die Länder und Gemeinden immer größeren Aufgaben stellen müssen wie: demografischer Wandel, marode Infrastrukturen, Urbanisierung, wachsenden Versorgungslasten und durch Kriege und Verfolgung ausgelöste Völkerwanderungen. Demnach ist der Aufgabenkatalog prall gefüllt, die derzeitige föderale Finanzpolitik aber nicht flexibel genug, um diese Aufgaben zukünftig und langfristig zu stemmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Föderalismus
- 3 Die Finanzverfassung und ihre gesetzliche Ordnung
- 3.1 Die Finanzverfassung
- 3.2 Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
- 3.3 Raumordnungsgesetz
- 3.4 Solidarpakt II
- 3.5 Maßstäbegesetz
- 3.6 Das Finanzausgleichsgesetz
- 4 Funktionsweise des Finanzausgleichs
- 4.1 Der primäre vertikale Finanzausgleich
- 4.2 Die Umsatzsteuerverteilung
- 4.3 Der primäre horizontale Finanzausgleich
- 4.4 Der sekundäre horizontale Finanzausgleich
- 4.5 Der sekundäre vertikale Finanzausgleich
- 5 Ökonomische Anreizwirkung
- 5.1 Veränderte Einwohnerbewertung
- 5.2 Anreize aus der Tarifformel
- 5.3 Anreize durch unterschiedliche Einnahmen
- 5.4 Verbleibsbeträge bei Steuermehreinnahmen der Länder
- 5.5 Anreize aus dem Prämienmodell
- 6 Ziel und Aufgabe des Finanzausgleichs
- 7 Zwischenfazit und Zusammenfassung
- 8 Anforderungen an den Finanzausgleich
- 8.1 Finanzausgleich unter allokativen Gesichtspunkten
- 8.2 Finanzausgleich unter distributiven Gesichtspunkten
- 8.3 Problemstellung im Länderfinanzausgleich
- 8.3.1 Investitionen
- 8.3.2 Steuerzerlegung
- 9 Optimierung zur effizienten Sanierung des Bund-Länder-Finanzausgleich
- 9.1 Kritische Würdigung des Bund und Ländervorschlags
- 9.1.1 Ländervorschlag vom Dezember 2015
- 9.1.2 Vorschlag des Bundes
- 9.2 Steuerzerlegung und Umsatzsteuerverteilung
- 9.3 Reform der Tarifformel
- 9.4 Anrechnung der Gemeindeeinnahmen
- 9.5 Das Prämienmodell
- 9.6 Änderungen der Bundesergänzungszuweisungen
- 9.7 Sonderbedarfe
- 9.8 Geldleistungsgesetze
- 9.9 Einwohnerwertung
- 9.10 Neugliederung als Perspektive
- 9.1 Kritische Würdigung des Bund und Ländervorschlags
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema des Finanzausgleichs in Deutschland und untersucht die verschiedenen Aspekte und Funktionsweisen dieses komplexen Systems.
- Föderale Strukturen und ihre finanzielle Umsetzung
- Die gesetzliche Ordnung und Gestaltung des Finanzausgleichs
- Die Funktionsweise des Finanzausgleichs und seine verschiedenen Ebenen
- Die ökonomischen Anreize und Wirkungen des Finanzausgleichs
- Die Herausforderungen und Optimierungsmöglichkeiten des Finanzausgleichs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Finanzausgleichs ein und erläutert die Bedeutung des Föderalismus in Deutschland. Das zweite Kapitel behandelt die Finanzverfassung und die zugrunde liegenden Gesetze, wie das Grundgesetz, das Raumordnungsgesetz, den Solidarpakt II und das Finanzausgleichsgesetz. Anschließend werden die verschiedenen Ebenen des Finanzausgleichs im dritten Kapitel detailliert beschrieben. Im vierten Kapitel wird die ökonomische Anreizwirkung des Finanzausgleichs analysiert. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Zielen und Aufgaben des Finanzausgleichs. Das sechste Kapitel gibt einen Zwischenfazit und fasst die wichtigsten Punkte zusammen. Das siebte Kapitel untersucht die Anforderungen an einen effizienten Finanzausgleich. Im achten Kapitel werden die Herausforderungen und Probleme im Länderfinanzausgleich diskutiert. Abschließend werden im neunten Kapitel verschiedene Reformvorschläge zur Optimierung des Finanzausgleichs präsentiert.
Schlüsselwörter
Finanzausgleich, Föderalismus, Finanzverfassung, Grundgesetz, Solidarpakt, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Steuerzerlegung, Umsatzsteuerverteilung, Anreizwirkung, Reformvorschläge.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Länderfinanzausgleichs (LFA)?
Ziel ist es, die Finanzkraftunterschiede zwischen den Bundesländern abzumildern, damit alle Länder ihre verfassungsrechtlichen Aufgaben erfüllen können.
Was änderte sich im Jahr 2020 beim Finanzausgleich?
Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II und der Neuregelung der Finanzbeziehungen wurde das System grundlegend reformiert, um den Herausforderungen wie der Schuldenbremse gerecht zu werden.
Was sind Bundesergänzungszuweisungen?
Zahlungen des Bundes an finanzschwache Länder, um verbleibende Lücken nach dem horizontalen Ausgleich zwischen den Ländern zu schließen.
Welche ökonomischen Fehlanreize werden im LFA kritisiert?
Kritisiert wird oft, dass Länder wenig Anreiz haben, eigene Steuereinnahmen zu erhöhen, da diese zu einem Großteil wieder "weggeschmolzen" werden.
Was bedeutet "Steuerzerlegung"?
Das Verfahren, nach dem Steuereinnahmen (z.B. Körperschaftsteuer) auf die Bundesländer verteilt werden, in denen die wirtschaftliche Leistung tatsächlich erbracht wurde.
Welche Rolle spielt die Einwohnerwertung?
Einwohnerzahlen werden im Finanzausgleich gewichtet (z.B. Stadtstaaten-Bonus), was oft zu politischen Diskussionen über die Gerechtigkeit der Verteilung führt.
- Arbeit zitieren
- Sandro da Silva Teixeira (Autor:in), 2016, Aspekte des Länderfinanzausgleichs in Deutschland. Status Quo des Finanzausgleichs und Aussichten auf 2020, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336461