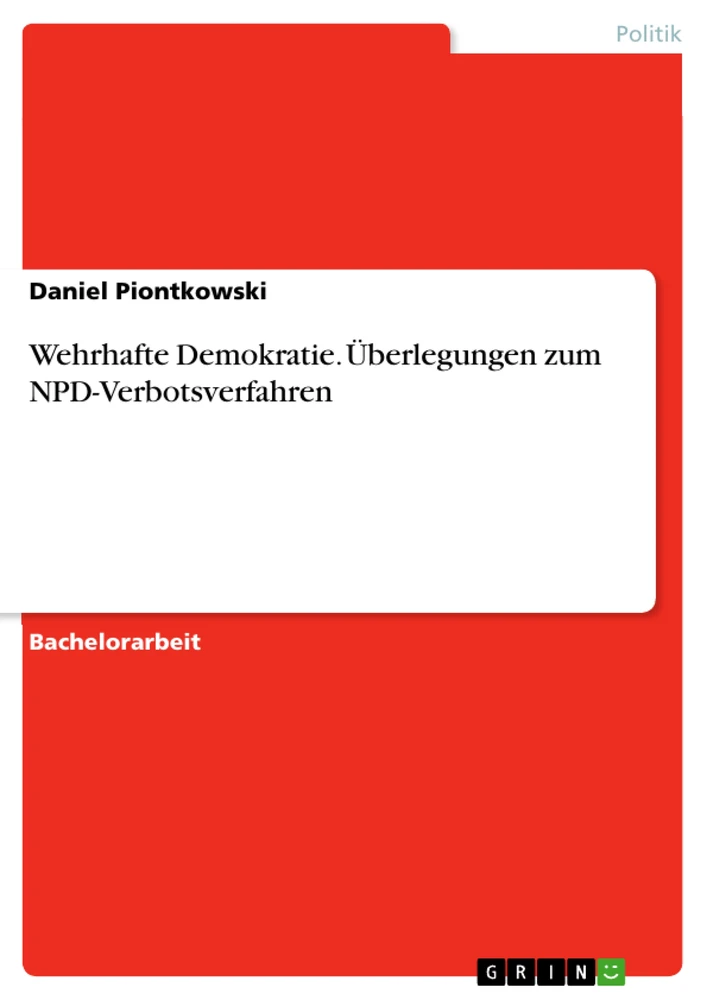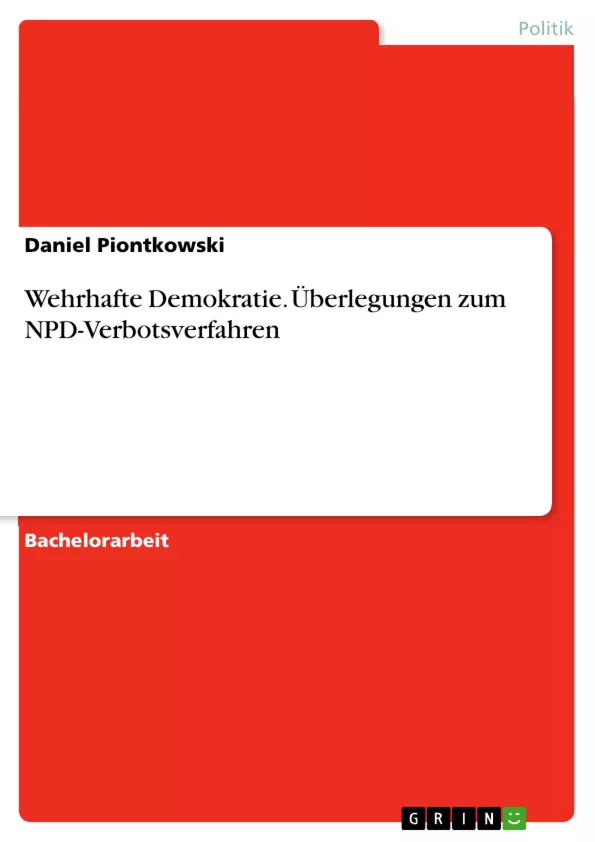Die folgende Bachelorarbeit beschäftigt sich im Kern mit dem Prinzip der wehrhaften Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Zunächst werden die beiden Kernbegriffe „wehrhafte Demokratie“ und „freiheitlich demokratische Grundordnung“ definiert. Danach wird kurz die aktuelle Situation des Rechtsextremismus in Deutschland geschildert, wobei die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) und die daraus resultierende Forderung nach einem erneuten Verbotsverfahren gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) im Fokus steht.
Anschließend erfolgt der Versuch den Begriff Rechtsextremismus näher zu definieren. Im Hauptteil der Ausarbeitung, Kapitel 2, soll zuerst anhand der Geschichte der Weimarer Republik gezeigt werden, warum in der Bundesrepublik das Konzept der „wehrhaften Demokratie“ etabliert wurde. Das Hauptaugenmerk ist dabei auf den Parteiverbotsartikel Art. 21 Abs. 2 gerichtet. Anschließend wird das Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) näher betrachtet und die Begründung des Gerichts dargelegt. Im abschließenden Kapitel geht es darum Argumente aufzuzeigen, welche für ein Verbotsverfahren gegen die NPD sprechen und welche dagegen.
Inhaltsverzeichnis
- Erhöhtes Gefahrenpotential für die Demokratie?
- Die neu aufgeflammte Diskussion um Rechtsextremismus...
- Ausreichender Staatsschutz? Ursprung und Theorie der „wehrhaften Demokratie“
- Unvollendete Demokratie?
- Die Weimarer Republik und ihre Verfassung...
- Aus Weimar gelernt?
- Die ,,wehrhafte Demokratie“ im Grundgesetz.
- Die KPD als gewaltloser Verfassungsfeind?
- Das Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts...
- Jetzt oder nie?
- Gespaltene Meinung um den Nutzen eines NPD – Verbots..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, das Prinzip der „wehrhaften Demokratie“ im Kontext des NPD-Verbotsverfahrens zu analysieren. Dabei soll die aktuelle Debatte um ein erneutes Verbot der NPD im Lichte des NSU-Skandals beleuchtet werden. Die Arbeit beleuchtet außerdem die historische Entwicklung der „wehrhaften Demokratie“ und ihre Verankerung im Grundgesetz.
- Das Gefahrenpotential von Rechtsextremismus für die Demokratie
- Die „wehrhafte Demokratie“ als Konzept im Grundgesetz
- Die Geschichte der „wehrhaften Demokratie“ und der Weimarer Republik
- Die Argumentationslinie des Bundesverfassungsgerichts im KPD-Urteil
- Pro und Contra eines NPD-Verbots im Lichte der aktuellen Debatte
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Debatte um Rechtsextremismus und ein NPD-Verbotsverfahren im Kontext der NSU-Morde und der vermuteten Verbindungen zwischen der NPD und der Terrorzelle.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert das Konzept der „wehrhaften Demokratie“ im Grundgesetz und betrachtet die historischen Erfahrungen der Weimarer Republik und deren Auswirkungen auf die deutsche Verfassung.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel untersucht das Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die KPD und analysiert die Argumentationslinie des Gerichts im Kontext der „wehrhaften Demokratie“.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Debatte um ein NPD-Verbotsverfahren und präsentiert Argumente sowohl für als auch gegen ein Verbot der NPD.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: „wehrhafte Demokratie“, Rechtsextremismus, NPD, Verbotsverfahren, NSU, Grundgesetz, Weimarer Republik, KPD, Bundesverfassungsgericht, Freiheitliche demokratische Grundordnung (fdGO).
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "wehrhafte Demokratie"?
Das Prinzip besagt, dass die Demokratie sich aktiv gegen ihre Feinde verteidigen darf und muss, um einen Missbrauch demokratischer Freiheiten zur Abschaffung der Ordnung zu verhindern.
Warum wurde das Konzept der wehrhaften Demokratie in das Grundgesetz aufgenommen?
Es war eine Reaktion auf das Scheitern der Weimarer Republik, deren Verfassung keine ausreichenden Mittel gegen antidemokratische Kräfte bot.
Was regelt Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes?
Dieser Artikel ermöglicht das Verbot von Parteien, die die freiheitlich demokratische Grundordnung (fdGO) beeinträchtigen oder abschaffen wollen.
Was war die Begründung für das KPD-Verbot?
Das Bundesverfassungsgericht stufte die KPD als verfassungsfeindlich ein, da ihre Ziele mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung unvereinbar waren.
Welche Rolle spielten die NSU-Morde für die Debatte um ein NPD-Verbot?
Die Entdeckung der NSU-Terrorzelle entfachte die Diskussion neu, da Verbindungen zwischen rechtsextremen Strukturen und der Partei vermutet wurden.
- Quote paper
- Daniel Piontkowski (Author), 2012, Wehrhafte Demokratie. Überlegungen zum NPD-Verbotsverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336605