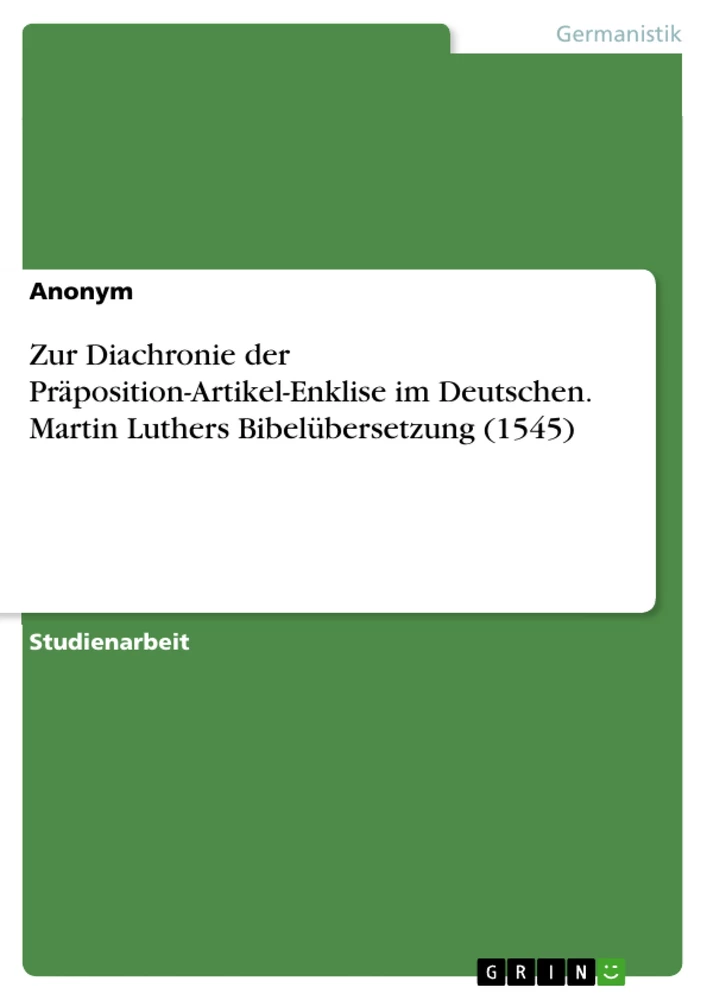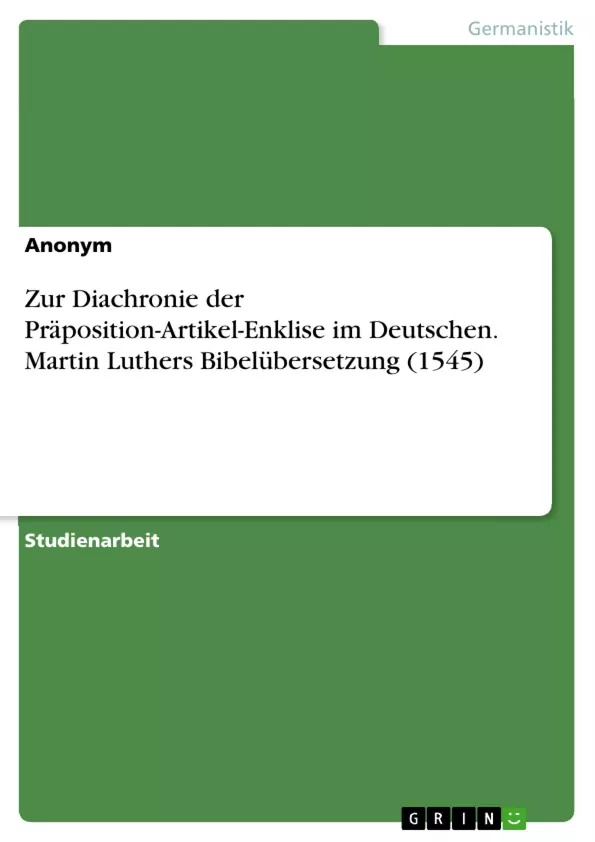Die Präposition-Artikel-Enklise ist Teil des Grammatikalisierungsprozesses. Das Phänomen der Klitisierung beschreibt die Verschmelzung zweier angrenzender Ausdrücke. Die Klise ist eine Besonderheit in der Sprachwissenschaft, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts näher erforscht wurde.
In dieser Arbeit soll nicht nur das Gebilde Klise näher erläutert und ihr Prozess anschaulich dargestellt, sondern auch an Beispielen festgemacht werden. Hier bietet sich ein Blick auf die Diachronie an. Während die Verschmelzung im Alt- und Mittelhochdeutschen bereits angedeutet aber nicht Regeln folgend vorkommt, wird eine regelmäßige Klitisierung verschiedener Formen im Neuhochdeutschen offenkundig. Dargestellt werden soll der Stand der Klise in dieser Zeit anhand von Beispielen aus Luthers Bibelübersetzung. Grundlage dieser Abhandlung sind Untersuchungen von NÜBLING (1992, 1998, 2002 u. 2005), CHRISTIANSEN (2012) und besonders die erstmalige Beschäftigung mit Klitika im LUTHER-Deutschen (1545) von STEFFENS (2010 u. 2012).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Prozess der Präposition-Artikel-Enklise
- 2.1 Präposition und Artikel
- 2.2 Fördernde Faktoren
- 2.3 Hemmende Faktoren
- 2.4 Vorkommen
- 3. Diachronie
- 3.1 Althochdeutsch
- 3.2 Mittelhochdeutsch
- 3.3 Frühneuhochdeutsch und Luther
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prozess der Präposition-Artikel-Enklise im Deutschen, ein Grammatikalisierungsphänomen, bei dem sich Präpositionen und Artikel verschmelzen. Die Zielsetzung besteht darin, diesen Prozess zu erläutern, anhand von Beispielen zu veranschaulichen und seine diachrone Entwicklung nachzuvollziehen.
- Der Prozess der Klitisierung und seine Ausdrucksverfahren
- Die Rolle der Frequenz und der Grammatikalisierung
- Die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Präpositionen
- Der Einfluss phonologischer Faktoren auf die Enklise
- Die diachrone Entwicklung der Präposition-Artikel-Enklise im Deutschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Präposition-Artikel-Enklise als Teil des Grammatikalisierungsprozesses ein. Sie definiert den Begriff der Klitisierung als Verschmelzung zweier Ausdrücke und benennt wichtige Forschungsarbeiten zum Thema, insbesondere die Untersuchungen von Nübling, Christiansen und Steffens zu Klitika im Luther-Deutschen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, den Prozess der Enklise zu erläutern und anhand von Beispielen aus der Diachronie zu veranschaulichen, mit besonderem Fokus auf die Entwicklung im Neuhochdeutschen.
2. Prozess der Präposition-Artikel-Enklise: Dieses Kapitel analysiert den Prozess der Präposition-Artikel-Enklise detailliert. Es beginnt mit einem Exkurs zu den Ausdrucksverfahren nach Bybee, die eine Skala von lexikalischen bis zu syntaktischen Ausdrucksweisen aufzeigt und den Grad der Fusion und Frequenz beschreibt. Der Fokus liegt auf der klitischen Kategorie, bei der ursprünglich getrennte Einheiten (z.B. "an dem") zu einer verschmolzenen Form (z.B. "am") werden. Das Kapitel unterscheidet zwischen Proklise und Enklise und erläutert die verschiedenen Grade der Klitisierung (Allegroverschmelzung, einfache Klise, spezielle Klise) anhand von Beispielen und einem Schaubild. Es wird die zunehmende Grammatikalisierung der Klisen im Laufe des Sprachwandels hervorgehoben und die Herausforderungen bei der eindeutigen Zuordnung von Klitika zu bestimmten Gruppen diskutiert.
2.1 Präposition und Artikel: Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die spezifischen Eigenschaften der beteiligten Elemente: die Präpositionen und die definiten Artikel. Es unterscheidet zwischen primären und sekundären Präpositionen, wobei die primären (z.B. "in", "an", "auf") aufgrund ihrer hohen Frequenz und ihres Alters eine deutlich größere Rolle bei der Klitisierung spielen. Der Begriff der Kasusrektion wird eingeführt, und der Einfluss der Kasusfrequenz (Dativ, Akkusativ) auf die Verschmelzungshäufigkeit der definiten Artikel wird untersucht. Anhand von Daten zu den häufigsten Präposition-Artikel-Enklitika wird die Bedeutung des Dativs und die höhere Enklise-Frequenz bei Singular-Artikeln gegenüber Plural-Artikeln hervorgehoben.
2.2 Fördernde Faktoren: Dieses Kapitel erläutert die Bedingungen, die die Präposition-Artikel-Enklise begünstigen. Eine hohe Tokenfrequenz von Präposition und Artikel ist ein entscheidender Faktor. Die phonologische Struktur spielt ebenfalls eine Rolle, insbesondere die Sonorität des Auslauts der Präposition. Die hohen Frequenzen der ersten sieben Verschmelzungsformen mit sonoren Ausgängen werden als Beleg angeführt. Die Kookkurrenzfrequenz zwischen Präposition und Artikel wird als weiterer wichtiger Faktor für die Entstehung der Enklise identifiziert.
Schlüsselwörter
Präposition-Artikel-Enklise, Klitisierung, Grammatikalisierung, Diachronie, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Lutherdeutsch, Frequenz, Phonologie, Kasusrektion, Primäre Präpositionen, Sekundäre Präpositionen, Bybee, Nübling, Christiansen, Steffens, COSMAS II.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Präposition-Artikel-Enklise im Deutschen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Prozess der Präposition-Artikel-Enklise im Deutschen, ein Grammatikalisierungsphänomen, bei dem sich Präpositionen und Artikel verschmelzen. Sie beleuchtet diesen Prozess, veranschaulicht ihn anhand von Beispielen und verfolgt seine diachrone Entwicklung.
Welche Aspekte werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Klitisierung und deren Ausdrucksverfahren, die Rolle von Frequenz und Grammatikalisierung, die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Präpositionen, den Einfluss phonologischer Faktoren und die diachrone Entwicklung der Präposition-Artikel-Enklise im Deutschen (Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch und Lutherdeutsch).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Prozess der Präposition-Artikel-Enklise (mit Unterkapiteln zu Präposition und Artikel, fördernden und hemmenden Faktoren sowie Vorkommen), Diachronie und Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein, definiert Klitisierung und benennt relevante Forschungsarbeiten. Kapitel 2 analysiert den Enkliseprozess detailliert, Kapitel 3 beleuchtet die diachrone Entwicklung und das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Faktoren fördern die Präposition-Artikel-Enklise?
Die hohe Tokenfrequenz von Präposition und Artikel ist ein entscheidender Faktor. Die phonologische Struktur, insbesondere die Sonorität des Präpositionsauslauts, spielt ebenfalls eine Rolle. Die Kookkurrenzfrequenz zwischen Präposition und Artikel ist ebenfalls wichtig.
Welche Rolle spielen primäre und sekundäre Präpositionen?
Primäre Präpositionen (z.B. "in", "an", "auf") spielen aufgrund ihrer hohen Frequenz und ihres Alters eine größere Rolle bei der Klitisierung als sekundäre Präpositionen.
Welche Bedeutung hat der Kasus?
Der Kasus (Dativ, Akkusativ) beeinflusst die Verschmelzungshäufigkeit der definiten Artikel. Der Dativ zeigt eine höhere Enklise-Frequenz, und Singular-Artikel weisen eine höhere Enklise-Frequenz auf als Plural-Artikel.
Welche Forschungsarbeiten werden erwähnt?
Die Arbeit bezieht sich auf wichtige Forschungsarbeiten von Nübling, Christiansen und Steffens zu Klitika im Luther-Deutschen sowie auf die Arbeit von Bybee zu Ausdrucksverfahren der Grammatikalisierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Präposition-Artikel-Enklise, Klitisierung, Grammatikalisierung, Diachronie, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Lutherdeutsch, Frequenz, Phonologie, Kasusrektion, Primäre Präpositionen, Sekundäre Präpositionen, Bybee, Nübling, Christiansen, Steffens, COSMAS II.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Zur Diachronie der Präposition-Artikel-Enklise im Deutschen. Martin Luthers Bibelübersetzung (1545), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336618