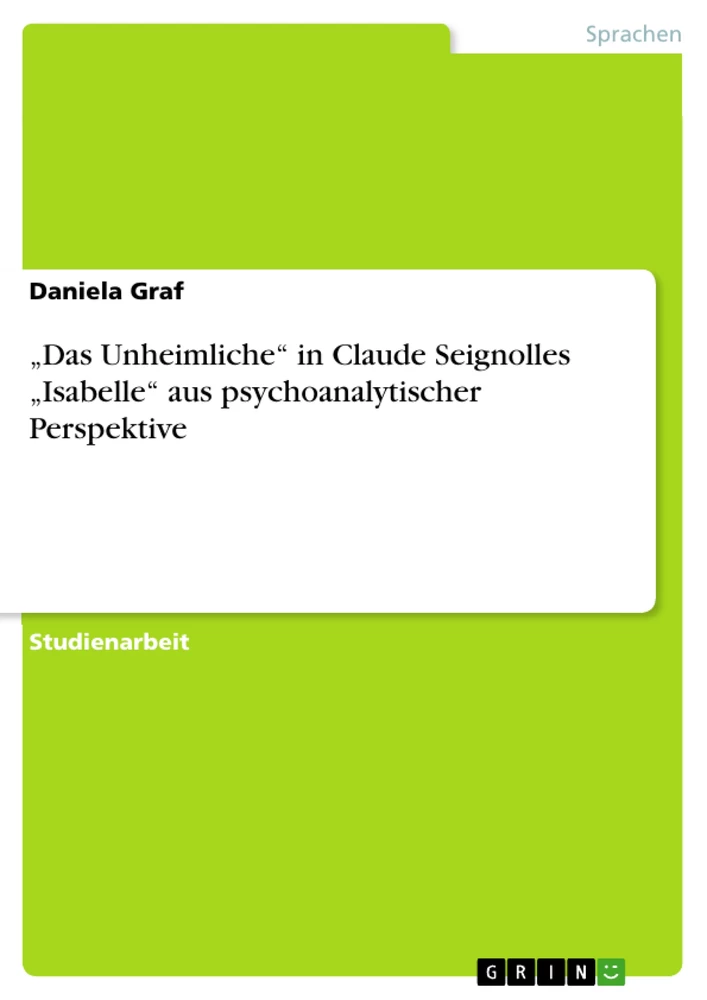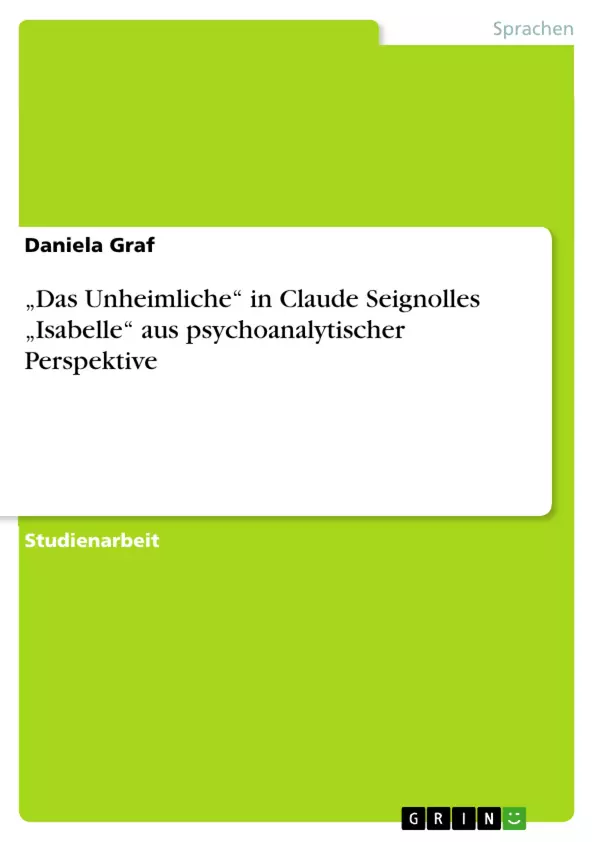Beim Lesen eines Schauerromans, löst dieser beim Rezipienten, wie der Name schon sagt, ein „schauriges“ Gefühl aus, vielleicht verspürt er sogar Angst, fühlt sich beklemmt, beobachtet, kurz: es ist unheimlich. Womöglich sind es nur Kleinigkeiten, eine minimal vom Alltag abweichende Situation, eine unerwartete Wende, unnatürliche Lichtverhältnisse, uvm. Was jedoch genau das unheimliche Gefühl in uns auslöst ist schwer zu sagen. Im Hinblick auf das Eingangszitat ist das Umheimliche vielleicht das „bisher Übersehene“, das es in dieser Hausarbeit zu untersuchen gilt, und als das „nun Dazugekommene“ bezeichnet werden darf. Ob es nun „gerade das Wesentliche“ ist, möchte ich anhand der Psychoanalyse Sigmund Freuds versuchen zu beantworten.
Sigmund Freud (1856-1939), Begründer der Psychoanalyse, schlug zunächst in Wien eine naturwissenschaftliche und anschließend medizinische Laufbahn ein, praktizierte als Arzt und Seelenforscher, löste mit seinen Entdeckungen einen Skandal aus, indem er unter anderem auch als „einer der großen europäischen Schriftsteller hervor[trat]“ Im Wesentlichen wird im Rahmen dieser Hausarbeit nicht auf Freuds Biographie eingegangen, sondern vielmehr ein kurzer
Umriss seiner Erkenntnisse der Psychoanalyse dargestellt und vor allem auf sein Essay „Das Unheimliche“ eingegangen. Wie wird der Begriff „unheimlich“ definiert und wie kann dieses
Gefühl erzeugt werden?
Im Anschluss möchte ich anhand Claude Seignolles „Isabelle“ zeigen, mit welchen Werkzeugen der Autor arbeitet, um seine Novelle für den Leser unheimlich wirken zu lassen. „Isabelle“ gehört zur Gattung der Gothic Novel, die sich durch Elemente wie Nacht, Dunkelheit, übernatürliche Gestalten (Isabelle), Einsamkeit, Isolation des Protagonisten (Graf), u.a. auszeichnet. Untrennbar davon ist das Moment des Unheimlichen.
Im zweiten Teil werde ich „Isabelle“ unter psychoanalytischer Perspektive beleuchten und interpretieren, besonders im Hinblick auf die Charakterzüge der Hauptfiguren. Welche Ängste äußern sich beim Grafen und können psychische Störungen ausgemacht werden? Wie werden Jasmine, sein Dienstmädchen und Isabelle dargestellt? In welchen Punkten ähneln sie sich, kann von einem Doppelgängertum gesprochen werden? Am Ende wird sich zeigen ob die Methode der psychoanalytischen Lesart zum Verständnis des Unheimlichen in der Lektüre beigetragen hat und ich möchte kurz auf die Frage eingehen, wieviel Autor steckt in der Geschichte?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das unheimliche Gefühl unter psychoanalytischer Lupe
- Sigmund Freuds Psychoanalyse und „Das Unheimliche“
- Elemente des Unheimlichen in Claude Seignolles „Isabelle“
- Psychoanalytische Interpretation unter dem Aspekt des Unheimlichen
- Analyse des Grafen
- Doppelgängertum Isabelle – Jasmine
- Schluss (Fazit)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Analyse des unheimlichen Gefühls in Claude Seignolles „Isabelle“ aus psychoanalytischer Perspektive. Dabei wird insbesondere auf die Theorien Sigmund Freuds eingegangen, um die Entstehung und Wirkung des Unheimlichen zu verstehen.
- Die Bedeutung des Unheimlichen in der Literatur
- Die psychoanalytische Interpretation von „Isabelle“
- Die Rolle von Angst und unbewussten Trieben in der Geschichte
- Die Analyse der Figuren des Grafen, Isabelle und Jasmine
- Das Konzept des Doppelgängertums
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Relevanz des Unheimlichen in der Literatur.
Das unheimliche Gefühl unter psychoanalytischer Lupe: Dieses Kapitel beleuchtet Freuds Psychoanalyse und die Entstehung des unheimlichen Gefühls. Es werden die wichtigsten Elemente des Unheimlichen in „Isabelle“ dargestellt.
Psychoanalytische Interpretation unter dem Aspekt des Unheimlichen: In diesem Kapitel werden die Hauptfiguren des Grafen, Isabelle und Jasmine psychoanalytisch interpretiert. Es wird untersucht, welche Ängste und psychischen Störungen bei den Figuren auftreten und ob von einem Doppelgängertum gesprochen werden kann.
Schlüsselwörter
Psychoanalyse, Sigmund Freud, Das Unheimliche, Gothic Novel, Claude Seignolles, Isabelle, Graf, Angst, unbewusste Triebe, Doppelgänger, psychische Störungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Sigmund Freud das „Unheimliche“?
Freud definiert das Unheimliche als jene Art des Schreckhaften, die auf das Altbekannte und längst Vertraute zurückgeht, das durch Verdrängung fremd geworden ist.
Welche Elemente machen Claude Seignolles „Isabelle“ unheimlich?
Typische Gothic-Novel-Elemente wie Dunkelheit, Isolation, übernatürliche Gestalten und das Gefühl, beobachtet zu werden, erzeugen die schaurige Atmosphäre.
Was bedeutet das „Doppelgängertum“ in dieser Novelle?
Die Arbeit analysiert die Ähnlichkeiten zwischen den Figuren Isabelle und Jasmine und wie diese Spiegelung zur psychischen Verunsicherung des Grafen beiträgt.
Welche Ängste äußert der Graf aus psychoanalytischer Sicht?
Untersucht werden tiefsitzende Ängste und unbewusste Triebe, die sich in psychischen Störungen und der Wahrnehmung des Übernatürlichen äußern.
Hilft die Psychoanalyse beim Verständnis von Schauerliteratur?
Ja, die psychoanalytische Lesart hilft zu erklären, warum bestimmte literarische Motive universelle menschliche Ängste ansprechen und das Gefühl des Unheimlichen auslösen.
- Quote paper
- Daniela Graf (Author), 2012, „Das Unheimliche“ in Claude Seignolles „Isabelle“ aus psychoanalytischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336742