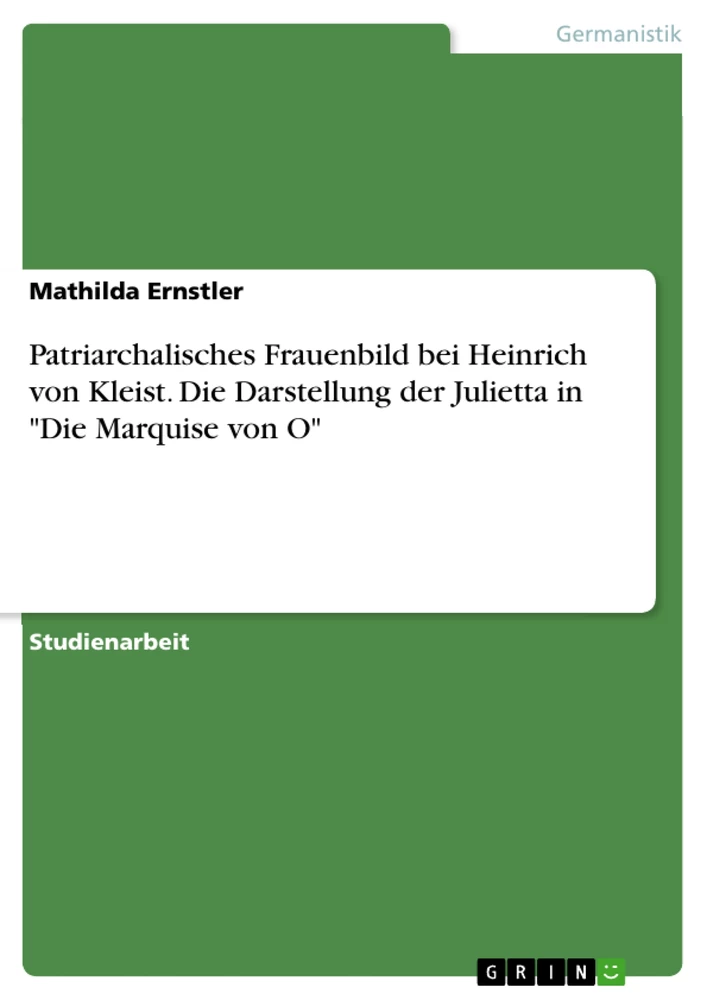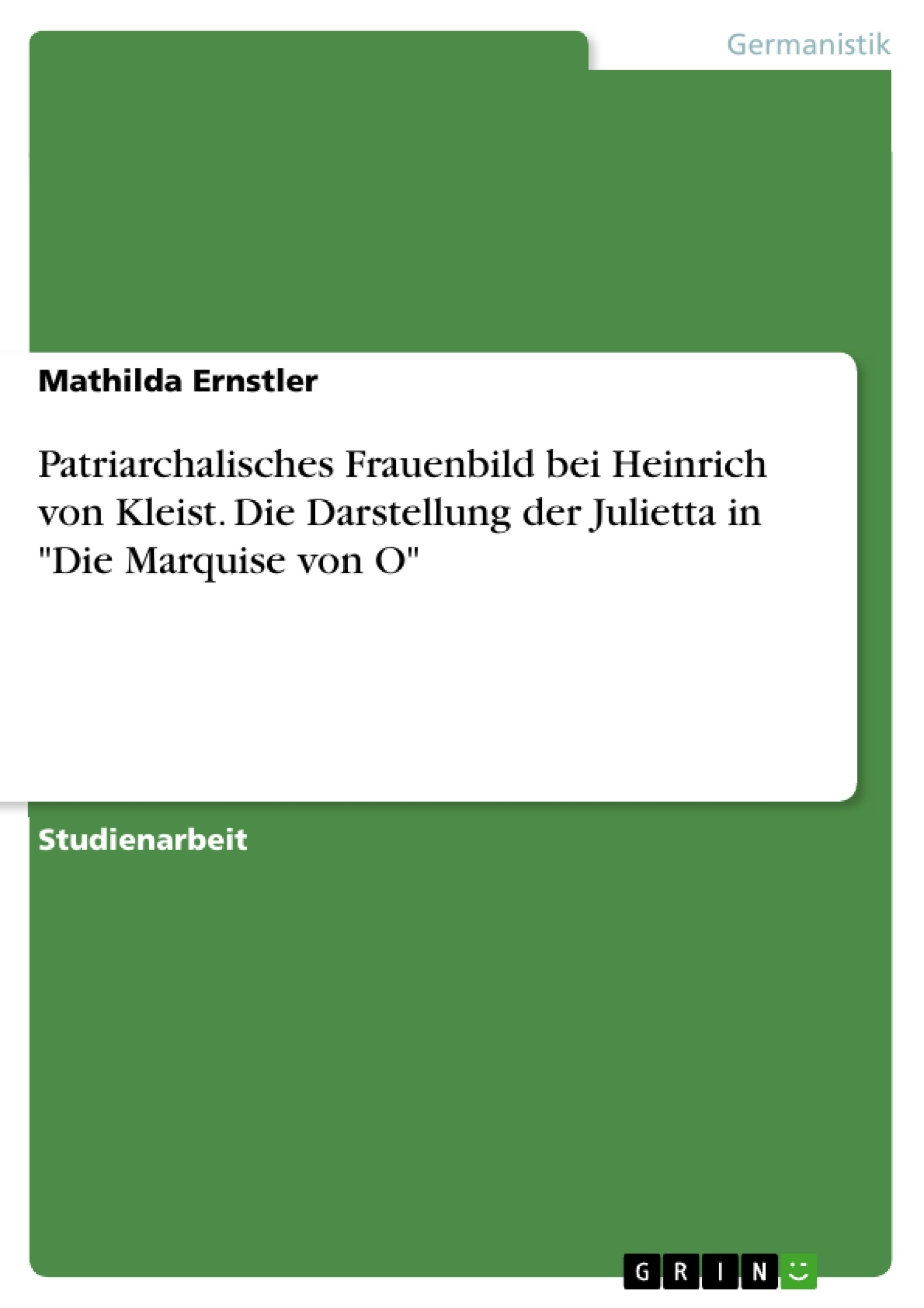Die folgende Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Beispielhaftigkeit Juliettas für das damalige patriarchalische Frauenbild, welches im 18. Jahrhundert vorherrschte. Im Zuge dessen wird die Novelle zunächst in den historischen Kontext eingeordnet, um die damaligen Konventionen, Lebensweisen, Ethik sowie Moral- und Wertvorstellungen besser aufzeigen und verstehen zu können. Daraufhin folgt die Erläuterung der Rolle der Frau im achtzehnten Jahrhundert, die das Patriarchat aufgreift und die Stellung der Frau unter männlicher Autorität behandelt.
Ebenso wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten Frauen als solche zu diesem Zeitpunkt der Geschichte besaßen und wo die vereinzelten Prozesse der Unterdrückung begannen. Darauf aufbauend folgt eine ausführliche Analyse der Julietta als Hauptfigur innerhalb Kleists Erzählung, die sowohl ihren gesellschaftlichen Stand als Witwe, ihre Rolle in der Familie, ihre Funktionalität als Mutter und Tradition und Emanzipation als Motiv des Ausbruchs behandelt. Der Argumentationsgang zur Beantwortung meiner Frage nach der Beispielhaftigkeit Juliettas in Bezug auf das patriarchalische Frauenbild im 18. Jahrhundert ist dabei wie eine Erörterung in Für und Wider gegliedert, die sich weitestgehend chronologisch an der Erzählung orientiert.
Die Marquise von O... wird oftmals als einer der bekanntesten Erzählungen von Heinrich von Kleist bezeichnet. Obgleich die Frage nach dem Bekanntheitsgrad nie eindeutig beantwortet werden kann, ist klar, dass die Erzählung rund um Julietta und ihre unerklärlichen Umstände sich im 19. Jahrhundert als wahres Skandalon herausstellten. Die Thematik rund um unehelichen Verkehr, unerklärbare Schwangerschaften, Vertreibung und Leid bis hin zum Motiv der Vergewaltigung und trotzdem vollzogener Ehe bedient vielerlei Tabus, die in Kleists Erzählung literarisch behandelt werden. So wirft Julietta als Hauptfigur sowohl in Bezug auf ihre Charakterisierung als auch ihre Handlungsmotive im Zeichen von Tradition und Emanzipation viele Fragen auf.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Einordnung des Werkes
- Das Rollenbild der Frau im 18. Jahrhundert
- Analyse der Figur der Marquise von O...
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert die Figur der Marquise von O... in Heinrich von Kleists gleichnamiger Novelle im Kontext des patriarchalischen Frauenbilds des 18. Jahrhunderts. Das Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob Julietta als Beispiel für die damalige Rolle der Frau im Patriarchat angesehen werden kann.
- Einordnung der Novelle in den historischen Kontext des 18. Jahrhunderts
- Analyse des Frauenbilds im 18. Jahrhundert unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen
- Detaillierte Analyse der Figur Julietta im Hinblick auf ihre Rolle in der Gesellschaft, in der Familie und als Mutter
- Untersuchung der Motiv des Ausbruchs aus traditionellem Verhalten und möglicher Emanzipation
- Beurteilung, inwiefern Juliettas Geschichte exemplarisch für die damalige Rolle der Frau im Patriarchat steht
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und gibt einen kurzen Überblick über die Argumentationslinie. Sie behandelt die Bedeutung von Juliettas Geschichte und die relevanten Aspekte, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
Das zweite Kapitel widmet sich der Einordnung der Novelle in den historischen Kontext. Es beleuchtet die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen des 18. Jahrhunderts, die das Werk prägten, und stellt die Bedeutung der Aufklärung, der Koalitionskriege und des Aufstiegs des Bürgertums dar. Die Novelle wird als Angriff auf die damaligen Konventionen und als Werk der Spätaufklärung positioniert.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Rollenbild der Frau im 18. Jahrhundert. Es analysiert die damalige Situation der Frau und die begrenzten Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung standen. Es thematisiert die idealisierten Frauenbilder und die Problematik der Differenzierung zwischen realer und imaginierter Wirklichkeit.
Die Analyse der Figur der Marquise von O... erfolgt im vierten Kapitel. Es untersucht Juliettas gesellschaftlichen Stand als Witwe, ihre Rolle in der Familie und ihre Funktionalität als Mutter. Dabei werden Tradition und Emanzipation als Motive für ihr Handeln betrachtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Heinrich von Kleist, Die Marquise von O..., Frauenbild, Patriarchat, 18. Jahrhundert, Tradition, Emanzipation, Aufklärung, Koalitionskriege, gesellschaftliche Normen, Familienrolle, Mutterrolle, Witwe, Analyse, Literaturwissenschaft.
- Arbeit zitieren
- Mathilda Ernstler (Autor:in), 2016, Patriarchalisches Frauenbild bei Heinrich von Kleist. Die Darstellung der Julietta in "Die Marquise von O", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336782