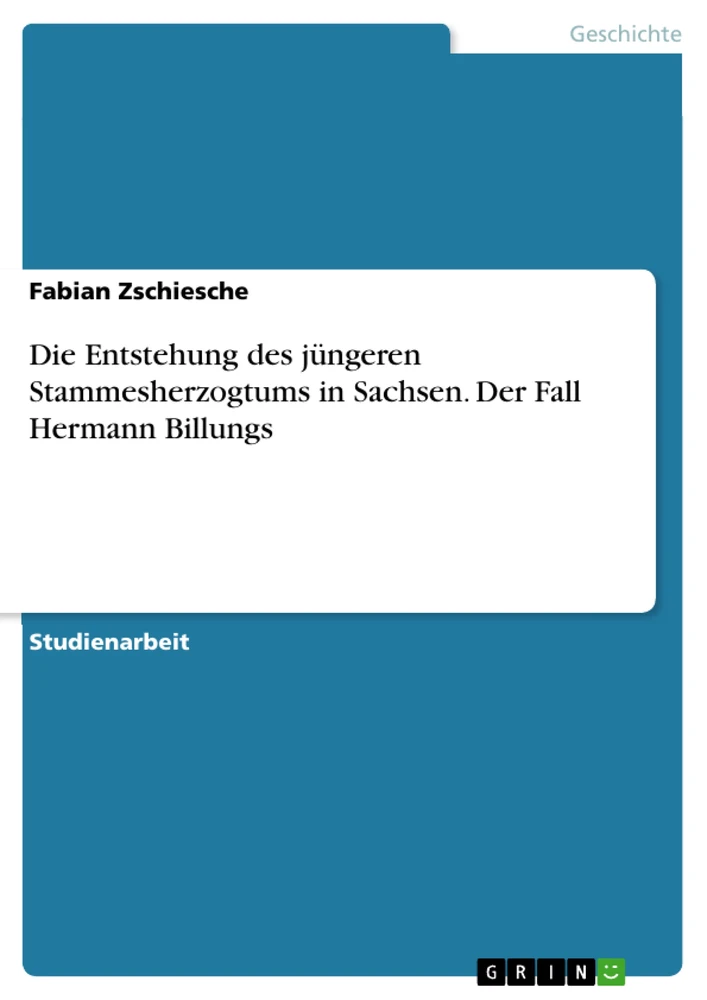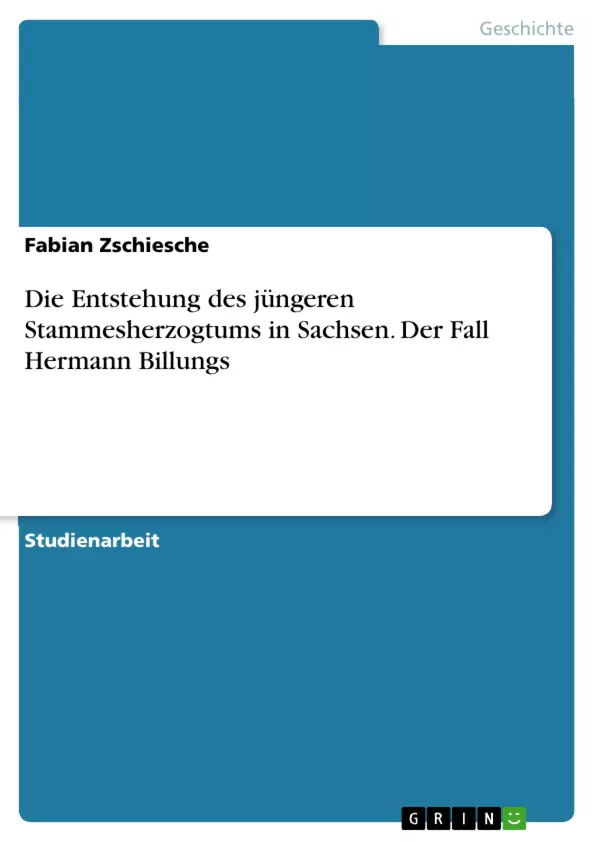Wenn man über das Herzogtum Sachsen aus dem 9. und 10. Jahrhundert spricht, ist es zunächst wichtig, dieses geografisch richtig einzuordnen.
Bei der Einarbeitung in diese Materie darf man nicht an das heutige Bundesland Sachsen im Osten Deutschlands denken, sondern sich vielmehr auf den Westen konzentrieren in dem Gebiet, wo heute in etwa Niedersachsen und Nordrheinwestfalen liegen.
Neben dieser geografischen „Falle“ zeichnet sich das Herzogtum Sachsens besonders als Heimatprovinz großer Könige wie Heinrich I. und Otto I. aus, welcher in Anlehnung an Karl den Großen ebenfalls mit dem Beinamen „der Große“ bedacht wurde.
Otto I. musste seine eigene Stärke als Nachfolger Heinrichs gegenüber dem eingesessenen Adel erst noch unter Beweis stellen. Hierbei folgte er dem Motto, dass man bei dem Versuch, in große Fußstapfen zu treten, meistens stolpert und er daher seinen eigenen Weg ging, indem er Hermann Billung anderen Adeligen vorzog und ihn unter anderem zum princeps militiae ernannte. Doch er ernannte Hermann nicht nur zum princeps militiae, sondern vertraute ihm auch während diverser Italienzüge die procuratio über Sachsen an.
Hierbei kommt eine in der Forschung höchst brisante und viel diskutierte Frage auf, welche es gilt im Zuge meiner Arbeit, so weit und gut es geht, zu beantworten: die Frage, ob Hermann Billung als ein Stellvertreter des Königs (im Stile eines Reichsvikars) agierte oder ob er direkt als Herzog Sachsens eingesetzt wurde und somit als „Begründer“ des jüngeren Stammesherzogtums in Sachsen herangezogen werden kann? Hiefür habe ich mich in meiner Arbeit zuerst der allgemeinen Entwicklung bzw. der Ethnogense der Sachsen im 10 Jahrhundert zugewandt, um dann den Fall des Hermann Billung anhand chronologischer Überlieferungen für die einzelnen Zeitpunkte zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung des jüngeren sächsischen Stammesherzogtums
- Die Entwicklungen in Sachsen vor 919
- Die Entwicklungen in Sachsen nach 919
- Der Fall Hermann Billung im Besonderen
- Quellenüberblick und Kritik
- Die Titulatur Hermann Billungs in den Urkunden Ottos I.
- Titulatur durch Widukind von Corvey
- Die Situation von 953 anhand der Überlieferungen Widukinds
- Hermanns Rolle während Ottos I. zweiten Italienzug 961 – 965
- Hermanns Rolle während Ottos I. drittem Italienzug 966-972
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung des jüngeren Stammesherzogtums in Sachsen im 10. Jahrhundert und analysiert die Rolle Hermann Billungs in diesem Prozess. Sie untersucht, ob Hermann Billung als Stellvertreter des Königs (im Stile eines Reichsvikars) agierte oder ob er direkt als Herzog Sachsens eingesetzt wurde.
- Ethnogenese der Sachsen im 10. Jahrhundert
- Die Rolle der Liudolfinger in Sachsen
- Die Bedeutung von Heinrich I. und Otto I. für die sächsische Geschichte
- Die Positionierung Hermann Billungs im sächsischen Machtgefüge
- Die Frage nach der tatsächlichen Herrschaft Hermann Billungs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen einleitenden Überblick über das Herzogtum Sachsen im 9. und 10. Jahrhundert und die geografische Einordnung des Gebiets. Sie stellt die besonderen Herausforderungen für Otto I. als Nachfolger Heinrichs I. dar und führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Ob Hermann Billung als Stellvertreter des Königs oder als Herzog Sachsens fungierte.
Kapitel 2 befasst sich mit der Entwicklung des jüngeren sächsischen Stammesherzogtums. Zunächst werden die Ereignisse vor 919 untersucht und die ethnogenesischen Prozesse in Sachsen nach der Niederlage gegen Karl den Großen beleuchtet. Anschließend analysiert das Kapitel die Veränderungen nach 919, als Heinrich I. König wurde und der politische Schwerpunkt nach Sachsen verlagert wurde. Hierbei werden die Entwicklung des sächsischen Selbstbewusstseins und die Rolle der Liudolfinger im Kontext des fränkischen Reiches erörtert.
Kapitel 3 widmet sich dem Fall Hermann Billungs im Detail. Es beleuchtet zunächst den Quellenüberblick und die Herausforderungen der Interpretation mittelalterlicher Quellen. Anschließend wird die Titulatur Hermann Billungs in den Urkunden Ottos I. analysiert, die Hinweise auf seine Positionierung im Machtgefüge bieten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung des jüngeren sächsischen Stammesherzogtums, den Liudolfingern, Hermann Billung, Ethnogenese, sächsisches Selbstbewusstsein, Reichsvikar, Herzog, Titulatur, Quellenkritik, Widukind von Corvey, Thietmar von Merseburg.
Häufig gestellte Fragen
Wo lag das Herzogtum Sachsen im 10. Jahrhundert?
Das historische Herzogtum Sachsen des 9. und 10. Jahrhunderts lag im Westen des heutigen Deutschlands, primär in den Gebieten des heutigen Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens, nicht im heutigen Bundesland Sachsen.
Wer war Hermann Billung?
Hermann Billung war ein bedeutender Adliger, den Otto I. zum "princeps militiae" ernannte und dem er während seiner Italienzüge die Verwaltung (procuratio) über Sachsen anvertraute.
War Hermann Billung ein Herzog oder ein Stellvertreter des Königs?
Dies ist eine zentrale Forschungsfrage. Es wird untersucht, ob er als direkter Herzog Sachsens und Begründer des jüngeren Stammesherzogtums agierte oder lediglich als Stellvertreter (Reichsvikar) des Königs fungierte.
Welche Rolle spielten Heinrich I. und Otto I. für Sachsen?
Sachsen war die Heimatprovinz dieser großen Könige. Unter ihrer Herrschaft wurde der politische Schwerpunkt des Reiches nach Sachsen verlagert, was das sächsische Selbstbewusstsein stärkte.
Welche Quellen geben Auskunft über Hermann Billung?
Wichtige Quellen sind die Urkunden Ottos I. sowie die chronologischen Überlieferungen von Widukind von Corvey und Thietmar von Merseburg.
- Arbeit zitieren
- Fabian Zschiesche (Autor:in), 2008, Die Entstehung des jüngeren Stammesherzogtums in Sachsen. Der Fall Hermann Billungs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336857