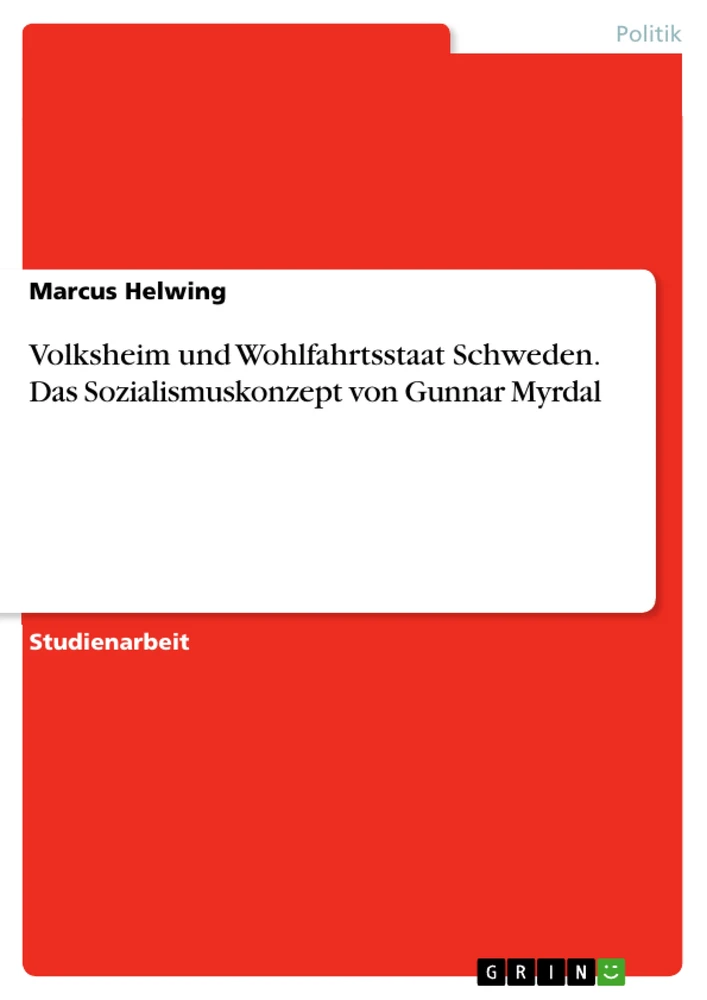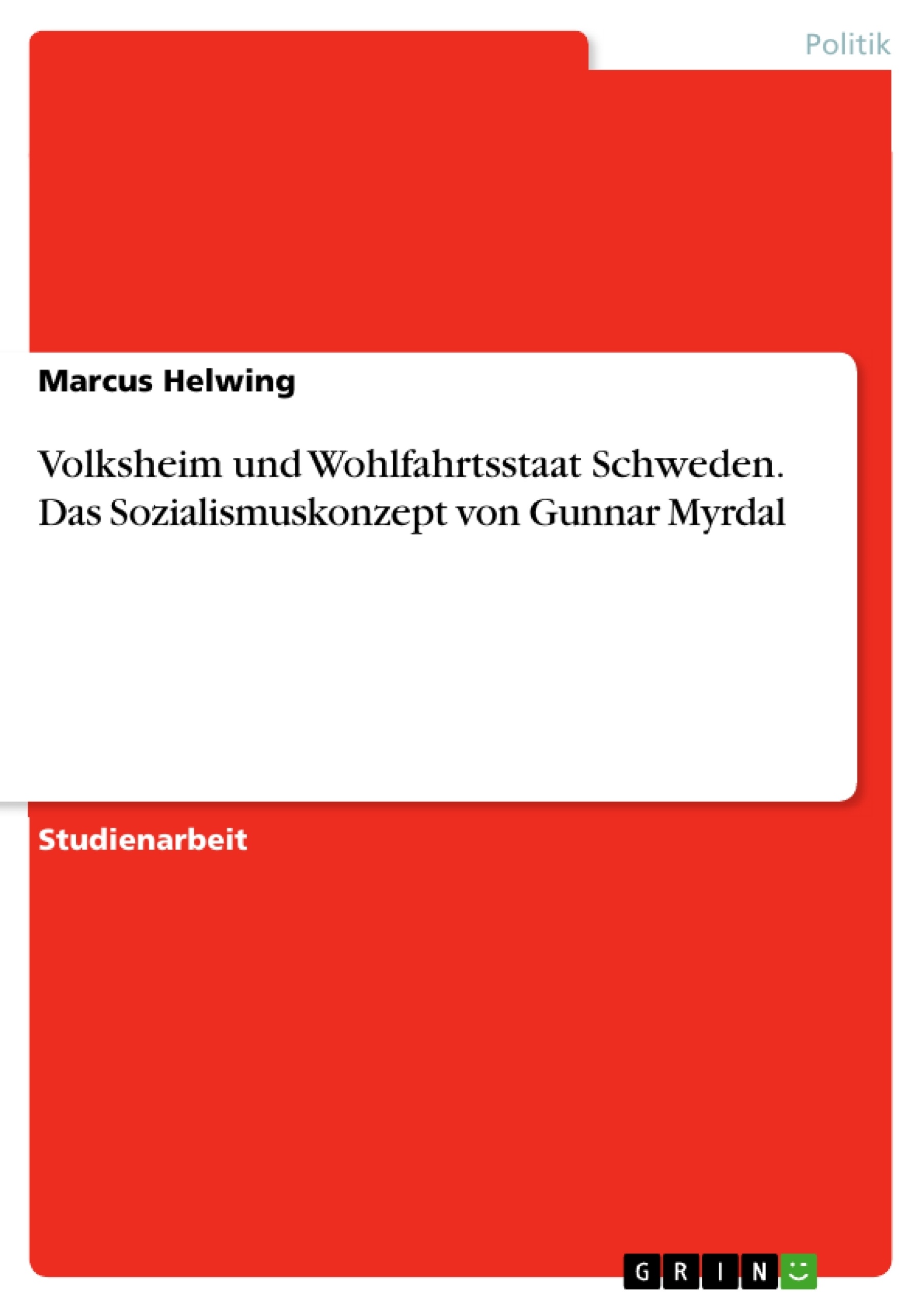Um die Sozialismuskonzeption Gunnar Myrdals in ihrer Gänze zu erfassen, werden verschiedene Faktoren betrachtet und verknüpft, die das Leben und die politische Entwicklung des schwedischen Wirtschaftsnobelpreisträgers, Ökonomen, VN-Kommissars und Politikers umfassen. Als solche kristallisierten sich Myrdals Werdegang in der Ausbildung, die spezielle "Schwedische Mentalität", seine Hinwendung zur Sozialdemokratie sowie die schwedischen Konzepte eines Volksheims und der Wohlfahrtsstaatlichkeit heraus.
In der Schlussbetrachtung werden diese Punkte zusammengeführt, verdichtet und in Beziehung gesetzt. Die Sozialismuskonzeption Gunnar Myrdals spiegelt sowohl seine Vielschichtigkeit wie auch Scharfsinnigkeit wider. Sie ist als eine Melange verschiedener auf ihn einwirkender Einflüsse zu verstehen, welche ihn schließlich dazu befähigte, kritisch auf die Probleme der Zeit und der Welt zu blicken und Lösungsansätze für sie zu entwickeln.
Besonders durch den von der Sozialdemokratie Schwedens vorangetriebenen Ausbau des Wohlfahrtsstaates erhoffte sich Myrdal stärkere demokratische Partizipation vormals ausgegrenzter Schichten und die Entwicklung einer Graswurzeldemokratie. Regulierende staatliche Eingriffe erachtete er nicht als Gefahr und in ökonomischer Gleichheit sah er keinen Widerspruch zu individueller Freiheit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausbildung
- Die "Schwedische Mentalität"
- Hinwendung zur Sozialdemokratie
- Folkhemmet och välfärdsstat (Volksheim und Wohlfahrtsstaat)
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sozialismuskonzeption Gunnar Myrdals. Ziel ist es, Myrdals Denken im Kontext seiner Biographie, seiner akademischen Laufbahn und des schwedischen Kontextes zu verstehen. Die Arbeit beleuchtet die Einflüsse auf seine Denkweise und skizziert die zentralen Elemente seiner sozialistischen Konzeption.
- Myrdals Biografie und prägende Einflüsse
- Die Rolle Schwedens und der schwedischen Sozialdemokratie
- Myrdals ökonomische und sozialpolitische Theorien
- Das Konzept des "Folkhemmet"
- Myrdals Verhältnis zum Marktliberalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Gunnar Myrdal als Universalgelehrten vor und skizziert sein vielseitiges Wirken in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen. Sie hebt seine interdisziplinären Interessen hervor und deutet auf die komplexen Faktoren hin, die seine sozialistische Konzeption prägten, darunter seine Jugend, akademische Laufbahn, Hinwendung zur Sozialdemokratie und seine Vorstellungen von Wohlfahrtsstaatlichkeit, "Volksheim" und "social engineering". Die Einleitung betont Myrdals pragmatische Einstellung und sein Vertrauen in das Entwicklungspotenzial der Menschheit.
Ausbildung: Dieses Kapitel beleuchtet Myrdals Werdegang und seine prägenden Einflüsse. Es beschreibt seine Kindheit in Dalarna und seinen Aufstieg aus dem unteren Mittelstand. Die Rolle seines streng konservativen Vaters und die Bedeutung seines Geschichtslehrers John Lindqvist, der Myrdal mit den Ideen der Aufklärungsphilosophie vertraut machte, werden hervorgehoben. Der Einfluss des Politikwissenschaftlers Rudolf Kjellén und seine Einführung in das Konzept des "Folkhemmet" wird ebenfalls thematisiert. Schließlich wird Myrdals Übergang von der Juristerei zur Wirtschaftswissenschaft dargestellt, seine Förderung durch Gustav Cassel und seine Integration in die Stockholmer Schule. Das Kapitel verdeutlicht, wie Myrdals frühe Erfahrungen und seine akademische Ausbildung seine spätere sozialistische Sichtweise formten.
Schlüsselwörter
Gunnar Myrdal, Sozialismus, Sozialdemokratie, Schweden, Folkhemmet, Wohlfahrtsstaat, Ökonomie, Wirtschaftswissenschaften, Stockholmer Schule, Sozialpolitik, Marktliberalismus, Biographie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Gunnar Myrdals Sozialismuskonzeption
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Sozialismuskonzeption von Gunnar Myrdal. Sie analysiert Myrdals Denken im Kontext seiner Biografie, seiner akademischen Laufbahn und des schwedischen Kontextes, beleuchtet die Einflüsse auf seine Denkweise und skizziert die zentralen Elemente seiner sozialistischen Konzeption.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Myrdals Biografie und prägende Einflüsse, die Rolle Schwedens und der schwedischen Sozialdemokratie, Myrdals ökonomische und sozialpolitische Theorien, das Konzept des "Folkhemmet", und Myrdals Verhältnis zum Marktliberalismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Ausbildung Myrdals, ein Kapitel zur "Schwedischen Mentalität" und zur Hinwendung zur Sozialdemokratie, ein Kapitel zum "Folkhemmet och välfärdsstat" (Volksheim und Wohlfahrtsstaat) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt Gunnar Myrdal als Universalgelehrten vor und skizziert sein vielseitiges Wirken. Sie hebt seine interdisziplinären Interessen hervor und deutet auf die komplexen Faktoren hin, die seine sozialistische Konzeption prägten (Jugend, akademische Laufbahn, Hinwendung zur Sozialdemokratie, Vorstellungen von Wohlfahrtsstaatlichkeit, "Volksheim" und "social engineering"). Die Einleitung betont Myrdals pragmatische Einstellung und sein Vertrauen in das Entwicklungspotenzial der Menschheit.
Was wird im Kapitel "Ausbildung" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet Myrdals Werdegang und seine prägenden Einflüsse. Es beschreibt seine Kindheit, seinen Aufstieg aus dem unteren Mittelstand, die Rolle seines Vaters und die Bedeutung seines Geschichtslehrers. Der Einfluss von Rudolf Kjellén und die Einführung in das Konzept des "Folkhemmet" werden ebenso thematisiert wie Myrdals Übergang von der Juristerei zur Wirtschaftswissenschaft, seine Förderung durch Gustav Cassel und seine Integration in die Stockholmer Schule. Das Kapitel zeigt, wie Myrdals frühe Erfahrungen und Ausbildung seine sozialistische Sichtweise formten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gunnar Myrdal, Sozialismus, Sozialdemokratie, Schweden, Folkhemmet, Wohlfahrtsstaat, Ökonomie, Wirtschaftswissenschaften, Stockholmer Schule, Sozialpolitik, Marktliberalismus, Biographie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Myrdals Denken im Kontext seiner Biographie, seiner akademischen Laufbahn und des schwedischen Kontextes zu verstehen.
- Arbeit zitieren
- Marcus Helwing (Autor:in), 2016, Volksheim und Wohlfahrtsstaat Schweden. Das Sozialismuskonzept von Gunnar Myrdal, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336881