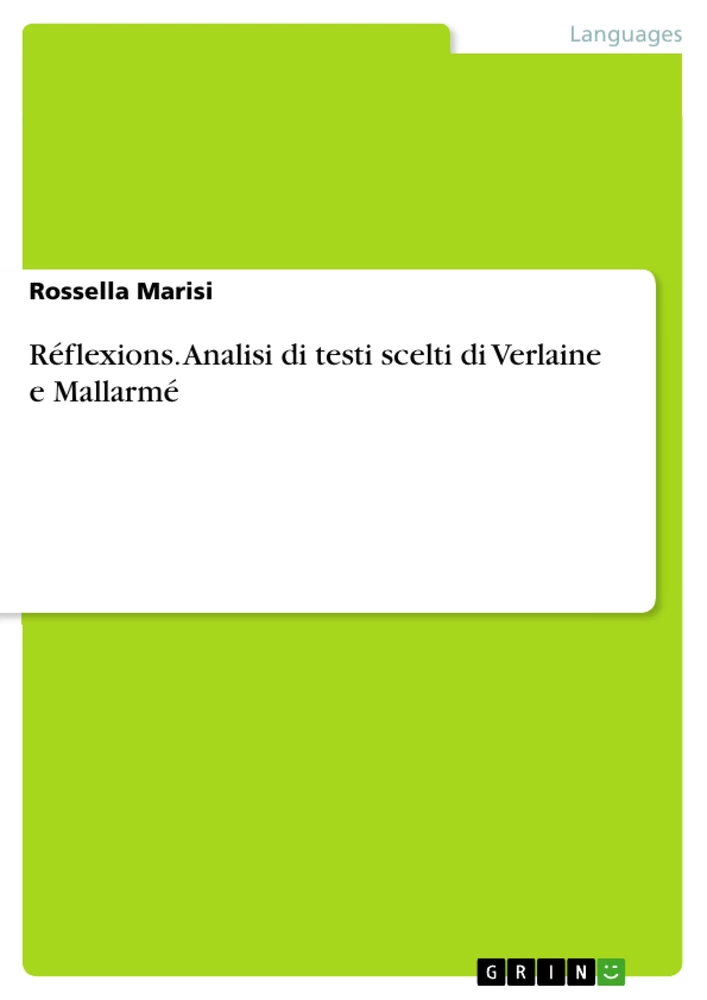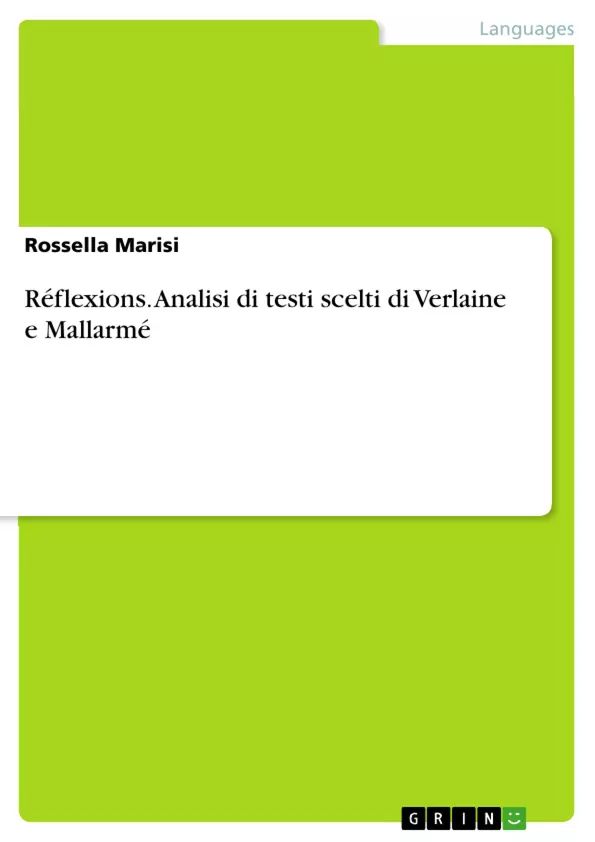L’analisi di un testo poetico deve tener conto della polisemia intrinseca dei prodotti artistici: secondo Umberto Eco ogni opera d’arte è un’opera aperta, che stimola l’intervento attivo del fruitore permettendo interpretazioni multiple.
In verità il testo poetico racchiude in sé una molteplicità di messaggi, che si originano dalle numerose scelte compiute dall’autore: la forma, il metro, il lessico, le figure retoriche, il soggetto, informano il lettore della possibile adesione dell’autore a determinate scuole poetiche o stili, o del suo distacco da questi.
Inoltre è interessante investigare se il poeta esprima la sua concezione poetica soltanto implicitamente, nel modo in cui crea le sue opere, o se lo faccia anche esplicitamente, per mezzo di una vera e propria teorizzazione.
Una particolare importanza riveste poi l’analisi del significante, che evidenzia come l’autore plasmi il proprio pensiero, rendendo portatori di significato le sonorità e il ritmo delle parole,dei versi e del periodo.
E’ pure opportuno che il lettore allarghi progressivamente la propria riflessione a considerare altri testi dello stesso autore e di altri autori, coevi e non, per evidenziarne analogie e differenze.
Poi il testo poetico può essere accostato ad opere incentrate sul medesimo soggetto, espresse in altri linguaggi, come ad esempio le opere d’arte visiva e i brani musicali: ciò accade ad esempio per la raccolta poetica di Verlaine Fêtes galantes, che può essere accostata al ciclo pittorico di Watteau e ai brani musicali di Debussy, anch'essi intitolati Fêtes galantes.
E’ importante infine collegare il testo al contesto storico-culturale, perché il poeta vive la realtà del suo tempo e si riferisce ad essa, anche quando apparentemente sceglie il disimpegno.
Partendo da tali premesse, ma senza proporsi l’obiettivo di un’esaustività che rischierebbe di apparire arida e prolissa, il presente volume intende indicare alcuni possibili percorsi di approccio ad un testo poetico.
Il lettore potrà scegliere tra loro quelli da fare propri e applicare nella lettura di nuovi testi, o ancor meglio potrà trarre spunto dalle presenti proposte per sviluppare autonome strategie di riflessione, analisi e confronto.
L’espansione delle capacità acquisite renderà possibile un ulteriore transfer cognitivo, permettendo al lettore non soltanto di giungere ad una comprensione profonda dei testi esaminati, ma anche di esprimere su di essi un giudizio articolato, motivato e davvero personale.
Inhaltsverzeichnis
INDICE
Indice delle illustrazioni
Fonti delle illustrazioni
Introduzione
1.1 Paul Verlaine
1.2 Fêtes Galantes
1.3 Mandoline
1.4 Analisi di Mandoline
1.5 Musicare un testo poetico: il percorso del compositore
2.1 Le Faune
2.2 Analisi di Le Faune
3.1 Les ingénus
3.2 Analisi di Les ingénus
3.3 Una prospettiva fotografica/cinematografica
3.4 Concitazione e distensione
4.1 Clair de lune
4.2 Analisi di Clair de lune
5.1 Stéphane Mallarmé
5.2 Apparition
5.3 I poètes maudits
5.4 Analisi di Apparition
5.5 Relazioni tra musica e poesia
Bibliografia
Sitografia
Indice delle illustrazioni
Fig. 1: Claude Monet, Le pont japonais
Fig. 2: Antoine Watteau, Il festival dell’amore
Fig. 3: Antoine Watteau, I piaceri del ballo
Fig. 4: Antoine Watteau, I pastori
Fig. 5: Fauno
Fig. 6: Fauno
Fig. 7: Fauno
Fig. 8: Schema delle vocali del francese
Fig. 9: Fauno
Fig. 10: Fauno
Fig. 11: Fauno
Fig. 12: Auguste Renoir, Ballo in città
Fig. 13: Antoine Watteau, L’assemblée dans un parc
Fig. 14: Campo lunghissimo
Fig. 15: Campo lungo
Fig. 16: Campo medio
Fig. 17: Figura intera
Fig. 18: Piano americano
Fig. 19: Primo piano
Fig. 20: Primissimo piano
Fig. 21: Dettaglio
Fig. 22: Antoine Watteau, L’amore al teatro italiano
Fig. 23: Antoine Watteau, La partie quarrée
Fig. 24: La lune s’attristait
Fig. 25: Marc Chagall, Il concerto
Fig. 26: Claude Debussy, Apparition, battute 2-5
Fig. 27: Claude Debussy, Apparition, battute 21-26
Fonti delle illustrazioni
Fig. 1 Claude Monet, Le pont japonais
https://www.google.it/search?q=monet+japonais&biw =1366&bih=643&tbm=isch&imgil=mM0VBG3h0SY wDM%253A%253BUf3ZVr5Jwc_2LM%253Bhttp% 25253A%25252F%25252F Error! Hyperlink reference not valid. F-sp%25252FLe-Pont-Japonais-Giverny- Posters_i7349095_.htm&source=iu&pf=m&fir=mM0 VBG3h0SYwDM%253A%252CUf3ZVr5Jwc_2LM %252C_&usg=__5ZLQFNRMVgKZIJlgh2wUCU_p bVM%3D&ved=0ahUKEwim6JS-
_vzNAhVLQBQKHSjXDoIQyjcILA&ei=EMiMV6a gPMuAUaiuu5AI#imgrc=mM0VBG3h0SYwDM%3 A (accesso 18.07.2016).
Fig. 2 Antoine Watteau, Il festival dell’amore
http://www.settemuse.it/pittori_opere_W/watteau_jea n_antoine/watteau_jean_antoine_502_the_festival_of _love.jpg
Fig. 3 Antoine Watteau, I piaceri del ballo
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean- Antoine_Watteau#/media/File:Antoine_Watteau_001. jpg
Fig. 4 Antoine Watteau, I pastori
http://it.wahooart.com/@@/8Y3LVC-Jean-Antoine- Watteau-I-Pastori
Fig. 5 Fauno
http://www.ebay.it/itm/ANTICA-STATUA-
SCULTURA-IN-MARMO-ALABASTRO-FIGURA- NEOCLASSICA-FAUNO-PRIMI-900- /291811218982?hash=item43f14dd626:g:mEgAAOS wRQlXe6EI
Fig. 6 Fauno
https://www.expertissim.com/le-faune-pompei- bronze-12265362
Fig. 7, Fauno
https://www.expertissim.com/le-faune-pompei- bronze-12265362
Fig. 8, Schema delle vocali del francese
Adattato da https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale
Fig. 9, Fauno
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauno#/media/File:Faunu s_Vienna_Ma528.jpg
Fig. 10, Fauno
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7 0/Faun_merse.jpg
Fig. 11, Fauno
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauno#/media/File:Le_fa une_1923.jpg
Fig. 12, Auguste Renoir, Ballo in città
http://cultura.biografieonline.it/renoir-ballo-in-citta- ballo-in-campagna/
Fig. 13, Antoine Watteau, L’assemblée dans un parc
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_fr ame&idNotice=10675
Fig. 14, Campo lunghissimo
http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura- campi-e-piani
Fig. 15, Campo lungo
http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura- campi-e-piani
Fig. 16, Campo medio
http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura- campi-e-piani
Fig. 17, Figura intera
http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura- campi-e-piani
Fig. 18, Piano americano
http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura- campi-e-piani
Fig. 19, Primo piano
http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura- campi-e-piani
Fig. 20, Primissimo piano
http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura- campi-e-piani
Fig. 21, Dettaglio
http://www.dreamvideo.it/articoli/221/l-inquadratura- campi-e-piani
Fig. 22, Antoine Watteau, L’amore al teatro italiano
http://www.aparences.net/periodes/rococo/jean- antoine-watteau/
Fig. 23, Antoine Watteau, La partie quarrée
http://www.aparences.net/periodes/rococo/jean- antoine-watteau/
Fig. 24, La lune s’attristait
http://accordeonnous.canalblog.com/archives/2008/12 /02/11577212.html
Fig. 25, Marc Chagall, Il concerto
http://lacapannadelsilenzio.it/mostra-dedicata-a-marc- chagall-a-catania/
Fig. 26, Claude Debussy, Apparition Adattato da http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac he:i3e32Ao3EjMJ:imslp.org/wiki/Apparition_(Debuss y,_Claude)+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
Fig. 27, Claude Debussy, Apparition
Adattato da
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac he:i3e32Ao3EjMJ:imslp.org/wiki/Apparition_(Debuss y,_Claude)+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
Introduzione
L’analisi di un testo poetico, come di ogni opera d’arte espressa in uno o più linguaggi, deve tener conto della polisemia intrinseca dei prodotti artistici: secondo Umberto Eco ogni opera d’arte è un’ opera aperta, che stimola l’intervento attivo del fruitore permettendo, o addirittura richiedendo, interpretazioni multiple e magari tra loro complementari1.
In verità il testo poetico racchiude in sé una molteplicità di messaggi, che si originano dalle numerose scelte compiute dall’autore: la forma, il metro, il lessico, le figure retoriche, il soggetto, informano il lettore non soltanto della possibile adesione dell’autore a determinate scuole poetiche o stili, ma anche del grado con cui questi ha scelto di aderire o distaccarsi da essi, e del momento in cui ha messo in atto tale decisione.
Inoltre è interessante investigare se il poeta esprima la sua concezione poetica soltanto implicitamente, nel modo in cui crea le sue opere, o se lo faccia anche esplicitamente, per mezzo di una vera e propria teorizzazione, e se i due momenti sono espressione di una concezione unitaria o se la poetica dell’autore si sia evoluta nel corso del tempo.
Una particolare importanza riveste l’analisi del significante, che evidenzia come l’autore plasmi il proprio pensiero, rendendo portatori di significato le sonorità e il ritmo delle parole, e, di conseguenza, le sonorità e il ritmo dei singoli versi e del periodo.
E’ opportuno poi che chi fruisce di un testo poetico e desidera investigarlo nei suoi plurimi aspetti, sviluppi la propria analisi partendo dal testo, e allarghi progressivamente la propria riflessione a considerare altri testi dello stesso autore e di altri autori, coevi e non, per evidenziare quali analogie e differenze il testo esaminato mostri rispetto agli altri con i quali viene messo a confronto.
Poi il testo poetico può essere accostato ad opere incentrate sul medesimo soggetto, espresse in altri linguaggi, come ad esempio le opere d’arte visiva e i brani musicali. Questo confronto è particolarmente interessante se il testo poetico si collega
16
esplicitamente ad un’opera d’arte visiva, come accade ad esempio per la raccolta Fêtes galantes di Paul Verlaine, che richiama il ciclo pittorico delle Fêtes galantes di Antoine Watteau; o se il testo poetico viene messo in musica, creando un brano vocale- strumentale, com’è accaduto per diverse poesie di Verlaine e Stéphane Mallarmé, musicate da Claude Debussy, Gabriel Fauré, e Petri Hellemaa.
In questi casi il confronto tra testo poetico, opera d’arte visiva e brano musicale si rivela assai fecondo, in quanto capace di gettare una nuova luce sia sui molteplici sensi dell’opera che ha propiziato la produzione delle opere successive, sia sulla ricchezza di sensi-significati di queste ultime.
E’ importante poi collegare il testo al contesto storicoculturale, perché il poeta vive la realtà del suo tempo e si riferisce ad essa, non soltanto quando tale riferimento assume la forma della partecipazione politica e sociale, ma anche quando si presenta come rifiuto a apparente disimpegno.
Partendo da tali premesse, ma senza proporsi l’obiettivo di un’esaustività che rischierebbe di apparire arida e prolissa, il presente volume intende indicare alcuni possibili potrà percorsi di approccio ad un testo poetico.
Il lettore potrà scegliere tra loro quelli da fare propri e applicare nella lettura di nuovi testi, o ancor meglio potrà trarre spunto dalle presenti proposte per sviluppare autonome strategie di riflessione, analisi e confronto.
L’espansione delle capacità acquisite renderà possibile un ulteriore transfer cognitivo2, permettendo al lettore non soltanto di giungere ad una comprensione profonda dei testi esaminati, ma anche di esprimere su di essi un giudizio articolato, motivato e davvero personale.
1.1 Paul Verlaine (1844 - 1896)
Verlaine nasce nel 1844 in una famiglia della piccola borghesia, residente prima a Metz e poi a Parigi. Nella capitale Verlaine frequenta i caffè e i salotti letterari.
Qui viene in contatto con il movimento poetico del Parnassianesimo. Già il nome ci dice che lo scopo degli aderenti a questo movimento era riportare la poesia al Parnaso, il monte sacro al dio Apollo, e abitato dalle muse. L’ideale di questi poeti era creare la pura bellezza, con una poesia formalmente perfetta, che mantenga forti legami con le arti visive e la musica.
Mentre la poesia deve avere legami con l’extrapoetico, il poeta deve dedicarsi completamente alla sua arte ed essere “soltanto un poeta”, rimanendo lontano dall’impegno sociale e politico. In questo, gli aderenti al Parnassianesimo seguono i dettami della teoria di Théphile Gautier (1811-1872), nota sotto il nome di “l’art pour l’art”. Essa proclama che la vera arte non può avere finalità estrinseche:
“Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien”3.
Pur aderendo a questo movimento che sostiene il disimpegno politico, Verlaine partecipa alla Comune di Parigi (1871), e a causa di questo perde l’impiego. Conduce una vita tormentata, costellata di relazioni complicate, come ad esempio quella col poeta Arthur Rimbaud, sperimenta dipendenze da alcool e droghe, finisce più volte in prigione, ed è colpito da varie malattie.
Nonostante la sua vita sia piuttosto sregolata e dedita agli eccessi, Verlaine concepisce la poesia come un canto discreto e dolce, che nasce da impressioni vaghe e indefinite.
Egli stesso scrive infatti nella sua Art po é tique, pubblicata nel 1882:
De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l’air, Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.
La musica prima di ogni cosa, e per questo scegli l'impari più vago e solubile nell'aria senza nulla in sé che pesi o posi.
E’ possibile istituire un’analogia tra questa concezione poetica di Verlaine e la concezione estetica degli impressionisti, che preferiscono usare la luce e i colori, capaci di rendere percepibile il senso del vago e dell’indefinito, piuttosto che demarcare i soggetti pittorici con linee che ne definiscano con precisione le forme e gli spazi4.
Un esempio di pittura impressionista è rappresentato dal quadro di Monet Le pont japonais
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 1, Claude Monet, Le pont japonais
Verlaine, con Stéphane Mallarmé e Charles
Baudelaire, appartiene alla corrente del
Decadentismo. Il termine ha un significato morale, ma non si riferisce a ciò che la società pensa di questi artisti, bensì, al contrario, a ciò che questi artisti pensano della società: essi la ritengono incapace di dare risposte agli interrogativi fondamentali dell’uomo, e dunque malata, decadente5.
Il modo di far poesia di questi autori usa suggestioni, sfumature, indefinita nostalgia, e un linguaggio che investe tutti i sensi: vista, udito, tatto, gusto, olfatto.
1.2 Fêtes Galantes
Nel 1869 Paul Verlaine pubblica F ê tes Galantes. La raccolta comprende 22 brevi composizioni poetiche, incentrate sui temi dell’amore, della festa, della musica, del teatro, e della natura.
Il titolo si riallaccia ad un genere pittorico inaugurato da Watteau nel 1700, che ritraeva un mondo aristocratico, come quello della nobiltà che si riuniva a Versailles dando vita ad una sorta di nuova Arcadia.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 2, Antoine Watteau, Il festival dell’amore
L’Arcadia è una terra idealizzata, dove uomini e natura vivono in perfetta armonia. Per questo motivo gli esseri umani che la abitano sono spesso ritratti come pastori, secondo una convenzione che aveva usato già Virgilio, ancora nell’epoca pre-cristiana6.
Naturalmente si tratta di pastori raffinati ed eleganti, che esprimono sentimenti nobili ed elevati per mezzo di canzoni d’amore o conversazioni gentili.
Nonostante il titolo faccia riferimento ad un clima festoso, spesso affiora una tendenza alla malinconia. Dal punto di vista stilistico, questi testi sono caratterizzati dall’uso di vari metri, e da frequenti riferimenti a immagini e sonorità.
Inizialmente l’opera non riscosse particolare attenzione da parte della critica, ma in seguito i commentatori la qualificarono come una delle opere migliori di Verlaine, per la sua originalità poetica.
1.3 Mandoline, di Paul Verlaine
Les donneurs de sérénades Et les belles écouteuses Echangent des propos fades Sous les ramures chanteuses.
C'est Tircis et c'est Aminte,
Et c'est l'éternel Clitandre,
Et c'est Damis qui pour mainte Cruelle fait maint vers tendre.
Leurs courtes vestes de soie, Leurs longues robes à queues, Leur élégance, leur joie Et leurs molles ombres bleues
Tourbillonnent dans l'extase D'une lune rose et grise, Et la mandoline jase
Parmi les frissons de brise7.
Ascolto consigliato
https://www.youtube.com/watch?v=hlbwuMNvlQY
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 3, Antoine Watteau, I piaceri del ballo
Traduzione: Mandolino
I donatori di serenate e le belle ascoltatrici
si scambiano frasi di poca importanza sotto fronde canore.
È Tirsi ed è Aminta, ed è l'eterno Clitandro, e Damide che per tante
crudeli compone molti dolci versi. Le corte giubbe di seta,
gli abiti lunghi con lo strascico, la loro eleganza, la gioia, le loro morbide azzurre ombre volteggiano nell'estasi
di una luna rosa e grigia e il mandolino chiacchiera tra i fremiti di brezza.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fig. 4, Antoine Watteau, I pastori
1.4 Analisi di Mandoline
Questa poesia appartiene alla tradizione della poesia pastorale: si riteneva che i pastori, trascorrendo molto tempo soli e a contatto con la natura, per passatempo componessero poesie e canzoni.
Nella poesia si allude ad una festa campestre, la cui atmosfera ci ricorda l’atmosfera delle feste galanti dei dipinti di Watteau.
La prima strofa presenta i personaggi in maniera anonima, ma nella seconda strofa vengono citati quattro nomi Tircis, Aminte, Damis e Clitandre, sono personaggi della letteratura pastorale e della commedia italiana.
Tircis è un personaggio di varie opere: della favola in musica La Dafne, di Ottavio Rinuccini e Marco da
Gagliano (1608), del madrigale Tirsi e Clori di
Claudio Monteverdi (1619), della commedia La
princesse d'Elide di Molière (1664), della cantata
Clori, Tirsi, e Fileno di George Frideric Handel , (1707).
Il personaggio è presentato come dotato di bella voce e capacità canora.
Aminte è protagonista di un dramma pastorale, l’ Aminta, di Torquato Tasso; a questo personaggio, delineato come amante tragico e devoto, è ispirata anche l'opera di Mozart e Metastasio Il re pastore (1775).
Clitandre è un personaggio dell'opera L'amore medico di Ermanno Wolf-Ferrari (1913), tratta dalla comedie- ballet L ’ Amour m é decin di Molière e Lully. Il suo legame con l’amore e la natura è dato dal fatto che egli dichiara il suo amore alla sua bella in un giardino.
Damis (o Damide) è un personaggio de Il Tartuffo, una commedia di Molière, dal carattere impetuoso e irascibile.
Il fatto che i nomi siano tratti dalle tradizioni letterarie e che i vari personaggi non siano affatto caratterizzati in maniera individuale, ci induce a credere che Verlaine abbia voluto semplicemente far riferimento a figure di innamorato non meglio definite.
Altrettanto poco caratterizzate sono le figure femminili, di cui si dice soltanto ossia, immaginiamo, che non ricambiano l’amore che gli uomini nutrono perloro.Comunque, nonostante l’accenno alla crudeltà, l’atmosfera rimane lieta e leggera, come viene confermato anche dalla strofa successiva, in cui troviamo il termine joie.
Ora analizziamo il testo, identificando le diverse percezioni (visive, auditive, tattili e di movimento) a cui si allude, e le emozioni che ad esse si accompagnano.
Esaminiamo i termini che rimandano a percezioni visive:
I donatori di serenate e le belle ascoltatrici
si scambiano frasi di poca importanza sotto fronde canore.
È Tirsi ed è Aminta, ed è l'eterno Clitandro, e Damide che per tante
crudeli compone molti dolci versi. Le corte giubbe di seta,
gli abiti lunghi con lo strascico, la loro eleganza, la gioia, le loro morbide azzurre ombre
volteggiano nell'estasi di una luna rosa e grigia e il mandolino chiacchiera tra i fremiti di brezza.
Nella terza strofa i personaggi, già prima poco caratterizzati, perdono ogni traccia di individualità, e di loro si citano soltanto i bellissimi vestiti che volteggiano danzando. Le loro forme in movimento animano un quadro dominato da tre colori: l’azzurro, il rosa e il grigio. Sono colori tenui, che confermano l’idea di una festa piacevole, senza momenti drammatici.
Esaminiamo ora le percezioni auditive:
I donatori di serenate
e le belle ascoltatrici
si scambiano frasi di poca importanza sotto fronde canore.
È Tirsi ed è Aminta, ed è l'eterno Clitandro, e Damide che per tante
crudeli compone molti dolci versi. Le corte giubbe di seta,
gli abiti lunghi con lo strascico,
la loro eleganza, la gioia,
le loro morbide azzurre ombre volteggiano nell'estasi
di una luna rosa e grigia e il mandolino chiacchiera tra i fremiti di brezza.
Particolarmente interessante è la citazione di un particolare strumento musicale, che anzi dà il titolo alla poesia: il mandolino, tipico della tradizione napoletana, era particolarmente usato nelle canzoni d’amore,
Inoltre notiamo che versi sono settenari, ossia sono tutti articolati su sette sillabe, il che rafforza l’impressione musicale che ci dà il testo.
Ora concentriamo l’attenzione sulle sensazioni tattili e di movimento.
I donatori di serenate e le belle ascoltatrici
si scambiano frasi di poca importanza sotto fronde canore.
È Tirsi ed è Aminta, ed è l'eterno Clitandro, e Damide che per tante
crudeli compone molti dolci versi. Le corte giubbe di seta,
gli abiti lunghi con lo strascico, la loro eleganza, la gioia, le loro morbide azzurre ombre volteggiano nell'estasi
di una luna rosa e grigia e il mandolino chiacchiera tra i fremiti di brezza.
In verità, la parola fremiti rimanda a due diverse percezioni: sonora e di movimento.
Il fatto che le prime due strofe siano di quattro versi ciascuna, mentre la terza sia di otto versi, insieme con la presenza del verbo volteggiano, ci fa pensare ad un andamento più mosso nella terza strofa.
Infine, esaminiamo i termini che ci indicano l’atmosfera emotiva del testo.
I donatori di serenate
[...]
1 Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano: RCS Libri, 2010, 33. 15
2 Niels A. Taatgen, The Nature and Transfer of Cognitive Skills, Psychological Review, American Psychological Association, 2013, Vol. 120, No. 3, 439-471.
3 Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, Préface, Parigi : G. Charpentier, 1880, 22.
4 Impressionismo, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QOLLwkE X2CEJ:www.francescomorante.it/pag_3/304.htm+&cd=1&hl=it&ct =clnk&gl=it (accesso 18.07.2016).
5 Tra Ottocento e Novecento: Decadentismo e Simbolismo, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_O6OVQOl VvEJ:www.luzappy.eu/Decadentismo%2520e%2520simbolismo.doc x+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it (accesso 18.07.2016).
6 Publio Virgilio Marone, Bucoliche. Note esegetiche e grammaticali a cura di Massimo Gioseffi, Milano: CUEM, 2005.
7 Mandoline, http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/ma ndoline.html (accesso 19.07.2016)
Frequently Asked Questions
What are the primary goals this volume sets out to achieve in analyzing poetry?
This volume aims to indicate possible approaches to analyzing a poetic text, building on premises such as the intrinsic polysemy of art (citing Umberto Eco's "open work"), the importance of authorial choices (form, meter, lexicon), investigating explicit theorization versus implicit creation, analyzing the signifier (sound and rhythm), comparing texts across authors and media (visual art and music), and contextualizing the work historically.
Which specific poets and texts are analyzed in detail within this document?
The document analyzes selected texts from Paul Verlaine, specifically focusing on the collection Fêtes galantes, and examining the poems "Mandoline," "Le Faune," "Les ingénus," and "Clair de lune." It also includes analysis of a text by Stéphane Mallarmé, specifically "Apparition."
How does the analysis of Verlaine's "Mandoline" apply the suggested interdisciplinary approach?
The analysis of "Mandoline" connects the poem's pastoral setting and atmosphere to the Fêtes galantes painting cycle by Antoine Watteau. Furthermore, it analyzes sensory perceptions (visual, auditory, tactile) within the poem and notes its musical quality, reinforced by the use of seven-syllable verses (settenari) and the reference to the mandolin.
What analytical framework is used to explore connections between Verlaine's Fêtes galantes and other art forms?
The framework involves accosting the poetic text to works in other languages, particularly visual art and music. For Fêtes galantes, the study explicitly links the collection to the pictorial cycle by Antoine Watteau, and it notes that many poems by Verlaine and Mallarmé were set to music, such as Debussy's "Apparition."
What critical context is provided for Paul Verlaine's poetic style?
Verlaine is contextualized first within the Parnassian movement (though he deviated politically by participating in the Paris Commune) and subsequently placed within the Decadent movement alongside Mallarmé and Baudelaire. His personal poetic concept, summarized by "De la musique avant toute chose," emphasizes vagueness, indistinct impressions, and musicality, analogizing his style to Impressionist painting.
What methodology does the document suggest for developing a personal critical judgment?
The document suggests that readers should start analysis with the text itself, progressively expanding reflection to compare it with other texts by the same or different authors, and integrating cross-media comparisons. Successful application of these approaches leads to "cognitive transfer," enabling the reader to form an articulated, motivated, and personal judgment of the examined texts.
What specific visual elements are analyzed in relation to the poetry?
The document analyzes sensory perceptions, specifically visual elements like the "soft blue shadows" and the colors blue, pink, and gray in "Mandoline." Furthermore, in analyzing "Les ingénus," it incorporates a "photographic/cinematic perspective," illustrating concepts such as extreme long shot (Campo lunghissimo), close-up (Primo piano), and detail shot (Dettaglio).
- Quote paper
- M° Rossella Marisi (Author), 2016, Réflexions. Analisi di testi scelti di Verlaine e Mallarmé, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337072