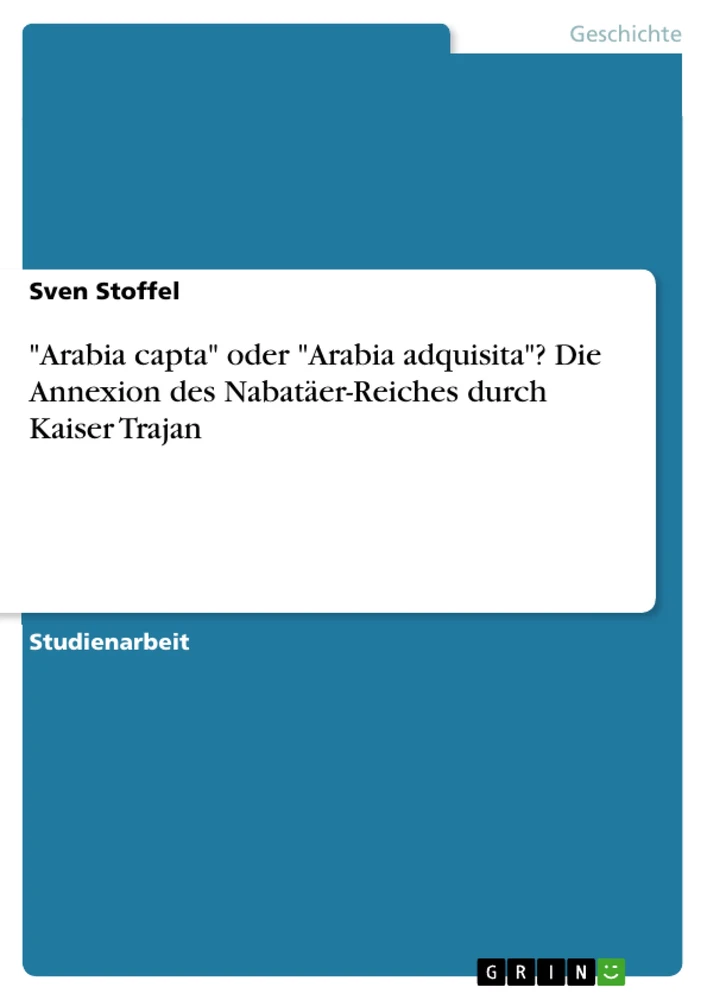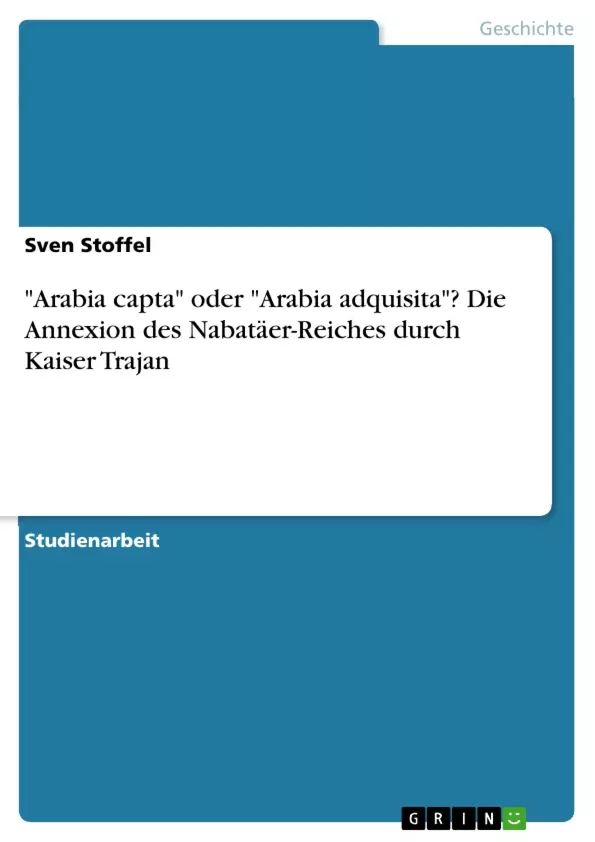Der römische Kaiser Trajan erteilte im Jahre 106 n. Chr. Cornelius Palma, dem Statthalter der Provinz Syria, den Befehl, in das arabische Reich der Nabatäer einzumarschieren, es dem „Imperium Romanum“ einzuverleiben und gleichzeitig die politische Autonomie des ersten und am längsten existierenden Staats seiner Zeit zu beenden. Zusammen mit dem Nabatäerreich ging auch die Weihrauchstraße, eine der ältesten Handelsrouten der Welt, die von Südarabien bis zum Mittelmeer führte und auf der viele der wichtigsten Güter dieses Zeitalters transportiert wurden, in die Hände des Trajan, der fortan die gesamte Mittelmeerwelt sein Eigen nennen konnte.
Doch diese Annexion lief anders ab als vergleichbare Unternehmungen beispielsweise in Dakien oder Germanien. Während dort ruhmvolle Schlachten ausgetragen worden sind, die mit prunkvollen Festen und Triumphzügen in der Heimat gefeiert und mit Münzen, beschriftet mit „Dacia capta“ und „Germania capta“, zu Ehren des Kaisers gewürdigt wurden, fiel nahezu jegliche Propaganda bezüglich der Eingliederung Arabiens in das römische Reich aus. Trajan erhielt nicht das Epitheton „Arabicus“, seine Münzen zierte nicht der Schriftzug „Arabia capta“ und auch antike Schriftsteller schwiegen größtenteils über dieses Ereignis. Die Münzprägungen kamen sogar ohne jegliche Unterwerfungsgesten aus, stellten die personifizierte Arabia in aufrechter Haltung dar und titulierten die neu gegründete Provinz Arabia als „Arabia adquisita“. Auf der anderen Seite finden sich bei den Nabatäern, die ihre Geschichte grundsätzlich kaum verschriftlichten, auf den ersten Blick ebenso nur wenige Hinweise auf eine gewaltsame Unterwerfung.
Diese Hausarbeit arbeitet die Annexion noch einmal auf, indem sie von der Entstehung des nabatäischen Volks über die ersten Kontakte zu seinem späteren Eroberer bis hin zum Tag der Annexion das anspricht, was hierzu von Bedeutung ist. Es soll der Frage nachgegangen werden, ob die Provinz Arabia, wie von einem Großteil der Historiker vermutet wird, wirklich nur „adquisita“ und nicht vielleicht doch „capta“ gewesen ist und zudem, wieso sie das eine und nicht das andere war. Des Weiteren soll verdeutlicht werden, aus welchen Gründen das Nabatäerreich interessant für den römischen Kaiser gewesen ist. In dieser Abhandlung trifft das Volk, das seine Sichtweisen genauestens dokumentierte, auf jenes Volk, deren Sichtweisen wir versuchen, wiederzugeben, obwohl sie nicht wiedergegeben wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Wer sind die Nabatäer?
- Die Weihrauchstraße und ihre Bedeutung für die Nabatäer.
- Rom und das Nabatäerreich.
- Beweggründe Roms für die Annexion.
- Die Provinzialisierung
- Was für eine widerstandslose Provinzialisierung spricht.
- Was gegen eine widerstandslose Provinzialisierung spricht.
- Fazit.
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet die Annexion des Nabatäerreichs durch Rom im Jahre 106 n. Chr. unter Kaiser Trajan. Sie untersucht die Entstehung des nabatäischen Volkes, die ersten Kontakte zu Rom und die Hintergründe der Annexion. Besonderes Augenmerk liegt darauf, die Frage zu klären, ob die Provinzialisierung Arabiens tatsächlich widerstandslos erfolgte und wie die Weihrauchstraße als Schlüsselfaktor für den Aufstieg des Nabatäerreichs und sein Interesse für Rom zu betrachten ist.
- Die Entstehung und Entwicklung des Nabatäerreichs
- Die Bedeutung der Weihrauchstraße für den wirtschaftlichen Aufstieg des Nabatäerreichs
- Die Beziehungen zwischen Rom und dem Nabatäerreich
- Die Annexion des Nabatäerreichs durch Rom
- Die Frage der Widerstandsfähigkeit der Nabatäer gegenüber der römischen Annexion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische Situation dar und führt die Frage nach der tatsächlichen Art der römischen Annexion ein. Das zweite Kapitel widmet sich der Entstehung und Entwicklung des nabatäischen Volkes, wobei auch die Frage nach der Herkunft des Namens und die Bedeutung des Wandervolks behandelt werden. Das dritte Kapitel analysiert die Weihrauchstraße, ihre wirtschaftliche Bedeutung für die Nabatäer und deren Aufstieg zur Großmacht im arabischen Raum. Das vierte Kapitel beleuchtet die Beziehungen zwischen Rom und dem Nabatäerreich, während das fünfte Kapitel die Gründe für die Annexion seitens Roms untersucht. Das sechste Kapitel analysiert die Frage nach der Widerstandsfähigkeit der Nabatäer bei der Provinzialisierung, wobei sowohl Argumente für als auch gegen eine widerstandslose Eingliederung beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Nabatäer, Weihrauchstraße, Rom, Trajan, Annexion, Provinzialisierung, Arabia, Geschichte, Handel, Arabien, Politik, Militär, Wirtschaft.
- Quote paper
- Sven Stoffel (Author), 2015, "Arabia capta" oder "Arabia adquisita"? Die Annexion des Nabatäer-Reiches durch Kaiser Trajan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337155