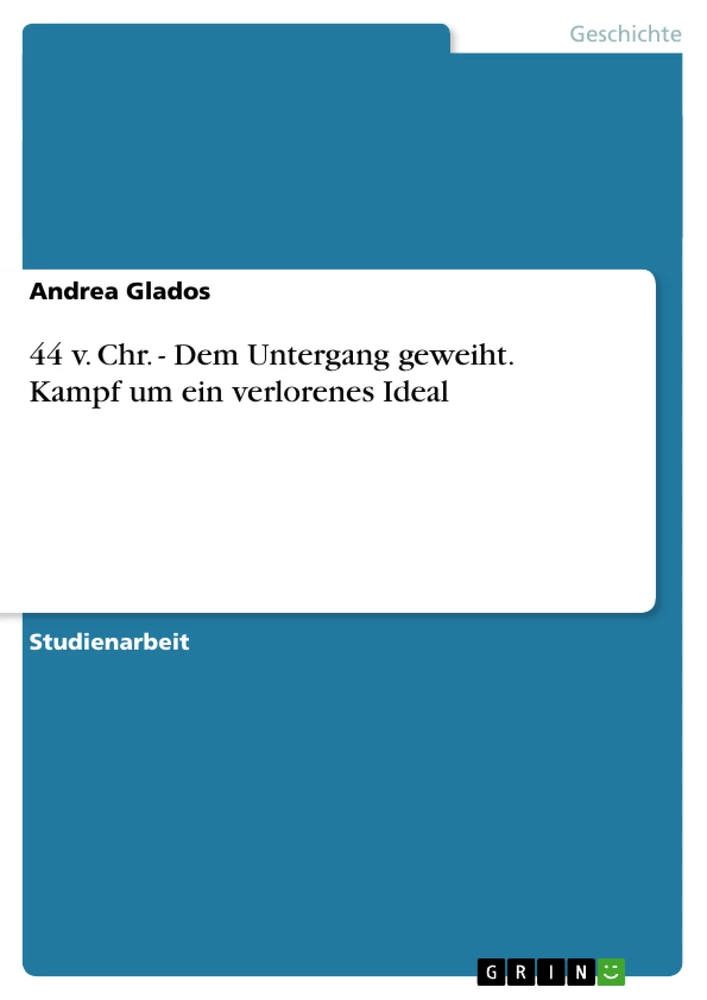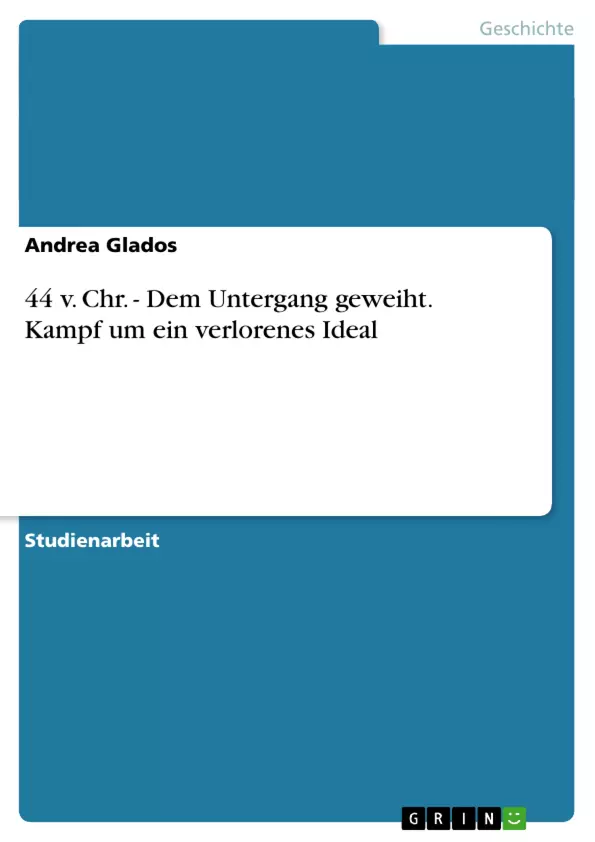„Gewiss, Mannesmut haben wir bewiesen, aber, glaub’s nur Kinderverstand.“ Cicero, Briefe an Atticus XV 4.2
Der Bürgerkrieg hatte in Rom längst seine Spuren hinterlassen: Mit außerordentlichen Machtbefugnissen ausgestattet, war Gnaeus Pompeius neben dem Senat wohl der größte Widersacher des Gaius Julius Caesar. Nach der Entscheidungsschlacht bei Pharsalos am 9. August 48 v. Chr. 1 gelang ihm ein letztes Mal die Flucht, bis er schließlich am 28. September desselben Jahres in den Wirren des ägyptischen Thronstreits von Anhängern des Ptolemaios XIII. ermordet wurde 2. Nachdem Caesar sowohl eben jenen Thronstreit zugunsten von Kleopatra VII. entscheiden konnte3, als auch, sich gegen Pharnakes (Sohn des Mithridates VI. von Pontus) zu behaupten wusste4, folgte ein kurzes Intermezzo in Rom, wo es Marcus Antonius nicht gelungen war, die Aufstände dauerhaft niederzuwerfen. Was nun folgte, war laut Luciano Canfora der „«republikanische» Krieg5“ in Afrika, welcher trotz der vermeintlichen Überlegenheit der Widersacher mit einem Sieg Caesars 6 und dem daraus resultierenden Freitod des letzten Republikaners Marcus Porcius Cato in Utica 7 ein Ende fand. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass es den Söhnen des Pompeius 8 mitsamt ihren Anhängern gelungen war, nach Spanien zu fliehen und sich dort eine bedrohliche Machtbasis zu errichten, war der Bürgerkrieg längst nicht beendet9. Trotz der Schlacht von Munda am 17. März 45 v. Chr., welche Caesar mit Glück und ebensoviel taktischem Geschick für sich entschied, gelang es ihm bis zu seinem Tode nie, den Bürgerkrieg endgültig beizulegen.
1 vgl. hierzu: Plutarch: Caesar 44f.
2 vgl. hierzu: Canfora S. 192 – 211
3 nicht zuletzt dank der Hilfe der Juden (Antipater, Hyrkanos), vgl. hierzu: Canfora S. 192 - 219
4 vor der entscheidenden Schlacht bei Zela am 2. August 47 v. Chr. trifft Caesar in Kilikien auf einen seiner späteren Mörder Gaius Cassius Longinus, vgl. hierzu: Canfora S. 223ff. , Cicero: 2. philippische Rede 26
5 Zitat in: Canfora S. 230
6 Schlacht bei Thapsos 06. April 46 v. Chr., Plutarch: Caesar 53,4
7 12./13. April 46 v. Chr., vgl. hierzu: Canfora S. 236, Plutarch: Caesar 54,2
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorboten einer Verschwörung
- "Hochmut kommt vor dem Fall"
- Die Verschwörer sammeln sich
- Die Zeit drängt
- Die Iden des März und ihre Folgen
- Der Mord
- Acta Caesaris
- "Octavian tritt auf"
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet das Krisenjahr 44 v. Chr. in der späten römischen Republik. Sie untersucht die Ursachen und den Ablauf der Verschwörung gegen Gaius Julius Caesar, die zum Mord an den Iden des März führte. Darüber hinaus analysiert sie die unmittelbaren Folgen der Tat und die anschließenden Machtkämpfe, die zur Errichtung des Prinzipats durch Augustus führten.
- Die politische und soziale Krise der späten römischen Republik
- Die Rolle von Gaius Julius Caesar und seine Machtansprüche
- Die Verschwörung gegen Caesar und ihre Motive
- Die Folgen des Mordes an Caesar für Rom und seine politische Ordnung
- Die Entstehung des Prinzipats und die Ablösung der römischen Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt den historischen Kontext dar. Sie beleuchtet die Folgen des Bürgerkriegs und die Machtbefugnisse Caesars, die zu Spannungen mit dem Senat führten.
Das zweite Kapitel analysiert die Vorboten der Verschwörung gegen Caesar. Es untersucht die wachsende Kritik an Caesars Machtpolitik, die Bildung von Oppositionsgruppen und die zunehmenden Ängste vor einer möglichen Tyrannis.
Das dritte Kapitel widmet sich den Iden des März und ihren unmittelbaren Folgen. Es beschreibt den Mord an Caesar und die Reaktionen der Bevölkerung sowie die Reaktionen der verschiedenen politischen Fraktionen.
- Arbeit zitieren
- Andrea Glados (Autor:in), 2004, 44 v. Chr. - Dem Untergang geweiht. Kampf um ein verlorenes Ideal, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33716