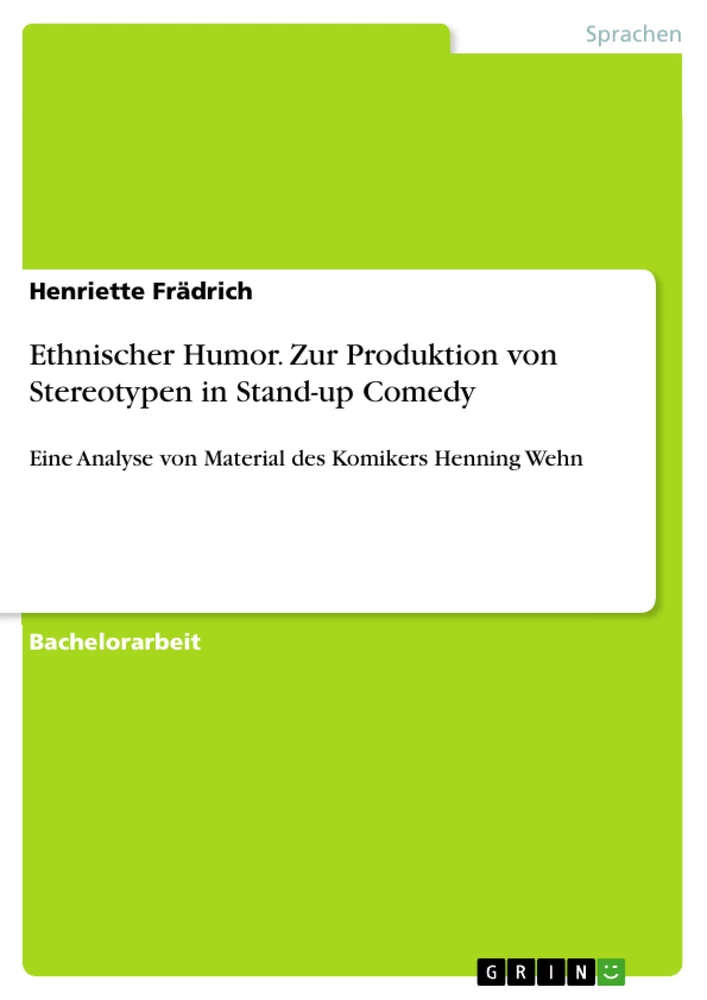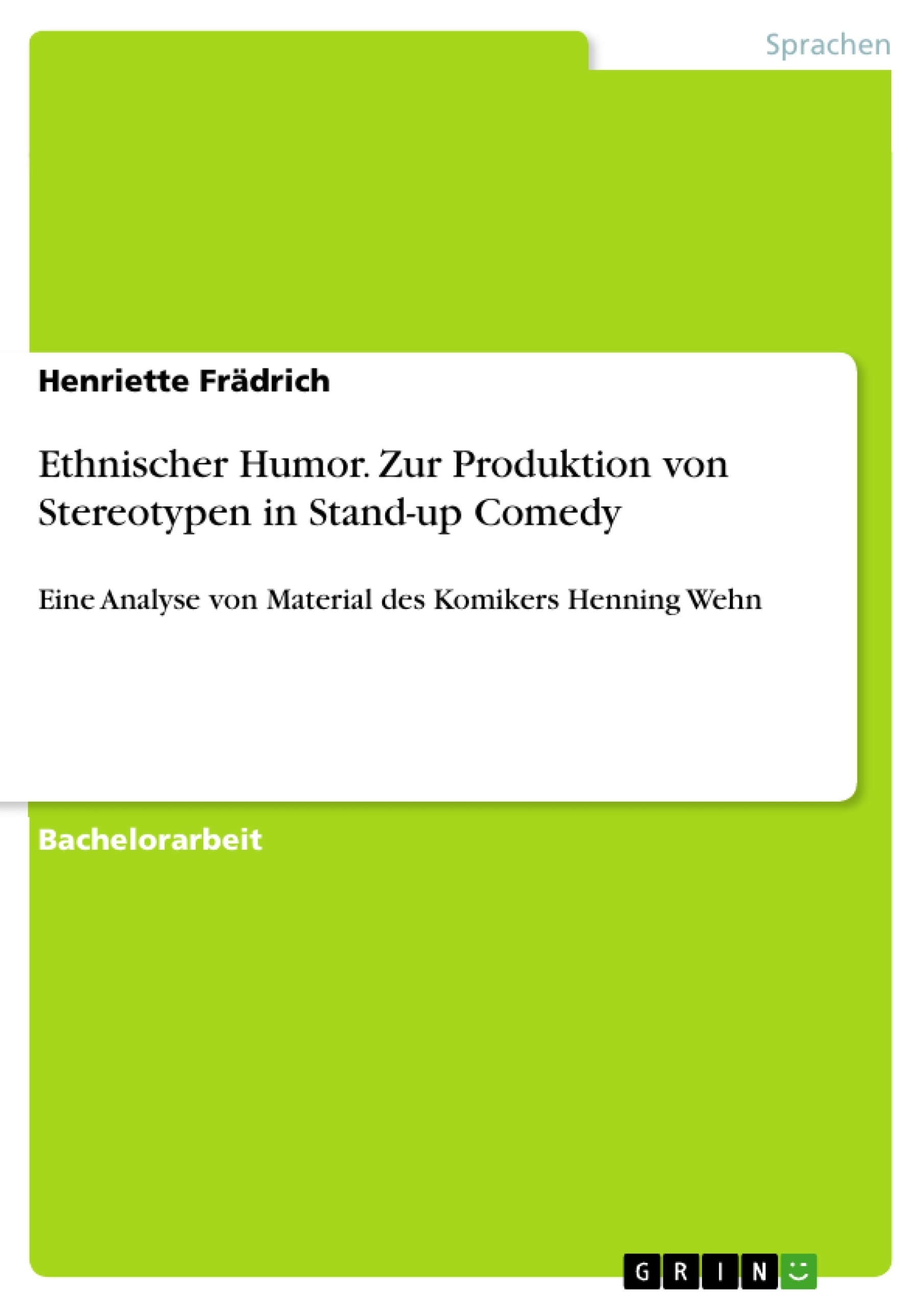Die vorliegende Arbeit soll zeigen, dass die Stand-up Comedy von Henning Wehn dazu beiträgt, die bereits bestehenden Stereotype der Briten über die Deutschen zu reproduzieren.
Henning Wehn schafft jedoch einen kulturellen Ausgleich, indem er gleichermaßen britische Stereotype aus der Sicht des Deutschen präsentiert.
Anhand der Analyse der Liveauftritte des Komödianten Henning Wehn möchte ich aufzeigen, welche ethnischen Stereotype mit welchen sprachlichen – insbesondere lexikalischen Mitteln – produziert werden. Darüber hinaus soll der Frage nachgegangen werden, ob ethnischer Humor zu einer (Re-)produktion von Stereotypen beiträgt und gegebenenfalls bestehende Vorurteile verfestigt. Henning Wehn ist ein deutscher Komödiant, der seit über zehn Jahren in Großbritannien lebt und vordergründig Witze über Deutsche und Briten erzählt.Diese Fragestellung erscheint mir von Bedeutung zu sein, da es ein Gebiet der Sprache durchleuchtet, dessen Einfluss auf interkulturelle Verhältnisse bisher kaum Beachtung gefunden hat. Ein Zusammenhang zwischen ethnischem Humor und der Produktion von Stereotypen wurde in der bisherigen Literatur nur geringfügig behandelt und bedarf meines Erachtens weiterer Überlegungen.
Im Verlauf dieser Arbeit werde ich zunächst grundlegende Begriffe erörtern, die für das Verständnis des Prozesses der Stereotypisierung notwendig sind und werde nachfolgend
auf die Bedeutung des ethnischen Humors für dieses Phänomen eingehen. In diesem Rahmen sollen jene Humortheorien erläutert werden, die für den ethnischen Humor relevant sind. Im Anschluss werde ich die Rolle des Komödianten als Kulturkritiker erläutern und das Material, sowie die Analysekriterien der Stand-up Comedy von Henning Wehn vorstellen. Im Hauptteil der Arbeit soll unter Zuhilfenahme dieser Kriterien eine lexikalische Analyse des Humors im Hinblick auf die verbale Repräsentation von Stereotypen erfolgen. Ein abschließendes Fazit wird die Ergebnisse der Humoranalyse in Hinblick auf die oben genannte Fragestellung auswerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Begriffliche Grundlagen
- Kultur
- Ethnizität
- Interkulturelle Kommunikation und Weltwissen
- Kategorisierung und Stereotype
- Humor als kulturelles Werkzeug
- Humortheorien und ethnischer Humor
- Inkongruenztheorie und ethnische Skripte
- Überlegenheitstheorie
- Humortheorien und ethnischer Humor
- Henning Wehn - „The German Comedy Ambassador to The United Kingdom“
- Der Komödiant als Kulturanthropologe
- Material und Methode
- Analysekriterien
- Analyse der Stand-up Comedy von Henning Wehn
- Repräsentation deutscher und britischer Stereotype
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Produktion ethnischer Stereotype in der Stand-up Comedy von Henning Wehn zu untersuchen. Dabei soll geklärt werden, ob ethnischer Humor zu einer (Re-)produktion von Stereotypen beiträgt und gegebenenfalls bestehende Vorurteile verfestigt.
- Bedeutung von Kultur und Ethnizität für die Entstehung von Stereotypen
- Rolle des Humors in der interkulturellen Kommunikation
- Analyse des Stand-up Comedy Formats als Sprachmedium
- Repräsentation von deutschen und britischen Stereotypen durch Henning Wehn
- Bedeutung von sprachlichen Mitteln für die Produktion von Stereotypen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit vor. Kapitel 1 definiert grundlegende Begriffe wie Kultur, Ethnizität und Interkulturelle Kommunikation, um den Prozess der Stereotypisierung im interkulturellen Kontext zu verdeutlichen. Kapitel 2 beleuchtet die Bedeutung des Humors für die Produktion von Stereotypen und erläutert relevante Humortheorien.
Kapitel 3 untersucht die Rolle des Komödianten als Kulturanthropologe am Beispiel von Henning Wehn. Kapitel 4 stellt das Material und die Analysekriterien für die Analyse der Stand-up Comedy von Henning Wehn vor. Im Hauptteil der Arbeit (Kapitel 5) wird die lexikalische Analyse des Humors im Hinblick auf die verbale Repräsentation von Stereotypen durchgeführt.
Schlüsselwörter
Ethnischer Humor, Stereotype, Stand-up Comedy, Interkulturelle Kommunikation, Kulturanthropologie, Henning Wehn, Sprachliche Mittel, Lexikalische Analyse, Deutsche Stereotype, Britische Stereotype.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzt Henning Wehn Stereotype in seiner Comedy?
Er reproduziert gezielt britische Klischees über Deutsche (z. B. Humorlosigkeit, Pünktlichkeit) und spiegelt gleichzeitig britische Eigenheiten aus deutscher Sicht.
Was ist ethnischer Humor?
Humor, der auf den vermeintlichen Eigenschaften oder dem Verhalten bestimmter ethnischer oder nationaler Gruppen basiert.
Verfestigt Comedy Vorurteile?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob das Auslachen von Stereotypen diese eher abbaut oder durch die ständige Wiederholung im Bewusstsein verfestigt.
Was besagt die Überlegenheitstheorie des Humors?
Sie besagt, dass wir über andere lachen, um uns selbst überlegen zu fühlen – ein häufiges Motiv bei Witzen über andere Nationen.
Welche Rolle spielt Sprache bei der Stereotypisierung?
Durch spezifische lexikalische Mittel und "ethnische Skripte" werden Erwartungshaltungen beim Publikum geweckt und bedient.
- Citar trabajo
- Henriette Frädrich (Autor), 2013, Ethnischer Humor. Zur Produktion von Stereotypen in Stand-up Comedy, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337284