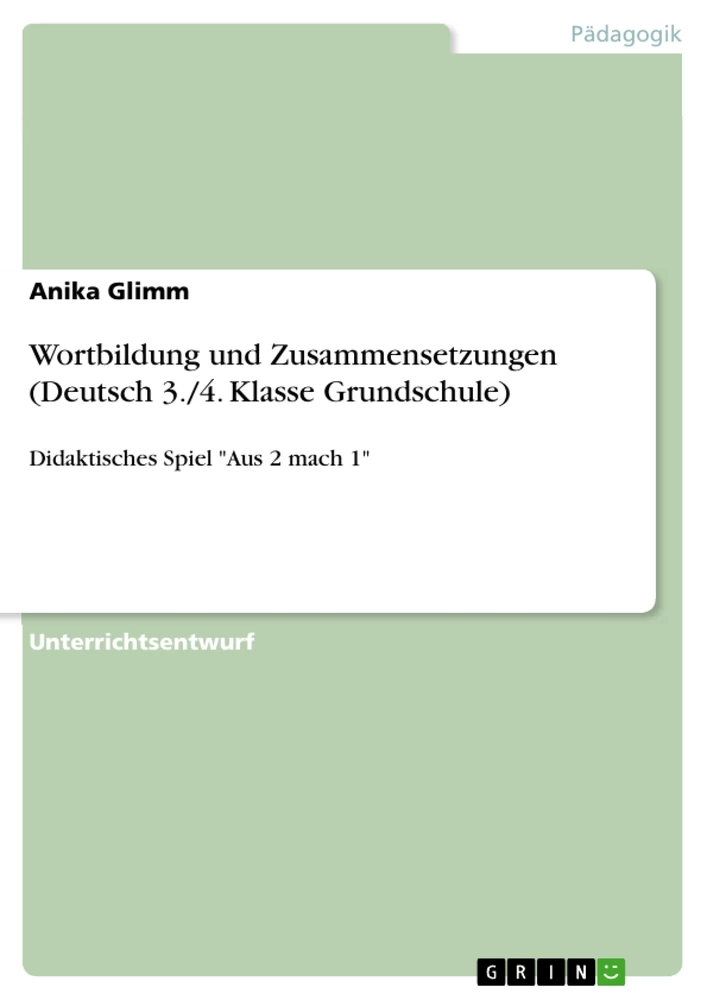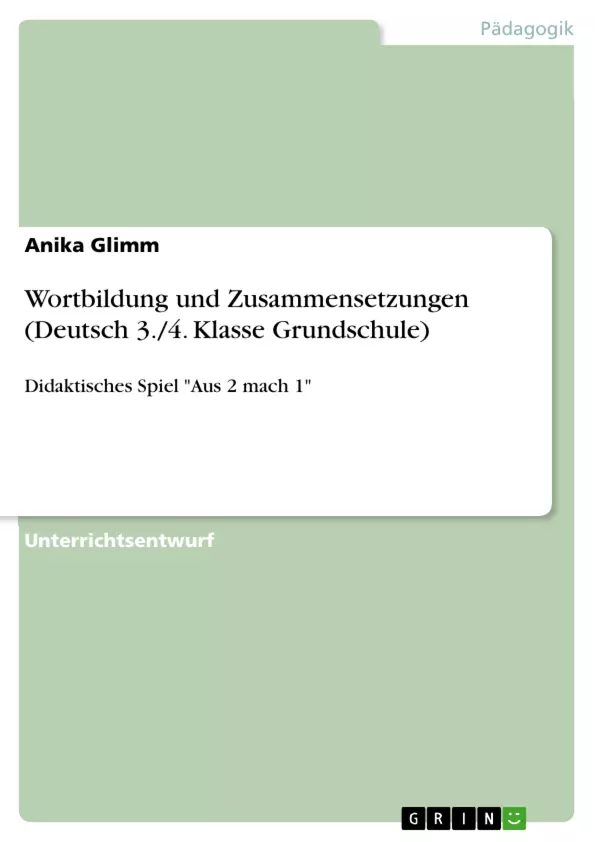Die Komposition (Wort-Zusammensetzung) ist eine der beiden zentralen Wortbildungsarten des Deutschen. Erweiterungen und Veränderungen des Wortschatzes der Gegenwartssprache finden größtenteils durch Kompositionsbildungen statt.
Zunächst werden die verschiedenen Arten von Kompositionen im Deutschen gezeigt. Danach stellt die Autorin Arbeitsblätter für die Klassen 3 und 4 vor sowie ihr selbst erdachtes Spiel "Aus 2 mach 1".
Die Aufgaben sollen dazu dienen, die Struktur der Bildung von Wörtern zu erkennen und diese morphologisch und semantisch zu analysieren. Desweiteren wird damit der Wortschatz der Kinder erweitert sowie auch der Erwerb der Wortbildungskompetenz unterstützt. Dabei ist es wichtig den Kindern die Wortbildungsregeln des Deutschen zu vermitteln, um eine produktive Anwendung gewährleisten zu können.
Im Folgenden möchte ich auf die von mir ausgearbeiteten Arbeitsblätter eingehen und in diesem Zusammenhang kurz die Ziele für die entsprechende Aufgabenstellung erläutern.
Die Arbeitsblätter beziehen sich auf den Themenbereich „Zusammensetzungen“ in den Klassenstufen 3 und 4. Gemäß der Einordnung in den „Rahmenlehrplan-Grundschule-Deutsch“ ist grundsätzlich zu sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Wortbildung, die allgemeine Ausbildung der Sprachhandlungskompetenz zum Ziel hat. Die Entwicklung der Kompetenzen hinsichtlich der Beherrschung der Standardsprache in Wort und Schrift und dem Erwerb von Lesefähigkeit und Lesestrategien sowie den sicheren Umgang, gelten als Grobziele des Deutschunterrichts. Für die Erlangung dieser Kompetenzen sind Kenntnisse über den Bau der Sprache notwendig, grammatische Inhalte tragen demzufolge zur Entwicklung von Sprachhandlungskompetenz bei.
Inhaltsverzeichnis
- Schwerpunkt 2: Wortbildung - Komposition.
- 1. Fachliche Analyse zur Wortbildung - Komposition.........
- 2. Grundschulrelevante Inhalte und Begriffe.
- 3. Angabe der Klassenstufe und der Voraussetzungen der Kinder laut Rahmenlehrplan....
- 4. Ziele für die Arbeit mit den ausgearbeiteten Aufgaben
- 5. Darstellung der Aufgaben mit Lösungen
- 6. Ziele für die Arbeit mit dem didaktischem Spiel
- 7. Darstellung des didaktischen Spiels .………………...
- Arbeit am Text…………………………………….
- 1. Angabe der Klassenstufe und der Voraussetzungen der Kinder laut Rahmenlehrplan....
- 2. Ziele für die Arbeit mit den ausgearbeiteten Aufgaben .....
- 3. Darstellung der Aufgaben zur Wortschatzarbeit und grammatischen Sachverhalten ......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Schwerpunkt dieses Textes liegt auf der Analyse der Wortbildung im Deutschen, insbesondere der Komposition. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Bildung von Komposita und deren Bedeutung in der deutschen Sprache zu erlangen.
- Fachliche Analyse der Komposition als Wortbildungsart
- Relevante Inhalte und Begriffe für den Grundschulunterricht
- Entwicklung didaktischer Materialien für den Sprachunterricht
- Darstellung von Aufgaben und Spielen zur Förderung der Wortbildungskompetenz
- Anwendungen der Komposition in verschiedenen Textformen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der fachlichen Analyse der Komposition als Wortbildungsart. Es werden die grundlegenden Konzepte der Komposition erläutert, wie die Unterscheidung zwischen Determinativ-, Exozentrischen-, Kopulativ-, Kontaminations- und Reduplikationskomposita.
Im zweiten Kapitel werden grundschulrelevante Inhalte und Begriffe im Kontext der Wortbildung - Komposition vorgestellt. Hier werden die Voraussetzungen der Kinder laut Rahmenlehrplan und die Ziele für die Arbeit mit den ausgearbeiteten Aufgaben erläutert.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Darstellung von Aufgaben und Lösungen, die für den Sprachunterricht im Bereich der Wortbildung - Komposition entwickelt wurden.
Das vierte Kapitel behandelt die Arbeit am Text. Es werden die Voraussetzungen der Kinder, die Ziele für die Arbeit mit den Aufgaben und die Darstellung der Aufgaben zur Wortschatzarbeit und grammatischen Sachverhalten vorgestellt.
Schlüsselwörter
Komposition, Wortbildung, Determinativkomposition, Exozentrische Komposition, Kopulativkomposition, Kontamination, Reduplikation, Grundschulunterricht, didaktische Materialien, Aufgaben, Spiele, Wortschatzarbeit, grammatische Sachverhalte, Textanalyse.
- Quote paper
- Anika Glimm (Author), 2011, Wortbildung und Zusammensetzungen (Deutsch 3./4. Klasse Grundschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337426