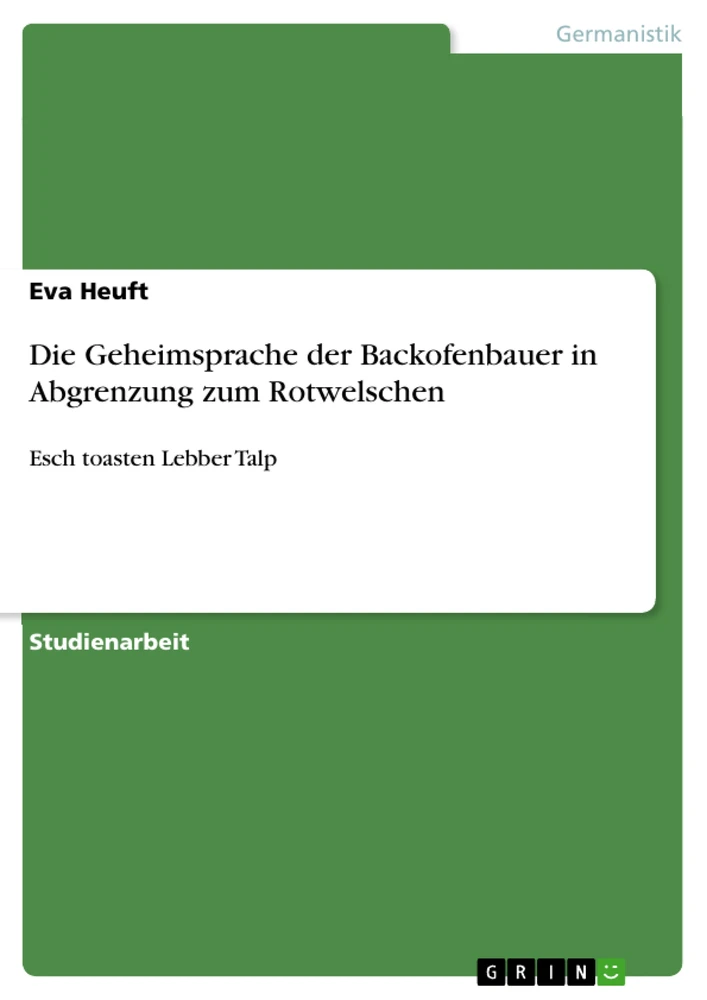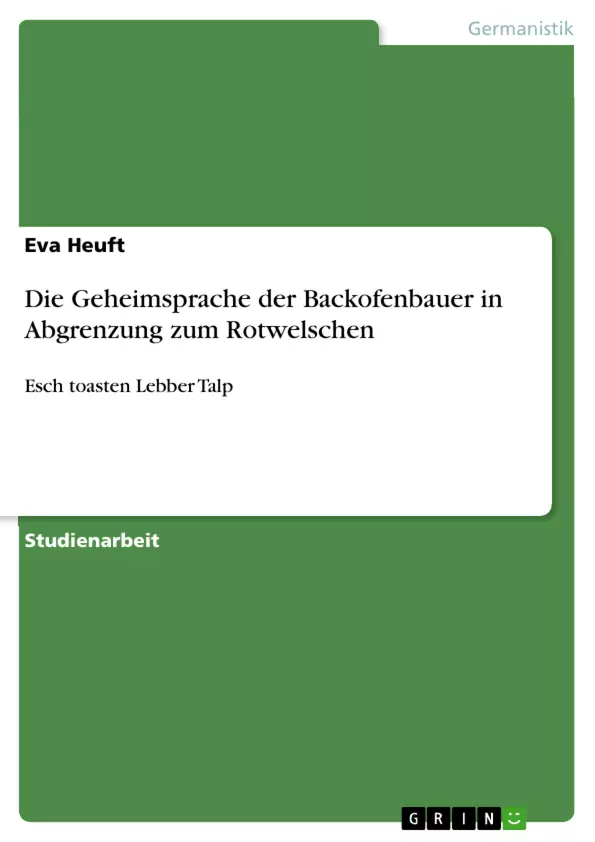Geheimsprachen dienen primär genau einem Zweck: Verhüllung der Information. Schon Kinder nutzen die bekannte Löffelsprache, um sich innerhalb des Freundeskreises zu unterhalten und somit ebenfalls eine Abgrenzung nach außen zu schaffen. Auch in der rechten Szene bedient man sich solcher Mittel, wobei man diese Signalworte und Symbole eher als Codes bezeichnen sollte.
Die bekannteste deutsche Geheimsprache ist das Rotwelsch, welche in Berichten des dreizehnten Jahrhunderts zum ersten Mal erwähnt wird und sich in mehrere Dialekte unterteilt, wie zum Beispiel Bargunsch, Schlausmen, Masematte oder Henese Fleck. Die Sprecher des Rotwelsch können laut Honnen grob in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zum einen handelt es sich bei den Sprechern um „berufsmäßige Bettler“ oder „organisierte Ganoven“ (Honnen 2000, 16), zum anderen um dem ambulanten Gewerbe zugehörige Handwerker und Händler, wie bspw. Kesselflicker, Korbmacher, uvm.
Zu diesem ambulanten Gewerbe zugeordneten Handwerker gehören auch die Backofenbauer aus Bell in der Nordosteifel, die zwar einen festen Wohnsitz in Bell hatten, aber durch die Notwendigkeit der Montage des Ofens vor Ort beim Auftraggeber auch gezwungen waren, mehrere Wochen oder Monate unterwegs zu sein.
Im Laufe der Zeit entwickelten diese Backofenbauer eine Geheimsprache, die heute noch von einigen Sprechern in Bell beherrscht wird: das sog. Lebber Talp. Der Name selbst ist dabei Programm. Der örtliche Dialekt, das Beller Platt, wird rückwärts gesprochen. In einiger Literatur zum Rotwelsch wird auch das Lebber Talp als Rotwelschdialekt genannt. Daher soll in dieser Arbeit herausgestellt werden, dass es sich bei der Geheimsprache der Backofenbauer um keinen Rotwelschdialekt handelt, der sich ohne Probleme in die Reihe dieser Dialekte einfügen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. GEHEIMSPRACHEN UND IHRE FUNKTION
- 3. DIE SPRACHE DER BELLER BACKOFENBAUER
- 4. ABGRENZUNG ZUM ROTWELSCHEN
- 5. FAZIT: DER ROTWELSCHDIALEKT, DER KEINER IST
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Geheimsprache der Backofenbauer aus Bell in der Nordosteifel, bekannt als "Lebber Talp". Ziel ist es, die Sprache in ihrer grammatischen Struktur zu beschreiben und ihre Abgrenzung zum Rotwelschen herauszustellen. Hierbei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Sprachsysteme untersucht, um zu zeigen, dass sich das "Lebber Talp" nicht als Rotwelschdialekt einordnen lässt.
- Die Funktion von Geheimsprachen und ihre Verwendung in verschiedenen Kontexten
- Die soziokulturelle Entstehung und Entwicklung des "Lebber Talp"
- Die grammatische Struktur der Sprache der Backofenbauer
- Die Abgrenzung des "Lebber Talp" vom Rotwelschen
- Die Rolle der Geheimsprache als Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit und sozialer Abgrenzung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt die Geheimsprache der Backofenbauer aus Bell, das "Lebber Talp", vor und legt die Zielsetzung sowie die Forschungsmethodik dar.
- Kapitel 2: Geheimsprachen und ihre Funktion: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Geheimsprache und beleuchtet die verschiedenen Funktionen, die solchen Sprachsystemen zukommen. Es wird gezeigt, dass Geheimsprachen sowohl zur Verhüllung von Informationen als auch zur Abgrenzung und Integration von Gruppen dienen können.
- Kapitel 3: Die Sprache der Beller Backofenbauer: Dieses Kapitel stellt die Backofenbauer aus Bell und ihren soziokulturellen Hintergrund vor. Es beschreibt die Entstehung der Geheimsprache "Lebber Talp" und analysiert ihre grammatische Struktur.
Schlüsselwörter
Geheimsprache, Rotwelsch, Dialekt, Sprachvariation, Lebber Talp, Beller Platt, Backofenbauer, Soziolekt, Gruppensprache, Abgrenzung, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Lebber Talp"?
Es ist die Geheimsprache der Backofenbauer aus Bell, bei der der örtliche Dialekt (Beller Platt) nach bestimmten Regeln, oft rückwärts, gesprochen wird.
Warum entwickelten die Backofenbauer eine eigene Sprache?
Zur Geheimhaltung von Fachwissen und zur internen Verständigung während ihrer wochenlangen Montagen bei auswärtigen Kunden.
Ist Lebber Talp ein Dialekt des Rotwelschen?
Die Arbeit argumentiert, dass es kein Rotwelschdialekt ist, da es auf der Umkehrung des lokalen Dialekts basiert und eine andere soziokulturelle Wurzel hat.
Was ist Rotwelsch?
Die bekannteste deutsche Geheimsprache, die seit dem 13. Jahrhundert von Bettlern, Ganoven und ambulanten Handwerkern zur Verschlüsselung von Informationen genutzt wurde.
Welche Funktion haben Geheimsprachen allgemein?
Sie dienen der Verhüllung von Informationen vor Außenstehenden sowie der Stärkung der Gruppenzugehörigkeit und sozialen Identität.
- Quote paper
- Eva Heuft (Author), 2016, Die Geheimsprache der Backofenbauer in Abgrenzung zum Rotwelschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337475