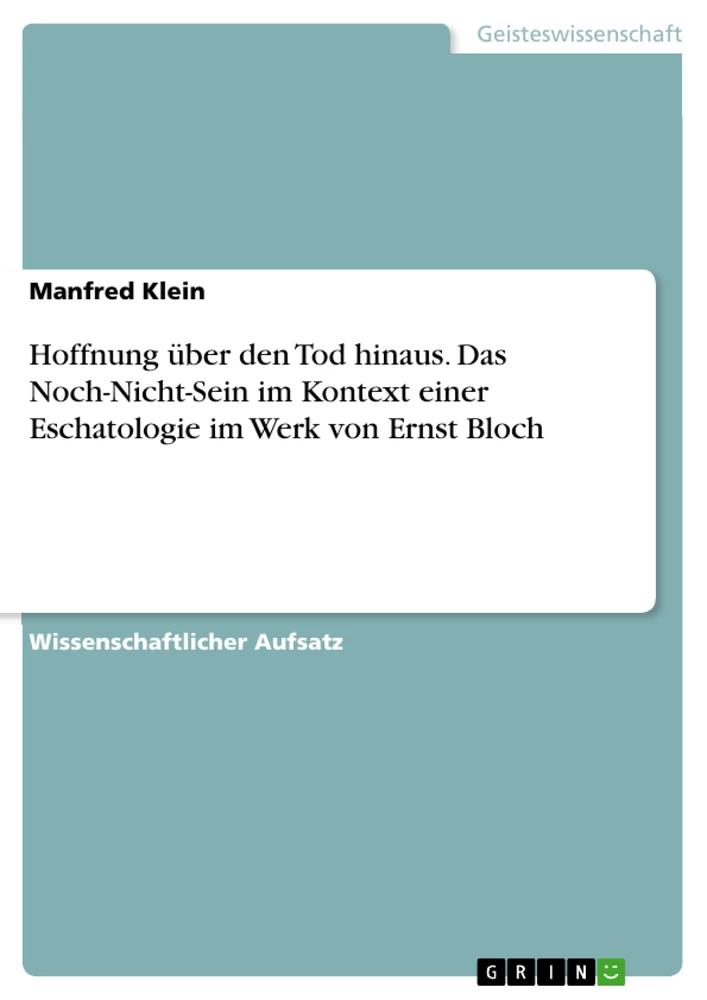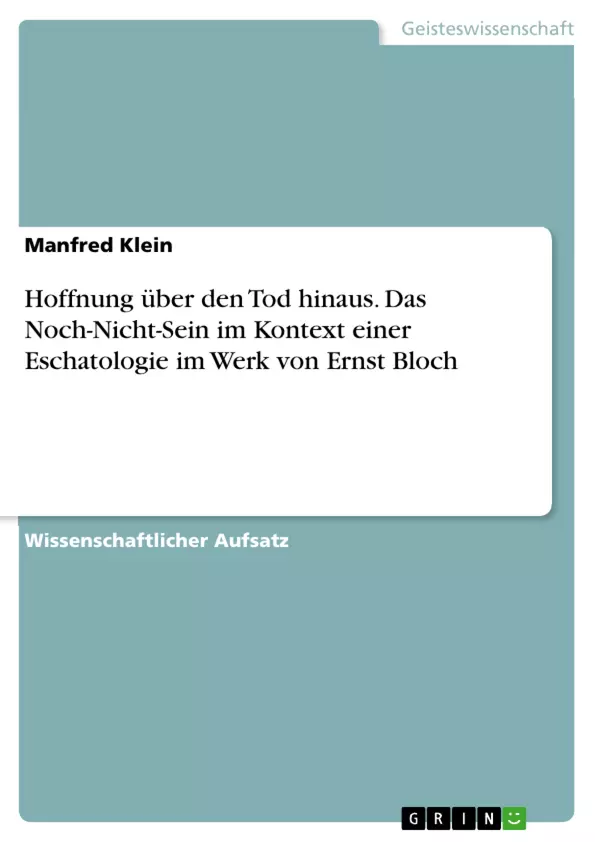Ernst Bloch geht es in seinem Werk um Hoffnung auf eine bessere Welt, wobei sich die Frage nach einer Eschatologie im Kontext des Sozialismus stellt, so wie er ihn verwirklicht sehen will, also nach einem Ende aller Dinge, seien sie auch immanent intendiert. Der Mensch bekommt einen Ausblick auf das, was ihm hinsichtlich dieser Erwartungen begegnen könnte, aber noch nicht konkret erfassbar ist.
Auch die Theologie interessierte sich für Blochs Zukunftsaussichten, was Jürgen Moltmann schließlich zu seiner Theologie der Hoffnung zusammenfasste. Bloch bedient sich über weite Strecken theologischer Termini und schreibt in teils christlichem Vokabular, was die Frage nach einer Verbindung von Blochs Denken in die Theologie hinein aufkommen lässt. Auch die Problematik des Lebensendes spielt eine besondere Rolle in Blochs Philosophie, unterscheidet sich aber letztlich doch exorbitant von theologischen Intentionen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Christliche Eschatologie
- Eschatotologie in der Ökonomiekritik von Karl Marx
- Das Noch-Nicht-Sein
- Utopien nach dem Tod
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Rolle der Eschatologie im Werk von Ernst Bloch, insbesondere im Kontext des Sozialismus und der Hoffnung auf eine bessere Welt. Bloch entwickelte eine Philosophie, die sich mit dem "Noch-Nicht-Sein" und dem Streben nach einem besseren Leben befasst, welches sich von der passiven Sichtweise der Existenzphilosophie unterscheidet.
- Blochs Konzeption des "Noch-Nicht-Seins" und seine Beziehung zur christlichen Eschatologie
- Die Bedeutung der Hoffnung in Blochs Philosophie und ihre Verbindung zum Sozialismus
- Die Rolle des Todes in Blochs Denken und seine Abgrenzung von theologischen Interpretationen
- Der Einfluss von Karl Marx und Friedrich Engels auf Blochs Eschatologie-Verständnis
- Die Frage nach der Verbindung von Blochs Philosophie mit der christlichen Eschatologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Eschatologie ein und stellt die Frage nach der Zukunft des Menschen und der Welt. Sie zeigt die unterschiedlichen Perspektiven auf die "letzten Dinge" auf, insbesondere im Rahmen des christlichen Glaubens und der Philosophie von Karl Marx und Ernst Bloch.
- Christliche Eschatologie: Dieses Kapitel beschreibt die christlichen Glaubensvorstellungen über die "letzten Dinge" und die Bedeutung des Todes im christlichen Kontext. Es wird die Frage nach dem Jenseits und dem Schicksal des Menschen nach dem Tod behandelt.
- Eschatotologie in der Ökonomiekritik von Karl Marx: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Eschatologie in der Ökonomiekritik von Karl Marx und zeigt auf, wie Marx die "letzten Dinge" im Kontext seiner Gesellschaftsanalyse versteht.
- Das Noch-Nicht-Sein: Dieses Kapitel stellt Blochs Konzept des "Noch-Nicht-Seins" vor und erklärt, wie es die Hoffnung auf eine bessere Zukunft begründet. Es zeigt, wie Bloch die "Mängel" der gegenwärtigen Welt als Ausgangspunkt für die Hoffnung auf Veränderung begreift.
- Utopien nach dem Tod: Dieses Kapitel befasst sich mit Blochs Visionen einer Welt nach dem Tod und untersucht, wie er sich das "Jenseits" vorstellt. Es wird die Frage nach der Bedeutung des Todes für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft behandelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen des Textes sind: Eschatologie, Hoffnung, Noch-Nicht-Sein, Sozialismus, Ernst Bloch, Christentum, Karl Marx, Tod, Jenseits, Utopie, Philosophie, Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ernst Bloch unter dem „Noch-Nicht-Sein“?
Es beschreibt einen Zustand der Erwartung und des Ausblicks auf eine bessere Welt, die zwar intendiert, aber noch nicht konkret fassbar oder realisiert ist.
Wie verbindet Bloch Sozialismus und Eschatologie?
Bloch sieht im Sozialismus die Möglichkeit einer innerweltlichen Erfüllung utopischer Hoffnungen, was er oft mit theologischen Begriffen (Eschatologie) beschreibt.
Welche Rolle spielt der Tod in Blochs Philosophie?
Der Tod gilt als Grenze, doch Blochs Denken sucht nach Utopien, die „über den Tod hinaus“ Hoffnung geben, wobei er sich deutlich von rein religiösen Jenseitsvorstellungen abgrenzt.
Was ist Jürgen Moltmanns „Theologie der Hoffnung“?
Moltmann griff Blochs Impulse auf und entwickelte daraus eine christliche Theologie, die die Hoffnung auf die Zukunft Gottes in das Zentrum stellt.
Wie beeinflusste Karl Marx das Werk von Ernst Bloch?
Marx’ Ökonomiekritik bildet das Fundament für Blochs Verständnis gesellschaftlicher Veränderung und der Hoffnung auf das Ende der Entfremdung.
- Arbeit zitieren
- Dr. Manfred Klein (Autor:in), 2016, Hoffnung über den Tod hinaus. Das Noch-Nicht-Sein im Kontext einer Eschatologie im Werk von Ernst Bloch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337562