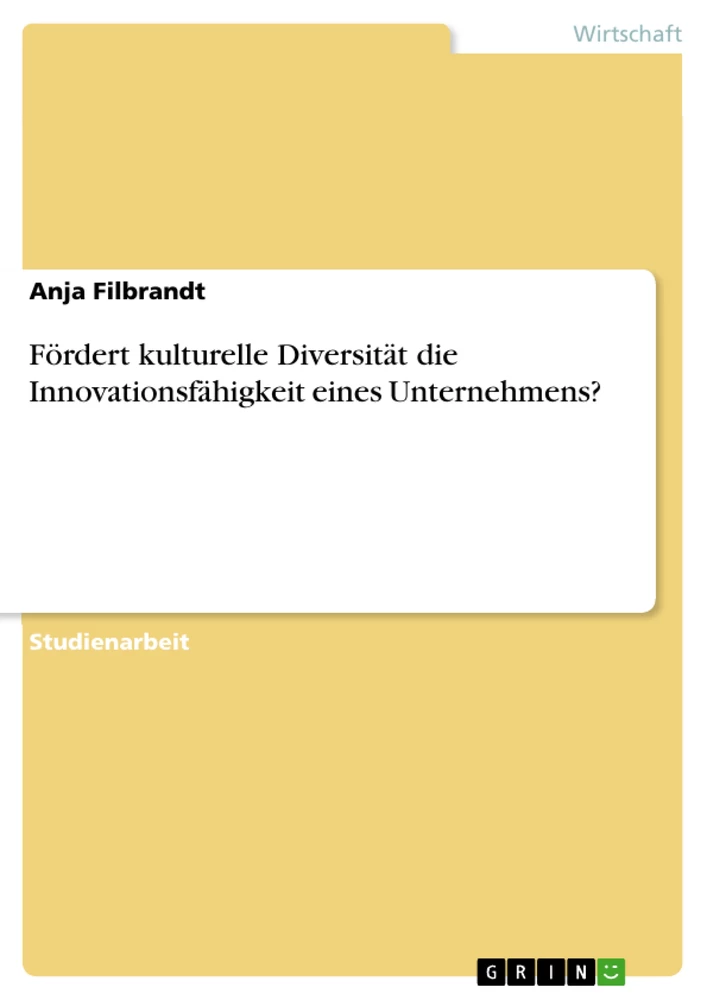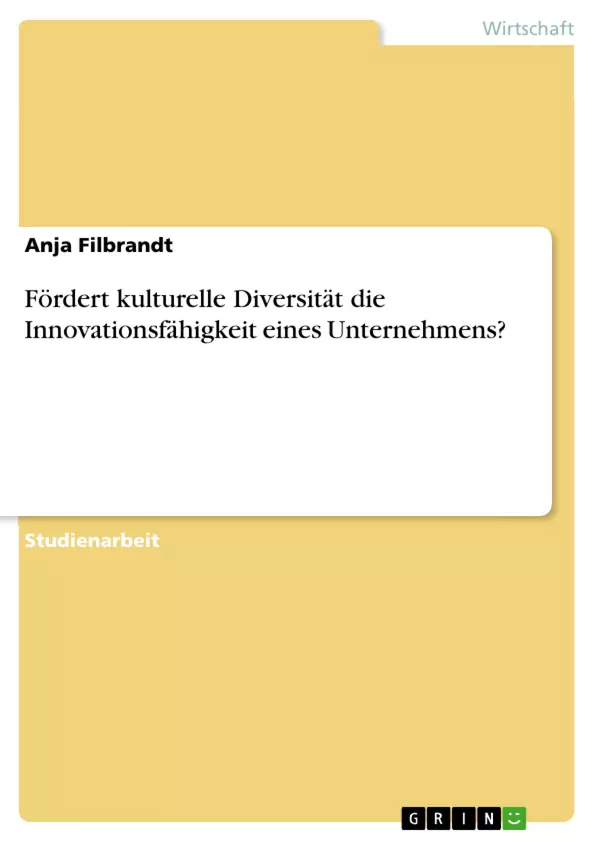Die Betrachtung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens im interkulturellen Umfeld ist bedeutsam für die Wirtschaft Deutschlands, da Innovation über den wirtschaftlichen Erfolg im mikro- und makroökonomischen Kontext entscheidet, und Multikulturalität unter anderem durch die Flüchtlingsbewegung eine aktuelle Rahmenbedingung für deutsche Unternehmen darstellt. Von den Flüchtlingen wird sogar angenommen, dass diese die deutsche Wirtschaft ankurbeln werden. In dieser Hausarbeit wird erörtert, wie sich die einhergehende kulturelle Diversität auf die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens auswirkt.
Um diese Fragestellung zu erörtern, werden im Folgenden zunächst die Begriffe Innovation, Innovationsfähigkeit, Kultur und kulturelle Diversität genau definiert. Anschließend werden wichtige innovationsfördernde Faktoren sowie einige Einflussbereiche von Kultur zusammengefasst, um auf Grundlage dessen positive wie auch negative Einflüsse von kultureller Diversität auf die Innovationsfähigkeit zu eruieren. Abschließend wird auf Grundlage der vorangegangenen Erörterungen die ursprüngliche Fragestellung beantwortet.
„Innovation distinguishes between a leader and a follower“
Dieses ist nur eines der unzähligen Zitate erfolgreicher Geschäftsleute, die alle eines verdeutlichen wollen: Innovation ist ein entscheidendes Erfolgskriterium für Unternehmen. Auch jegliche Literatur zu dem Thema scheint darüber einig, dass Innovationen maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens beitragen. Jaberg & Stern ziehen zur Begründung der Wichtigkeit von Innovation zunächst die Rahmenbedingungen in Betracht, welche ein Unternehmen in heutigen Zeiten umgeben:
Globalisierung: Die weltweite Vernetzung lässt auch die Konkurrenz steigen und verschärft somit den Wettbewerb.
Beschleunigte Entwicklung von verfügbarem Wissen, technischen Möglichkeiten und Kundenansprüchen: Durch die schnelle Weiterentwicklung dieser Faktoren geraten Unternehmen unter Zeitdruck zur Anpassung an den Markt.
Internet: Die rasante Verbreitung von Informationen im weltweiten Netz führt zu einer hohen Markttransparenz und einen verbesserten Austausch unter den Kunden.
Diese Rahmenbedingungen zwingen zu permanenter Innovation, da ein stagnierendes Unternehmen schnell von Wettbewerben überholt werden würde und somit nicht im Markt bestehen bleiben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung und Fragestellung dieser Arbeit
- Bedeutung von Innovationsfähigkeit
- Kulturelle Diversität im aktuellen Kontext
- Aufbau dieser Arbeit
- Hauptteil
- Definitionen und Abgrenzungen
- Innovation
- Innovationsfähigkeit
- Kultur und Kulturelle Diversität
- Erfolgsfaktoren für Innovationsfähigkeit
- Dimensionen von Kultur
- Positive Einflüsse kultureller Diversität auf Innovationsfähigkeit
- Negative Einflüsse kultureller Diversität auf Innovationsfähigkeit
- Schluss
- Zusammenfassung
- Beantwortung der Fragestellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss kultureller Diversität auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Innovationen für den Unternehmenserfolg im Kontext der Globalisierung und des demografischen Wandels. Darüber hinaus werden die positiven und negativen Auswirkungen kultureller Diversität auf die Innovationsfähigkeit untersucht.
- Bedeutung von Innovationen für den Unternehmenserfolg
- Einfluss der Globalisierung auf die Innovationsfähigkeit
- Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Zusammensetzung der Belegschaft
- Positive Einflüsse kultureller Diversität auf die Innovationsfähigkeit
- Negative Einflüsse kultureller Diversität auf die Innovationsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Innovationen für den Unternehmenserfolg und die Herausforderungen, die sich aus der Globalisierung, der beschleunigten Entwicklung von Wissen und den veränderten Kundenansprüchen ergeben. Es wird deutlich, dass Innovationen als Schlüsselfaktor für das Überleben und den Erfolg von Unternehmen in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld betrachtet werden müssen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Kultur und kultureller Diversität im Kontext der Innovationsfähigkeit. Es werden verschiedene Dimensionen von Kultur aufgezeigt und die positiven und negativen Auswirkungen kultureller Diversität auf die Innovationsfähigkeit untersucht.
Schlüsselwörter
Innovation, Innovationsfähigkeit, Kulturelle Diversität, Globalisierung, Demografischer Wandel, Unternehmenserfolg, Wettbewerbsvorteil, Interkulturelle Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen kulturelle Diversität und Innovationsfähigkeit zusammen?
Kulturelle Diversität bringt unterschiedliche Perspektiven und Problemlösungsansätze in ein Unternehmen ein, was die Innovationskraft stärken kann, aber auch Herausforderungen in der Kommunikation mit sich bringt.
Warum ist Innovation für Unternehmen heute überlebenswichtig?
Durch Globalisierung, schnellen Wissenszuwachs und hohe Markttransparenz (Internet) stehen Unternehmen unter permanentem Zeitdruck, sich anzupassen, um nicht vom Wettbewerb überholt zu werden.
Welche positiven Einflüsse hat Diversität auf Innovation?
Diversität fördert die Kreativität durch "Out-of-the-box"-Denken, verbessert das Verständnis für internationale Märkte und erhöht die Flexibilität in Teams.
Welche negativen Einflüsse können durch kulturelle Diversität entstehen?
Mögliche Barrieren sind Missverständnisse in der Kommunikation, Konflikte aufgrund unterschiedlicher Wertevorstellungen und ein erhöhter Zeitaufwand bei der Entscheidungsfindung.
Was versteht man unter interkultureller Kompetenz im Unternehmen?
Es ist die Fähigkeit, in einem multikulturellen Umfeld effektiv zu kommunizieren und zu arbeiten, um die Vorteile der Diversität für den Unternehmenserfolg zu nutzen.
- Arbeit zitieren
- Anja Filbrandt (Autor:in), 2015, Fördert kulturelle Diversität die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337604