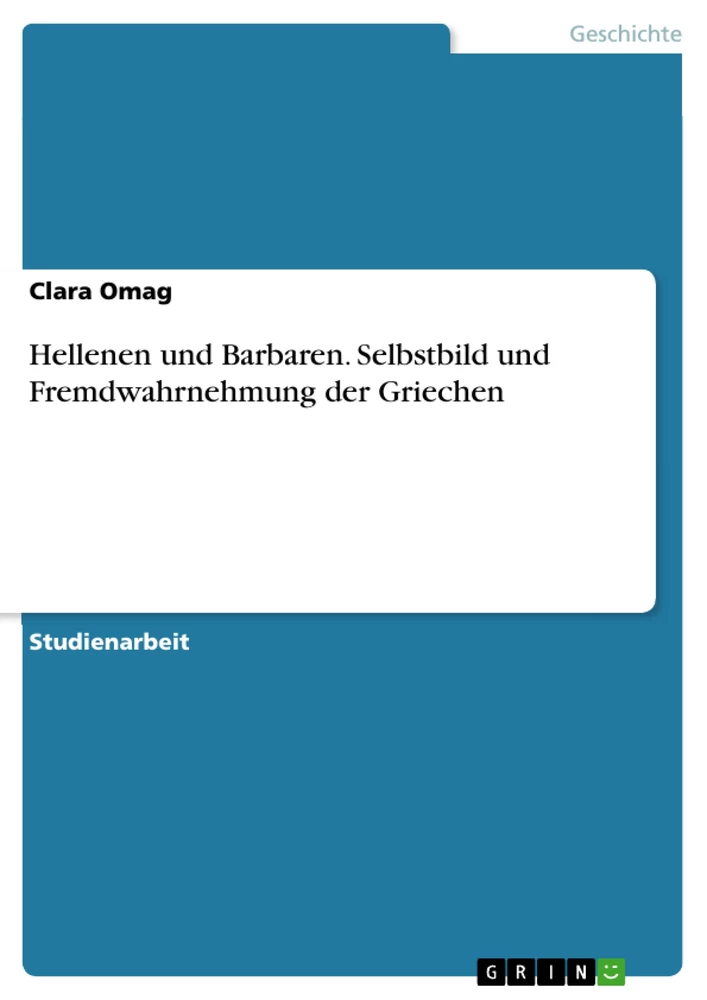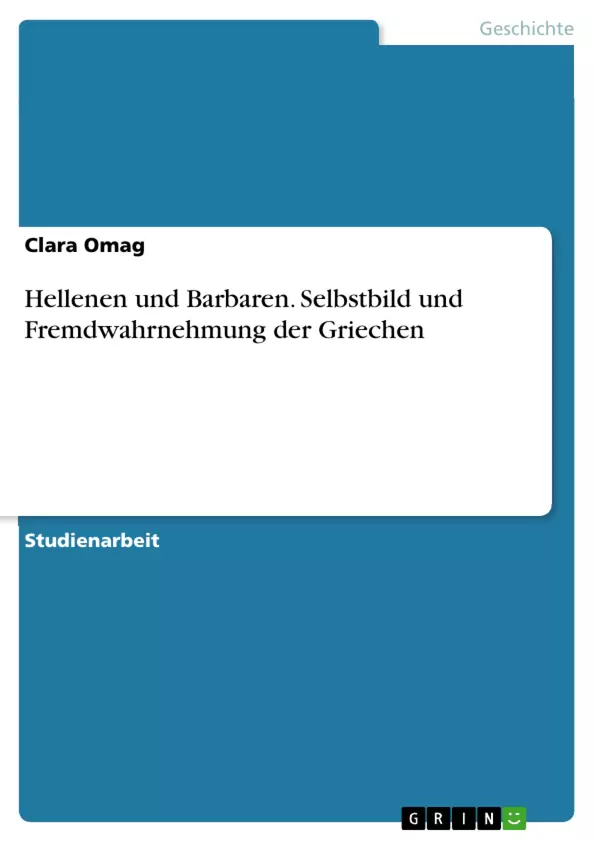Diese Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste beschäftigt sich mit dem Ursprung und dem Wandel des Barbarenbegriffes, während der zweite genauer auf das neue Selbstbewusstsein der Griechen sowie auch auf das daraus wachsende Überlegenheitsgefühl über alle anderen Völker eingeht. So wird die Entwicklung dieses Wortes umfangreich beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Ursprung, Bedeutung und Wandel des Barbarenbegriffes
- Das griechische Selbstbewusstsein und die Wahrnehmung des Fremden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ursprung und die Entwicklung des Begriffs „Barbar“ in der griechischen Antike. Sie analysiert, wie sich die Bedeutung des Wortes im Laufe der Zeit veränderte und wie dieses Verständnis mit dem Selbstbild der Griechen und ihrer Wahrnehmung anderer Kulturen zusammenhing.
- Der Ursprung des Wortes „Barbar“ und seine ursprüngliche Bedeutung.
- Die Rolle der Perserkriege und des Peloponnesischen Krieges in der Entwicklung des Barbarenbegriffes.
- Das wachsende Selbstbewusstsein der Griechen und die Entstehung eines Überlegenheitsgefühls gegenüber anderen Völkern.
- Die Auswirkungen des veränderten Selbstbildes auf die griechische Kultur und Gesellschaft.
- Die Abgrenzung der Griechen von den „Barbaren“ und die damit verbundenen kulturellen und politischen Implikationen.
Zusammenfassung der Kapitel
Ursprung, Bedeutung und Wandel des Barbarenbegriffes: Dieser Abschnitt erforscht die Etymologie des Begriffs „Barbar“, der älter ist als die Selbstbezeichnung der Griechen als „Hellenen“. Die These einer semitischen Herkunft wird verworfen, stattdessen wird eine indogermanische Wurzel mit der Bedeutung „stammelnd, stotternd, unverständlich“ favorisiert. Die frühesten Erwähnungen bei Homer werden analysiert, wobei die Bedeutung des Begriffs im Kontext der Karer und Trojaner diskutiert wird. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen und die weitgehende Neutralität der frühen Verwendung. Die Rolle von Hekataios, Simonides, Aischylos und Herodot wird beleuchtet, wobei betont wird, dass der Begriff zunächst alle nicht-griechischsprachigen Gruppen umfasste, ohne die spätere negative Konnotation zu tragen. Die Perserkriege werden als Wendepunkt dargestellt, in dem der Sieg der Griechen ihr Selbstbewusstsein stärkte und zur Herausbildung des Namens „Hellenen“ und dem damit verbundenen Gefühl der Abgrenzung von den „Barbaren“ führte. Die fließenden Grenzen des Begriffs „Hellene“ werden ebenfalls thematisiert.
Das griechische Selbstbewusstsein und die Wahrnehmung des Fremden: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Entwicklung des griechischen Selbstbewusstseins und die damit verbundene Wahrnehmung der „Barbaren“ nach dem Peloponnesischen Krieg. Die Niederlage im Krieg wird als Katalysator für ein neu gefundenes Überlegenheitsgefühl interpretiert, welches als Kompensation für die politische Schwäche diente. Die Arbeit hebt die besonderen Eigenschaften der griechischen Kultur hervor, wie die Polis, Bildung, Sprache, Kunst und Religion, die die „Barbaren“ angeblich nicht besaßen. Die Abgrenzung von den „Barbaren“ wird als zentraler Aspekt der griechischen Identität präsentiert, mit Betonung auf die Sprache und Bildung als wichtigste Unterscheidungsmerkmale. Die Exklusivität der griechischen politischen und kulturellen Einrichtungen wird diskutiert, ebenso wie die Vorstellung von einer körperlichen Überlegenheit der griechischen Krieger.
Schlüsselwörter
Hellenen, Barbaren, Selbstbild, Fremdwahrnehmung, Perserkriege, Peloponnesischer Krieg, griechische Kultur, Identität, Überlegenheitsgefühl, Sprache, Bildung, Politik.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Ursprung und Entwicklung des Barbarenbegriffes in der griechischen Antike
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Ursprung und die Entwicklung des Begriffs „Barbar“ in der griechischen Antike. Sie analysiert, wie sich die Bedeutung des Wortes im Laufe der Zeit veränderte und wie dieses Verständnis mit dem Selbstbild der Griechen und ihrer Wahrnehmung anderer Kulturen zusammenhing. Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen dem griechischen Selbstverständnis und der Abgrenzung von den als "Barbaren" bezeichneten Völkern.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den Ursprung des Wortes „Barbar“ und seine ursprüngliche Bedeutung, die Rolle der Perserkriege und des Peloponnesischen Krieges in der Entwicklung des Begriffs, das wachsende Selbstbewusstsein der Griechen und die Entstehung eines Überlegenheitsgefühls, die Auswirkungen des veränderten Selbstbildes auf die griechische Kultur und Gesellschaft sowie die Abgrenzung der Griechen von den „Barbaren“ und die damit verbundenen kulturellen und politischen Implikationen.
Wie wird der Ursprung des Wortes „Barbar“ behandelt?
Der Abschnitt zum Ursprung erforscht die Etymologie des Begriffs „Barbar“. Eine semitische Herkunft wird verworfen, stattdessen wird eine indogermanische Wurzel mit der Bedeutung „stammelnd, stotternd, unverständlich“ favorisiert. Die frühesten Erwähnungen bei Homer werden analysiert, und die unterschiedlichen Interpretationen und die weitgehende Neutralität der frühen Verwendung werden beleuchtet. Die Rolle von Hekataios, Simonides, Aischylos und Herodot wird untersucht, wobei betont wird, dass der Begriff zunächst alle nicht-griechischsprachigen Gruppen umfasste, ohne die spätere negative Konnotation zu tragen. Die Perserkriege werden als Wendepunkt dargestellt.
Welche Rolle spielen die Perserkriege und der Peloponnesische Krieg?
Die Perserkriege werden als Wendepunkt dargestellt, in dem der Sieg der Griechen ihr Selbstbewusstsein stärkte und zur Herausbildung des Namens „Hellenen“ und dem damit verbundenen Gefühl der Abgrenzung von den „Barbaren“ führte. Der Peloponnesische Krieg wird als Katalysator für ein neu gefundenes Überlegenheitsgefühl interpretiert, welches als Kompensation für die politische Schwäche diente.
Wie wird das griechische Selbstbewusstsein dargestellt?
Der Abschnitt zum griechischen Selbstbewusstsein konzentriert sich auf die Entwicklung des Selbstverständnisses und die damit verbundene Wahrnehmung der „Barbaren“ nach dem Peloponnesischen Krieg. Die Arbeit hebt die besonderen Eigenschaften der griechischen Kultur hervor (Polis, Bildung, Sprache, Kunst und Religion), die die „Barbaren“ angeblich nicht besaßen. Die Abgrenzung von den „Barbaren“ wird als zentraler Aspekt der griechischen Identität präsentiert, mit Betonung auf Sprache und Bildung als wichtigste Unterscheidungsmerkmale.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Hellenen, Barbaren, Selbstbild, Fremdwahrnehmung, Perserkriege, Peloponnesischer Krieg, griechische Kultur, Identität, Überlegenheitsgefühl, Sprache, Bildung, Politik.
Welche Kapitel sind enthalten?
Die Arbeit enthält Kapitel zu "Ursprung, Bedeutung und Wandel des Barbarenbegriffes" und "Das griechische Selbstbewusstsein und die Wahrnehmung des Fremden".
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
- Citation du texte
- Clara Omag (Auteur), 2012, Hellenen und Barbaren. Selbstbild und Fremdwahrnehmung der Griechen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337690