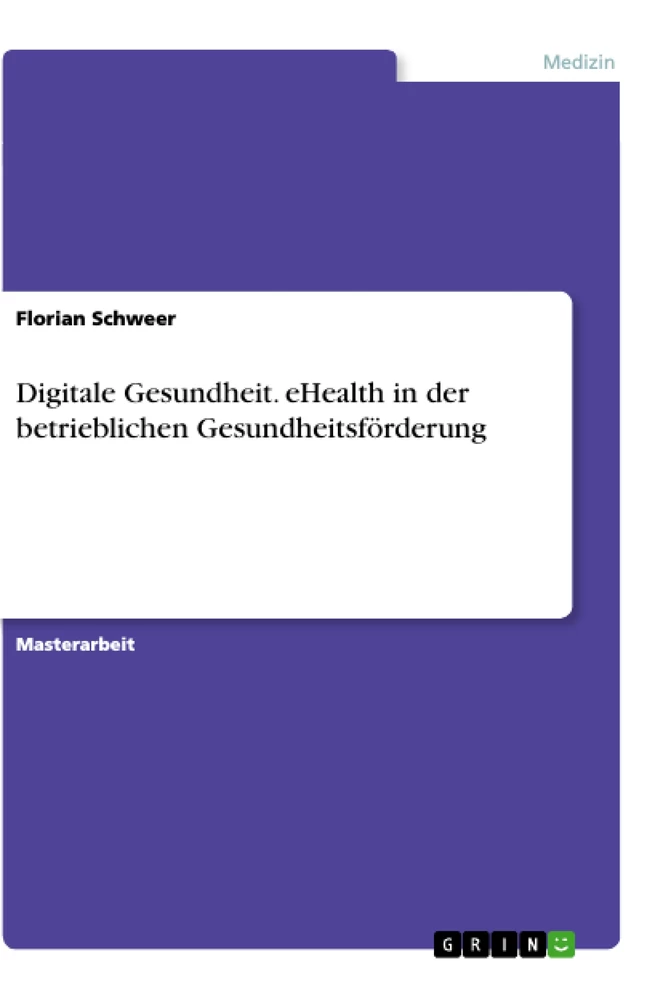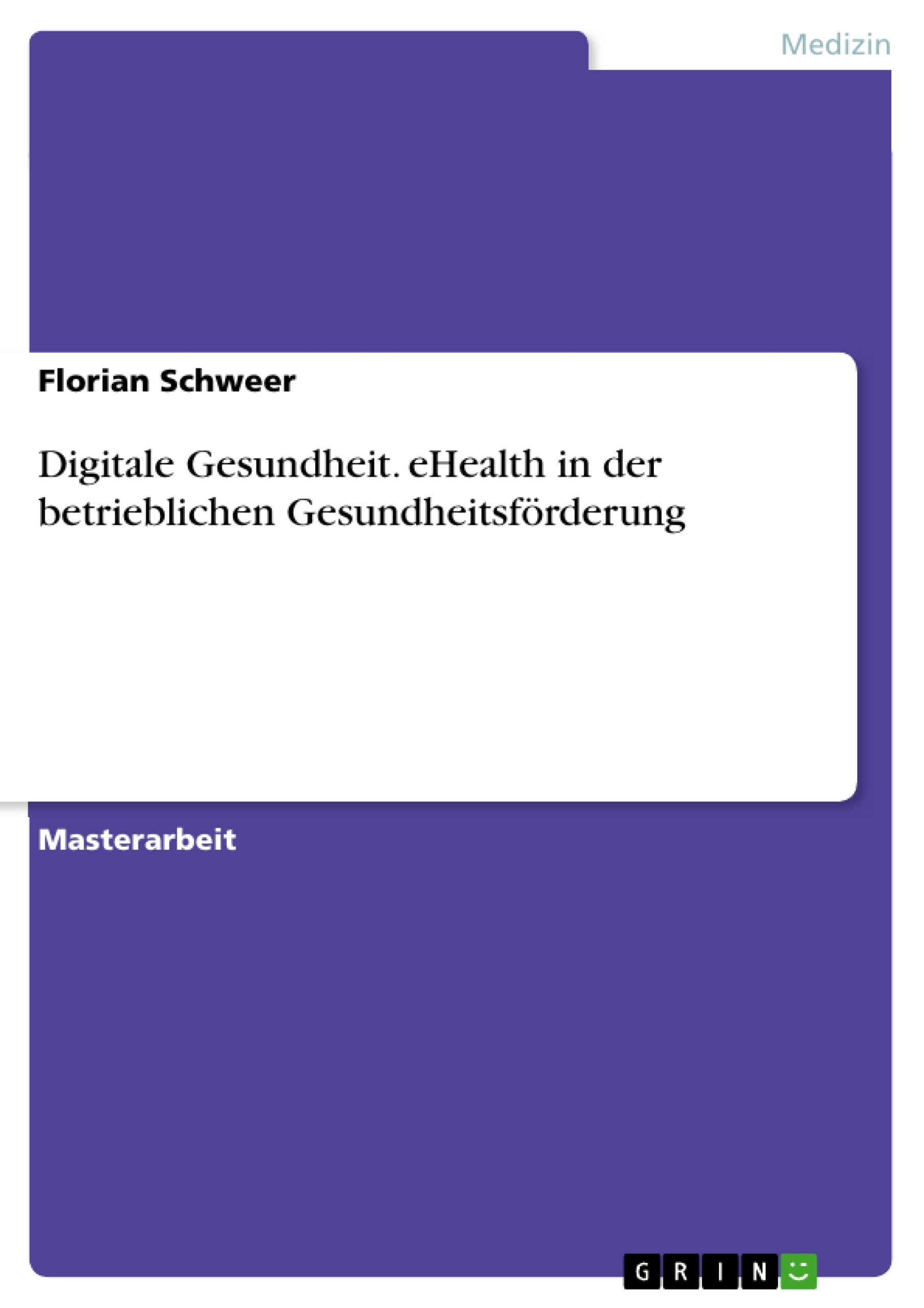Aufgrund des technologischen Fortschrittes erfolgt eine immer stärker werdende Digitalisierung unseres Lebens, welche auch bereits den Bereich der Gesundheit erreicht hat, indem beispielsweise mittels Wearables oder Smartphone-Apps verschiedenste Vitalparameter von jedem selbst gemessen oder Informationen zu unzähligen Themen des Gesundheitsbereiches für jeden und jederzeit online im Internet abrufbar sind. Unterstützt durch das wachsende Gesundheitsbewusstsein unserer Gesellschaft hat diese Entwicklung ein horrendes Tempo erreicht und unter anderem den Begriff der „digitalen Gesundheit“ geschaffen. Doch nicht nur im privaten Bereich, sondern gerade auch für die betriebliche Gesundheitsförderung, welche zum Ziel hat, die Gesundheit der Menschen am Arbeitsplatz durch verschiedenste Maßnahmen zu verbessern, bietet diese Entwicklung ein großes Potential. Dienen die Innovationen der digitalen Gesundheit der Privatperson hauptsächlich dem persönlichen Interesse, so können sie im Bereich der BGF möglicherweise zukünftig zum Erfolgsfaktor werden. Vor allem für externe BGF-Dienstleister ist es deshalb wichtig, sich mit dieser Thematik zu befassen, zukünftige Entwicklungen möglichst gut vorherzusagen und diese Informationen für sich selbst zu nutzen, um sich von Mitbewerbern abzuheben und so im Markt erfolgreich zu sein.
Diese Arbeit zeigt zum einen auf, wie die digitale Gesundheit in Zukunft die BGF beeinflussen könnte. Mithilfe der Definition des Einflusses mittels der Anwendung der Delphi-Methode wurde eine Prognose in Form eines möglichst konkreten Zukunftsbildes formuliert. Außerdem wurde nebst der Formulierung des Zukunftsbildes auch dessen Qualität bestimmt. Zum anderen wurden konkrete Handlungsempfehlungen für BGF-Dienstleister erarbeitet und nach Wichtigkeit rangiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 2.1 Zukunftsbild
- 2.1.1 Inhalt
- 2.1.2 Qualität des Zukunftsbildes
- 2.2 Handlungsempfehlungen
- 2.1 Zukunftsbild
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Gesundheit, Arbeit und BGF
- 3.1.1 Gesundheit
- 3.1.2 Arbeit und Gesundheit
- 3.1.3 BGF
- 3.2 Digitale Gesundheit
- 3.3 Delphi-Methode
- 3.1 Gesundheit, Arbeit und BGF
- 4 Methodik
- 4.1 Forschungsfragen
- 4.2 Untersuchungsdesign
- 4.3 Datenaufbereitung und -auswertung
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Erste Befragungsrunde
- 5.2 Zweite und dritte Befragungsrunde
- 5.3 Beantwortung der Forschungsfragen
- 6 Diskussion
- 6.1 Bewertung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse
- 6.2 Kritische Reflexion der Arbeit
- 6.3 Ausblick
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen für eHealth in der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF). Ziel ist es, ein Zukunftsbild für die Integration digitaler Gesundheitslösungen in die BGF zu entwickeln und konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen abzuleiten.
- EHealth im Kontext der betrieblichen Gesundheitsförderung
- Entwicklungsmöglichkeiten digitaler Gesundheitslösungen
- Handlungsempfehlungen für die Implementierung von eHealth in der BGF
- Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit des entwickelten Zukunftsbildes
- Anwendung der Delphi-Methode zur Expertisegewinnung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemstellung: Diese Einleitung beschreibt den aktuellen Stand der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) und die zunehmende Bedeutung digitaler Technologien. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, die Potenziale von eHealth für die BGF zu untersuchen und konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen zu entwickeln. Die Problemstellung verdeutlicht die Herausforderungen bei der Integration digitaler Gesundheitslösungen in bestehende Strukturen und Prozesse der BGF.
2 Zielsetzung: Dieses Kapitel definiert die Ziele der Arbeit. Es skizziert ein Zukunftsbild für die Integration von eHealth in die BGF und formuliert die zu entwickelnden Handlungsempfehlungen. Es beschreibt die Methodik zur Erarbeitung dieses Zukunftsbildes und legt die Kriterien für die Bewertung der Qualität des Zukunftsbildes fest. Die Handlungsempfehlungen sollen Unternehmen bei der konkreten Umsetzung unterstützen.
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Gesundheit, Arbeit, BGF und digitaler Gesundheit. Es beleuchtet verschiedene Modelle der Gesundheitsdefinition (biomedizinisch, Risikofaktorenmodell, biopsychosoziales Modell, Salutogenese) und diskutiert den Stellenwert der Arbeit im Kontext von Gesundheit. Der aktuelle Stand der BGF wird ebenso beschrieben wie die geschichtliche Entwicklung und die Abgrenzung zu BGM und Arbeitsschutz. Der Abschnitt zu digitaler Gesundheit beleuchtet Definitionen von "digital", "Digitalisierung", eHealth, mHealth und Telemedizin und analysiert deren Chancen und Herausforderungen im Kontext der BGF.
4 Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit, beginnend mit den Forschungsfragen. Es erläutert das gewählte Untersuchungsdesign, die Delphi-Methode, die Stichprobenziehung und -zusammensetzung, das Messinstrument (Fragebogen) und den Ablauf der Befragungsrunden. Ein ausführlicher Abschnitt widmet sich der Operationalisierung der Fragestellungen, der Fragebogen- und Itemkonstruktion sowie den Pretests zur Validierung der Messinstrumente. Die Kapitel erläutert detailliert die Datenaufbereitung und -auswertung.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es berichtet über die Zusammensetzung der Stichprobe, die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Befragungsrunden (Erarbeitung von Entwicklungsmöglichkeiten, Gewinnung von Handlungsempfehlungen, Bewertung der Wichtigkeit von Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen, sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit des Zukunftsbildes). Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und in Tabellen und Grafiken visualisiert.
6 Diskussion: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Untersuchung im Lichte des bestehenden Forschungsstands. Es bewertet die Qualität der Untersuchung, diskutiert den Stichprobenumfang und die Zusammensetzung der Stichprobe, und reflektiert die Ergebnisse der einzelnen Befragungsrunden. Der Abschnitt enthält auch eine kritische Reflexion der methodischen Vorgehensweise und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Digitale Gesundheit, eHealth, mHealth, Telemedizin, Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), Delphi-Methode, Zukunftsbild, Handlungsempfehlungen, Arbeit und Gesundheit, Gesundheitsmodelle, Empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen für eHealth in der betrieblichen Gesundheitsförderung
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen für eHealth in der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF). Ziel ist die Entwicklung eines Zukunftsbildes für die Integration digitaler Gesundheitslösungen in die BGF und die Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen für Unternehmen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt eHealth im Kontext der BGF, Entwicklungsmöglichkeiten digitaler Gesundheitslösungen, Handlungsempfehlungen für die Implementierung von eHealth in der BGF, die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit des entwickelten Zukunftsbildes und die Anwendung der Delphi-Methode zur Expertisegewinnung.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative und quantitative Forschungsmethodik. Die Delphi-Methode wurde eingesetzt, um Expertise zu gewinnen und ein Zukunftsbild zu entwickeln. Der Forschungsprozess umfasste mehrere Befragungsrunden mit Datenaufbereitung und -auswertung. Die konkreten Schritte werden im Kapitel "Methodik" detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im Kapitel 5 präsentiert. Sie beinhalten die Zusammensetzung der Stichprobe, Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Befragungsrunden (Entwicklungsmöglichkeiten, Handlungsempfehlungen, Bewertung der Wichtigkeit, Eintrittswahrscheinlichkeit des Zukunftsbildes). Die Ergebnisse sind detailliert dargestellt und in Tabellen und Grafiken visualisiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung und Problemstellung, Zielsetzung, Gegenwärtiger Kenntnisstand, Methodik, Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschung, beginnend mit der Einführung in das Thema und endend mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Digitale Gesundheit, eHealth, mHealth, Telemedizin, Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), Delphi-Methode, Zukunftsbild, Handlungsempfehlungen, Arbeit und Gesundheit, Gesundheitsmodelle, Empirische Untersuchung.
Wie wird das Zukunftsbild für eHealth in der BGF bewertet?
Die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit des entwickelten Zukunftsbildes ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Die Bewertungskriterien und die Methodik zur Bewertung werden im Kapitel 2 ("Zielsetzung") und im Kapitel 4 ("Methodik") detailliert beschrieben. Die Ergebnisse dieser Bewertung werden im Kapitel 5 ("Ergebnisse") präsentiert und im Kapitel 6 ("Diskussion") interpretiert.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit leitet konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen ab, die die Implementierung von eHealth in der BGF unterstützen sollen. Diese Empfehlungen basieren auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung und werden im Kapitel 5 ("Ergebnisse") und 6 ("Diskussion") detailliert dargestellt und diskutiert.
Welchen Beitrag leistet die Arbeit zum Forschungsstand?
Die Arbeit trägt zum Forschungsstand bei, indem sie ein Zukunftsbild für die Integration von eHealth in die BGF entwickelt und konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen liefert. Sie analysiert den aktuellen Kenntnisstand zu eHealth, BGF und verwandten Themen und bewertet die Chancen und Herausforderungen der Implementierung von eHealth-Lösungen in der betrieblichen Praxis.
- Quote paper
- Florian Schweer (Author), 2016, Digitale Gesundheit. eHealth in der betrieblichen Gesundheitsförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337696