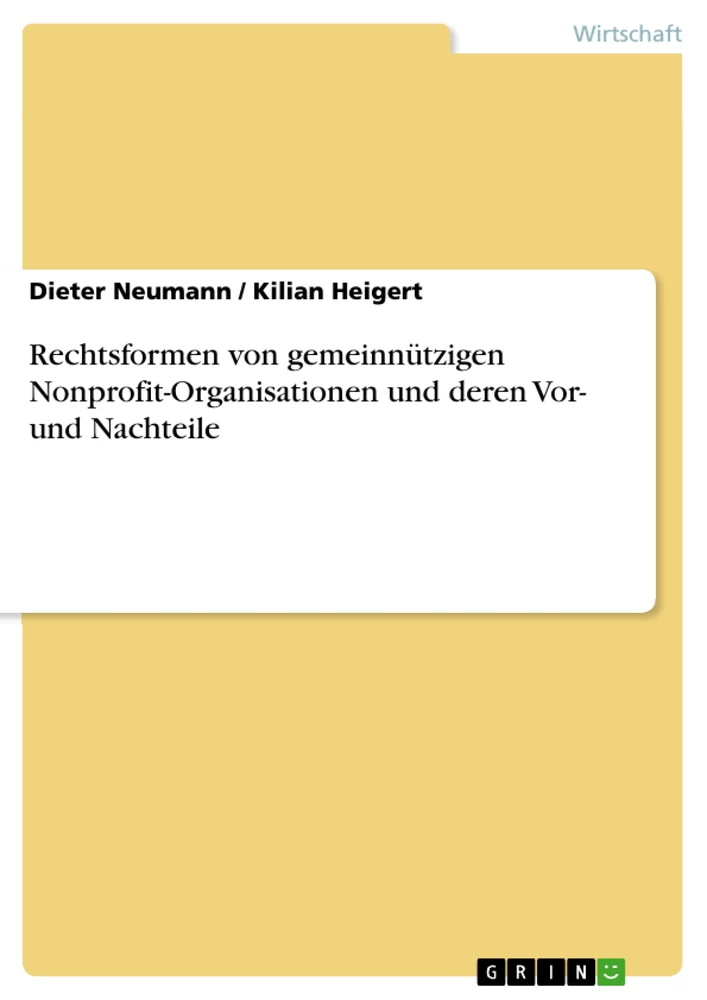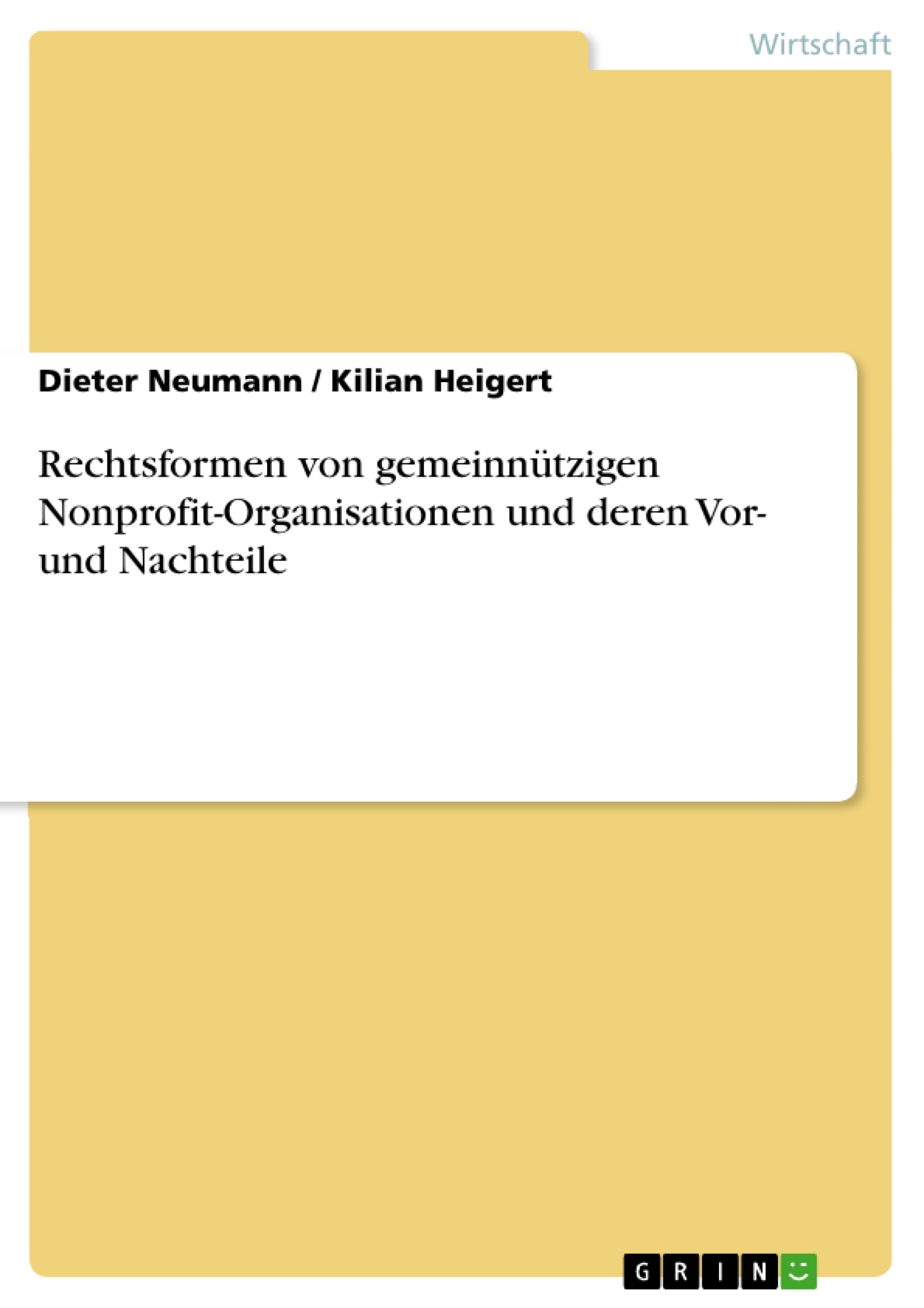Der Nonprofit-Sektor in Deutschland stellt einen bedeutenden Teil unseres heutigen Wirtschaftslebens dar. Nonprofit-Organisationen sind in nahezu jedem Bereich tätig. Vor allem im Gesundheitswesen, dem Bildungs- und Erziehungswesen, dem Sozialen Dienst, dem Umwelt-, Natur- und Artenschutz, dem lokalen Entwicklungs- und Wohnungswesen, der Interessensvertretung und vielen weiteren Tätigkeitsfeldern sind Nonprofit-Organisationen häufig anzutreffen. Neben den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Rechtsformen, die sich in den Nonprofit-Sektor integriert haben. Bei den wichtigsten Rechtsformen handelt es sich um Vereine, Stiftungen, gemeinnützige GmbHs und AGs, gemeinnützige eingetragene Genossenschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts.
Für den Erfolg einer gemeinnützigen Einrichtung ist auch die Wahl der Rechtsform von grundlegender Bedeutung. Die rechtliche Ausgestaltung einer NPO legt die Haftungsverhältnisse, die Finanzierungsmöglichkeiten, die Besteuerung, die Gründungsanforderungen und die Entscheidungsmöglichkeiten fest. Dadurch haben die Rechtsformen einen großen Einfluss auf den Gründungsablauf, den Betrieb und die Auflösung der betroffenen Organisation. Für die Entscheidung, welche Rechtsform am besten geeignet ist, spielt auch die jeweilige Sachzieldominanz eine entscheidende Rolle, denn nicht jede Rechtsform eignet sich für die entsprechenden Sachziele gleich gut. Unter einer Sachzieldominanz wird das Verhältnis zwischen Formalzielen und Sachzielen verstanden. Das Sachziel kann über das Formalziel dominieren. Dadurch kommt es zu einer Sachzieldominanz. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Formalziel verdrängt wurde, sondern dieses nimmt lediglich einen dienenden Charakter an. Unter einem Sachziel versteht man bspw. die Erfüllung einer Mission oder bestimmte von den Mitgliedern vorgegebene Ziele und Leistungswünsche. So steht in etwa die Mitgliederförderung im Zentrum der Leistungen einer Gewerkschaft.
Das Ziel dieses Buches, das eine überarbeitete Version der Bachelorarbeit Kilian Heigerts ist, soll sein, einen Überblick über die rechtlichen Ausgestaltungen, Besonderheiten und Eignungen der jeweiligen Rechts- und Erscheinungsformen zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Vorgehensweise
- 2 Definition und Abgrenzung der Nonprofit-Organisationen
- 2.1 Geschichte des deutschen Nonprofit-Sektors
- 2.2 Der Nonprofit-Sektor in Deutschland
- 3 Nonprofit Organisationen in Recht, Wirtschaft und Gesellschaft
- 3.1 Tätigkeitsfelder von NPOs
- 3.2 Bedeutung und Bindungen durch den Gemeinnützigkeitsstatus
- 3.3 Organisationsformen und Organisationstypen
- 3.4 Der Nonprofit-Sektor, Staat und die Gesellschaft
- 4 Der eingetragene Verein (e. V.)
- 4.1 Charakteristika von Vereinen
- 4.1.1 Definitionen eines Vereins
- 4.1.2 Unterscheidung von Vereinen und Verbänden
- 4.1.3 Vereinslandschaft in Deutschland
- 4.2 Der Aufbau und die Rechtsgrundlagen eines Vereins
- 4.2.1 Gründung, Satzung und Vereinsrecht
- 4.2.2 Rechte und Pflichten der Mitglieder
- 4.2.3 Der Vorstand
- 4.2.4 Die Mitglieder- oder Hauptversammlung
- 4.2.5 Weitere Vereinsorgane
- 4.3 Rechtsformwahl eingetragener Verein: Vor- und Nachteile
- 5 Die Stiftung
- 5.1 Charakteristika von Stiftungen
- 5.1.1 Der Stiftungsbegriff
- 5.1.2 Gründung einer Stiftung
- 5.1.3 Stiftungslandschaft Deutschland
- 5.1.4 Alternativen zur Stiftungsgründung
- 5.2 Stiftungstypen
- 5.2.1 Rechtsfähige Stiftung (BGB-Stiftung)
- 5.2.2 Familienstiftungen
- 5.2.3 Gemeinschaftsstiftungen
- 5.2.4 Unternehmensnahe Stiftungen
- 5.2.5 Treuhandstiftungen
- 5.2.6 Stiftungen der öffentlichen Hand
- 5.2.7 Kirchliche Stiftungen
- 5.2.8 Stiftungs-GmbH, Stiftungs-AG und Stiftungsverein
- 5.3 Rechtsformwahl Stiftung: Vor- und Nachteile
- 6 Die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)
- 6.1 Charakteristika einer gGmbH
- 6.2 Stadien der Gründung einer gGmbH
- 6.3 Organe einer gGmbH
- 6.4 Rechtsformwahl gGmbH: Vor- und Nachteile
- 7 Die gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG)
- 7.1 Charakteristika der gAG
- 7.2 Gründungsstadien und Unterschiede zur AG
- 7.3 Organe einer gAG
- 7.4 Rechtsformwahl gAG: Vor- und Nachteile
- 8 Gemeinnützige eingetragene Genossenschaften (geG)
- 8.1 Charakteristika einer geG
- 8.2 Gründungsvorgang einer geG
- 8.3 Organe und Struktur der eG
- 8.4 Mögliche Probleme zwischen der Rechtsform einer eG und der Gemeinnützigkeit
- 8.5 Rechtsformwahl geG: Vor- und Nachteile
- 9 Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
- 9.1 Charakteristika einer GbR
- 9.2 GbR an einem fiktiven Praxisbeispiel
- 9.3 Rechtsformwahl GbR: Vor- und Nachteile
- 10 Eignung bei unterschiedlicher Sachzieldominanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch untersucht die verschiedenen Rechtsformen gemeinnütziger Nonprofit-Organisationen in Deutschland. Ziel ist es, die jeweiligen Vor- und Nachteile jeder Rechtsform darzustellen und Entscheidungshilfen für die Wahl der passenden Organisationsstruktur zu bieten.
- Vergleich verschiedener Rechtsformen gemeinnütziger Organisationen
- Analyse der Vor- und Nachteile der einzelnen Rechtsformen
- Bewertung der Eignung der Rechtsformen für unterschiedliche Zwecke
- Beschreibung der rechtlichen Grundlagen und des Aufbaus der Organisationen
- Zusammenhang zwischen Rechtsform und Gemeinnützigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die Problemstellung, das Ziel der Arbeit und die gewählte Vorgehensweise bei der Untersuchung der Rechtsformen gemeinnütziger Organisationen. Es legt den Fokus auf die Bedeutung der richtigen Rechtsformwahl für den Erfolg einer Non-Profit-Organisation und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
2 Definition und Abgrenzung der Nonprofit-Organisationen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Nonprofit-Organisation und grenzt ihn von anderen Organisationsformen ab. Es beleuchtet die Geschichte des deutschen Nonprofit-Sektors und beschreibt dessen aktuelle Struktur und Bedeutung innerhalb der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung von gewinnorientierten Unternehmen und der besonderen Rolle des Gemeinnützigkeitsstatus.
3 Nonprofit Organisationen in Recht, Wirtschaft und Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die vielfältigen Tätigkeitsfelder von NPOs, die Bedeutung des Gemeinnützigkeitsstatus und die verschiedenen Organisationsformen und -typen im Nonprofit-Sektor. Es analysiert die komplexen Beziehungen zwischen dem Nonprofit-Sektor, dem Staat und der Gesellschaft, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung, der Regulierung und der öffentlichen Wahrnehmung.
4 Der eingetragene Verein (e. V.): Das Kapitel analysiert detailliert die Rechtsform des eingetragenen Vereins. Es beschreibt die Charakteristika von Vereinen, einschließlich ihrer Definition, Abgrenzung zu Verbänden und der Vereinslandschaft in Deutschland. Der Aufbau und die Rechtsgrundlagen werden ausführlich behandelt, inklusive Gründung, Satzung, Vereinsrecht, Rechten und Pflichten der Mitglieder, Vorstand, Mitgliederversammlung und weiteren Organen. Schließlich werden die Vor- und Nachteile der Rechtsformwahl für eingetragene Vereine umfassend diskutiert.
5 Die Stiftung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rechtsform der Stiftung. Es erläutert den Stiftungsbegriff, die Gründung einer Stiftung, die Stiftungslandschaft in Deutschland und mögliche Alternativen zur Stiftungsgründung. Es werden verschiedene Stiftungstypen detailliert beschrieben, einschließlich rechtsfähiger Stiftungen, Familienstiftungen, Gemeinschaftsstiftungen, unternehmensnahen Stiftungen, Treuhandstiftungen, Stiftungen der öffentlichen Hand und kirchlichen Stiftungen, sowie Stiftungs-GmbH, Stiftungs-AG und Stiftungsverein. Die Vor- und Nachteile der Rechtsformwahl für Stiftungen werden abschliessend bewertet.
6 Die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH): Dieses Kapitel konzentriert sich auf die gGmbH. Es beschreibt die Charakteristika, die Gründungsphasen, die Organe und die Vor- und Nachteile dieser Rechtsform im Vergleich zu anderen gemeinnützigen Organisationsformen. Der Fokus liegt auf den spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen und den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für gemeinnützige Aktivitäten.
7 Die gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG): Ähnlich wie Kapitel 6, widmet sich dieses Kapitel der gAG, ihrer Charakteristik, den Gründungsphasen und Organen. Die spezifischen Unterschiede zur regulären Aktiengesellschaft (AG) werden herausgestellt, ebenso wie die Vor- und Nachteile dieser Rechtsform für gemeinnützige Zwecke. Der Fokus liegt auf den spezifischen rechtlichen Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Organisationsstruktur.
8 Gemeinnützige eingetragene Genossenschaften (geG): Dieses Kapitel untersucht die Rechtsform der gemeinnützigen eingetragenen Genossenschaft. Es beschreibt die Charakteristika, den Gründungsprozess, die Organe und Struktur. Besondere Aufmerksamkeit wird den möglichen Problemen im Spannungsfeld zwischen der Genossenschaftsrechtsform und den Anforderungen der Gemeinnützigkeit gewidmet. Die Vor- und Nachteile der Rechtsformwahl werden detailliert analysiert.
9 Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR): Das Kapitel behandelt die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) als Rechtsform für gemeinnützige Organisationen. Es beschreibt die Charakteristika, illustriert sie an einem Praxisbeispiel und bewertet die Vor- und Nachteile dieser Rechtsform im Kontext der Gemeinnützigkeit. Der Fokus liegt auf der Einfachheit der Gründung im Gegensatz zu den potenziellen Haftungsrisiken.
10 Eignung bei unterschiedlicher Sachzieldominanz: Dieses Kapitel analysiert die Eignung der verschiedenen Rechtsformen im Hinblick auf unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele gemeinnütziger Arbeit. Es fasst die zuvor diskutierten Vor- und Nachteile zusammen und bietet Hilfestellung bei der Wahl der optimalen Rechtsform abhängig von der jeweiligen Organisationsstruktur und den angestrebten Zielen.
Schlüsselwörter
Gemeinnützigkeit, Nonprofit-Organisationen, Rechtsformen, eingetragener Verein (e.V.), Stiftung, gGmbH, gAG, Genossenschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Vor- und Nachteile, Rechtsvergleich, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zu "Rechtsformen gemeinnütziger Organisationen in Deutschland"
Welche Rechtsformen gemeinnütziger Organisationen werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt die wichtigsten Rechtsformen gemeinnütziger Organisationen in Deutschland: eingetragener Verein (e.V.), Stiftung, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH), gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG), gemeinnützige eingetragene Genossenschaft (geG) und Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).
Was ist das Ziel des Buches?
Das Buch zielt darauf ab, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Rechtsformen gemeinnütziger Organisationen zu vergleichen und Entscheidungshilfen für die Wahl der passenden Organisationsstruktur zu bieten. Es analysiert die jeweiligen rechtlichen Grundlagen und den Aufbau der Organisationen sowie den Zusammenhang zwischen Rechtsform und Gemeinnützigkeit.
Wie ist das Buch aufgebaut?
Das Buch beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, die Zielsetzung und die Vorgehensweise beschreibt. Es folgt ein Kapitel zur Definition und Abgrenzung von Nonprofit-Organisationen. Die einzelnen Kapitel 4-9 widmen sich jeweils einer der genannten Rechtsformen, beschreiben deren Charakteristika, Gründung, Aufbau, Organe und Vor- und Nachteile. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt Hilfestellung bei der Wahl der optimalen Rechtsform abhängig von den Zielen und der Organisationsstruktur.
Welche Aspekte werden für jede Rechtsform betrachtet?
Für jede Rechtsform werden die Charakteristika, die Gründung, der Aufbau und die Organe (z.B. Vorstand, Mitgliederversammlung) detailliert beschrieben. Ein besonderer Fokus liegt auf den rechtlichen Grundlagen und den Vor- und Nachteilen jeder Rechtsform im Vergleich zu den anderen. Die Kapitel beleuchten auch die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich aus der jeweiligen Rechtsform ergeben.
Welche Kapitel gibt es im Buch?
Das Buch umfasst zehn Kapitel: Einleitung, Definition und Abgrenzung von Nonprofit-Organisationen, Nonprofit-Organisationen in Recht, Wirtschaft und Gesellschaft, Der eingetragene Verein (e.V.), Die Stiftung, Die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH), Die gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG), Gemeinnützige eingetragene Genossenschaften (geG), Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und Eignung bei unterschiedlicher Sachzieldominanz.
Wofür ist das Buch geeignet?
Das Buch eignet sich für alle, die sich mit der Gründung oder Umstrukturierung einer gemeinnützigen Organisation befassen. Es bietet eine umfassende Übersicht über die verschiedenen Rechtsformen und hilft bei der Entscheidung, welche Rechtsform am besten zu den jeweiligen Zielen und Anforderungen passt. Es ist gleichermaßen nützlich für Gründer, Vorstände, Mitglieder und alle Interessierten im Nonprofit-Sektor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter sind: Gemeinnützigkeit, Nonprofit-Organisationen, Rechtsformen, eingetragener Verein (e.V.), Stiftung, gGmbH, gAG, Genossenschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Vor- und Nachteile, Rechtsvergleich, Deutschland.
- Quote paper
- Dieter Neumann (Author), Kilian Heigert (Author), 2016, Rechtsformen von gemeinnützigen Nonprofit-Organisationen und deren Vor- und Nachteile, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337705