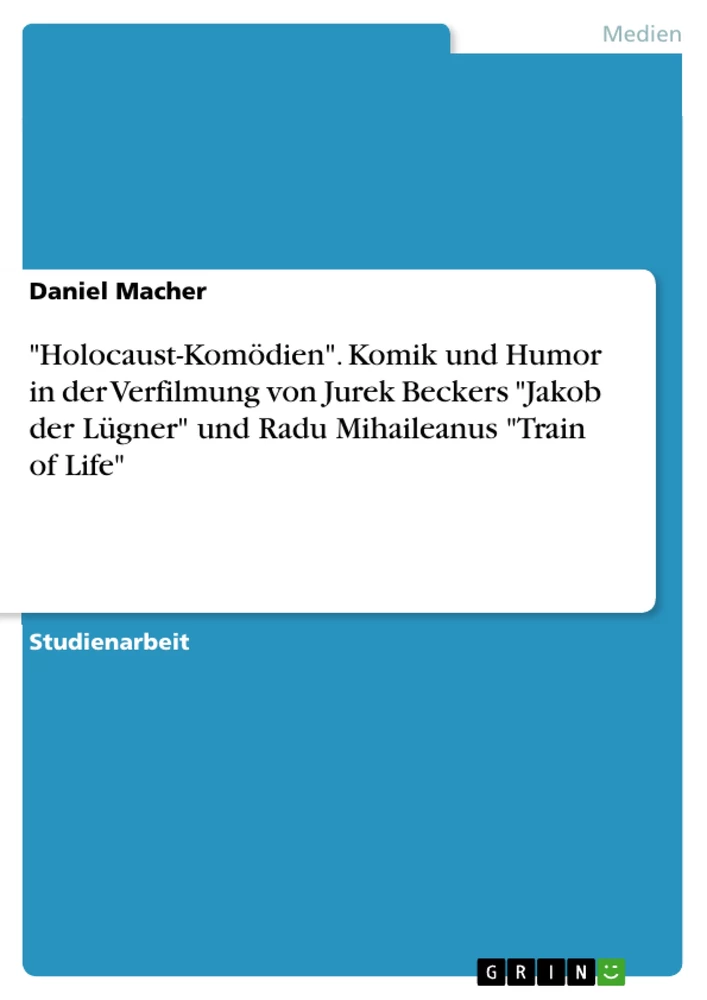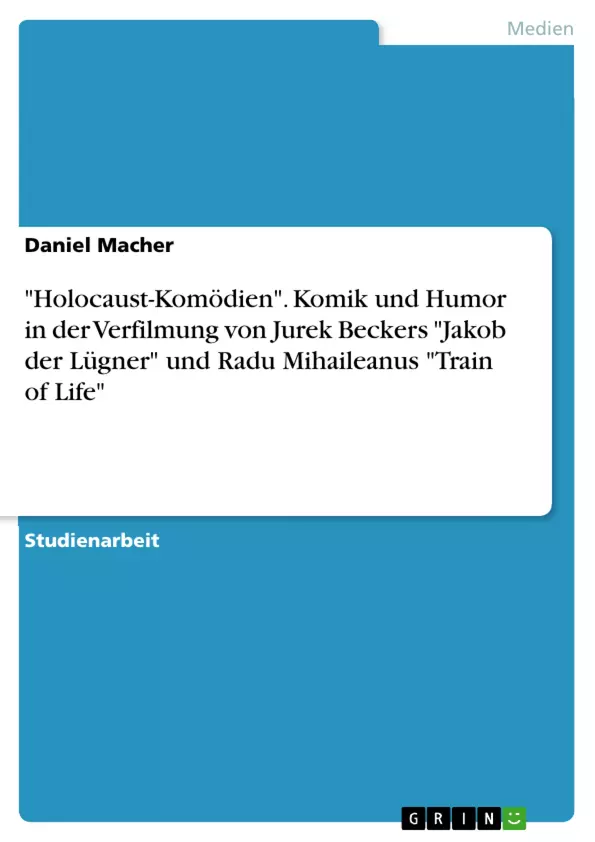In der folgenden Arbeit werden zwei Filme untersucht, die zwar anscheinend dem gleichen Genre der sogenannten „Holocaust-Filmkomödien“ zugehören, jedoch filmgeschichtlich weit auseinander liegen. Zum einen handelt es sich um die 1972 erschienene Verfilmung des Romans „Jakob der Lügner“, und zum zweiten Radu Mihaileanus „Train of Live“, der 1998 in die Kinos kam. Und obwohl fast 25 Jahre zwischen ihnen liegen, lösten beide nach ihrer Veröffentlichung eine ähnliche Kontroverse aus, inwiefern eine humorvolle Darstellung des Holocaust gerechtfertigt ist.
Um diese Distanz zu veranschaulichen, soll in einem theoretischen Teil dieser Arbeit erst auf die Geschichte der „Holocaust-Komödie“ eingegangen werden. Welche Filme werden diesem Genre zugeordnet und welche Rolle spielen die hier untersuchten Filme dabei? Ebenfalls in diesem Teil der Arbeit soll der Frage nach der Darstellbarkeit der Shoah im Medium Film nachgegangen werden. Wann kann eine Darstellung für sich in Anspruch nehmen, dem historischen Gegenstand gegenüber „angemessen“ zu sein, und welche spezifische Leistung kommt satirischen Genres bei der Darstellung zu? In einem zweiten praktischen Teil wird auf die beiden Filme eingegangen. Dies wird zum Teil exemplarisch durch die Analyse einzelner ausgewählter Szenen geschehen. In Bezug auf Komik und Humor werden jedoch auch die Filme als Ganzes betrachtet. Ziel der Arbeit soll nach der Analyse der beiden Filme, ein Vergleich dieser sein und versucht werden, mögliche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede herauszuarbeiten. Im Vordergrund steht dabei die Frage nach dem Humor und der Komik. Welche Möglichkeiten diese Herangehensweise bietet, aber auch welche Grenzen sie möglicherweise aufzeigt.
- Quote paper
- Daniel Macher (Author), 2010, "Holocaust-Komödien". Komik und Humor in der Verfilmung von Jurek Beckers "Jakob der Lügner" und Radu Mihaileanus "Train of Life", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337708