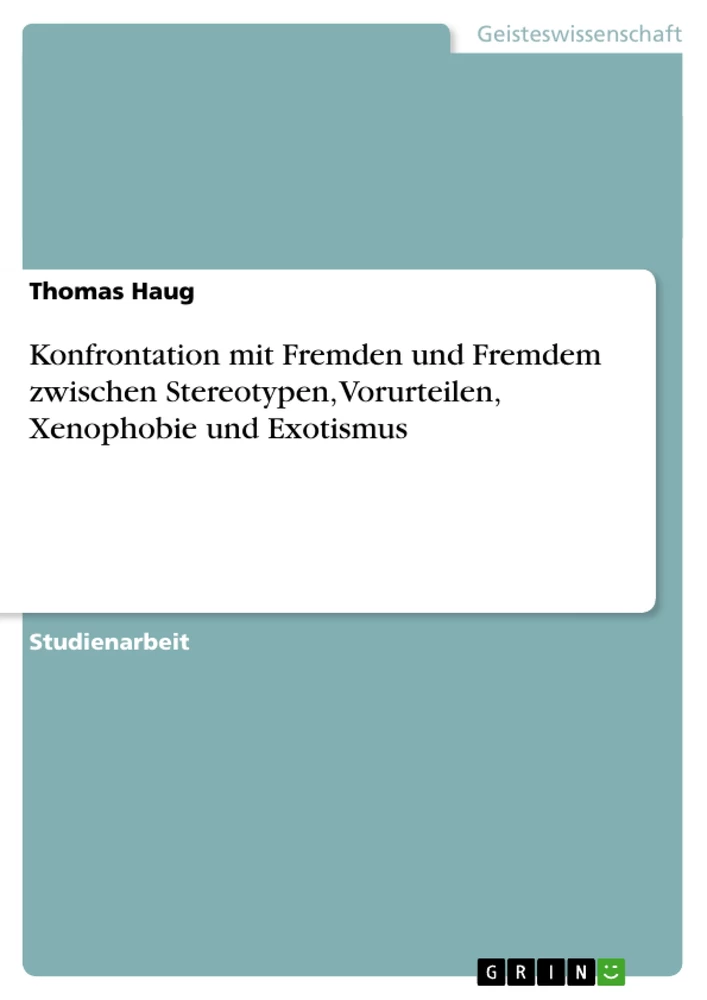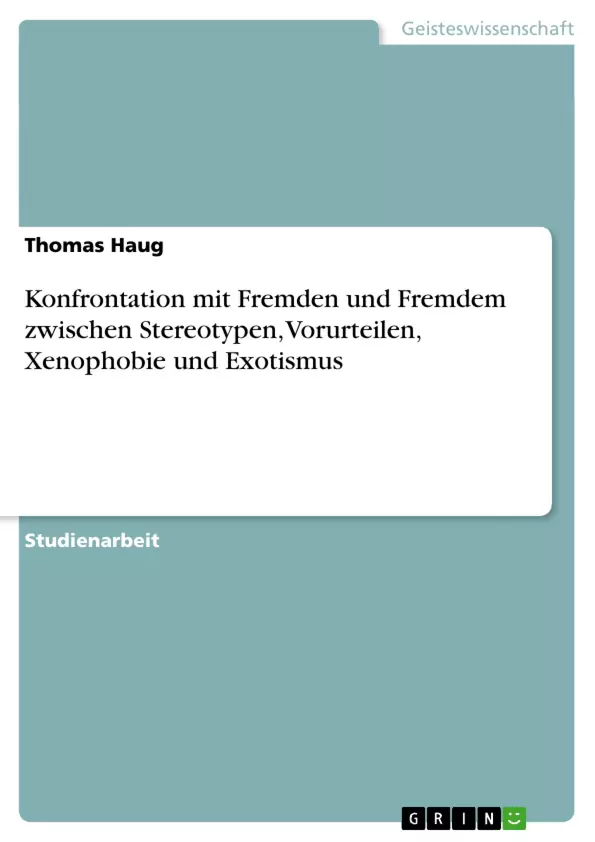Vorab möchte ich darauf hinweisen, daß ich die Begriffe „Fremdes“, „Fremde“, „Fremder“, usw. immer – von Zitaten abgesehen – bewußt in Anführungszeichen gesetzt habe. Ich will damit meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, daß es völlig relativ ist und nur vom Blickwinkel abhängt, wer oder was „fremd“ ist.
Konfrontation mit „Fremdem“ und „Fremden“ birgt immer ein gewisses Konfliktpotential in sich und stellt somit eine große Herausforderung dar, die als Chance gesehen werden kann. Zwei Hauptaspekte spielen hierbei eine Rolle: Zum einen haben Menschen unterschiedlicher Herkunft verschiedene Bezugssysteme für ihr Denken und Fühlen und zum anderen löst das, der und die „Fremde“ Grundlegendes in der menschlichen Psyche aus.
In meinen Ausführungen beziehe ich mich vor allem auf „Fremde“ und „Fremdes“ im kulturellen Sinne. Die meisten der im Folgenden dargestellten Prozesse und Mechanismen gelten allerdings generell. Dabei können anstelle von Ausländern auch beispielsweise Behinderte die „Fremden“ sein.
Verweisen möchte ich an dieser Stelle bereits auf die schematische Darstellung im Anhang, die für die gesamten Ausführungen relevant ist. Aus diesem Grunde verzichte ich auf spezielle Hinweise an bestimmten Stellen im Text. Im Anhang findet sich ein von mir ergänztes Ablaufschema, das auf einer Vorlage aus dem Buch von Ausländer – Aussiedler – Übersiedler / Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland von Günther Gugel basiert. Dieses Gedankenmodell möglicher Folgereaktionen und Verhaltenstendenzen auf die Konfrontation mit „Fremden“ und „Fremdem“ will als stark vereinfachte Übersicht zur Orientierung verstanden werden – nicht als zwangsläufiger Mechanismus. In der Realität gibt es natürlich viele Modalitäten, wie zum Beispiel komplexere Wechselwirkungen, das Überspringen einzelner Stufen, Rückkopplungen und auch Ausstiegsmöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Stereotype und Vorurteile – die „Bilder im Kopf“
- 1. Ursachen
- 2. Vermittlung und Aneignung
- III. Xenophobie und Exotismus - die „Bilder im Bauch“
- 1. Entstehung
- 2. Mechanismen
- 3. Zusammenhänge
- IV. Wirkungen der „Bilder im Kopf“ und der „Bilder im Bauch“
- 1. Bedrohung der eigenen Person
- 2. „Verteidigungsstrategien“ zur Angstabwehr
- 3. Diskriminierende Gegnerschaft
- V. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat befasst sich mit der Konfrontation mit „Fremden“ und „Fremdem“ im kulturellen Kontext. Es analysiert die Entstehung und Vermittlung von Stereotypen und Vorurteilen, sowie die Phänomene Xenophobie und Exotismus. Die Arbeit untersucht, wie „Bilder im Kopf“ und „Bilder im Bauch“ zu Reaktionen auf „Fremde“ und „Fremdes“ führen, welche Auswirkungen diese auf die eigene Person haben und zu welchen „Verteidigungsstrategien“ sie führen können.
- Entstehung und Vermittlung von Stereotypen und Vorurteilen
- Die Rolle von Xenophobie und Exotismus als „Bilder im Bauch“
- Die Auswirkungen von „Bildern im Kopf“ und „Bildern im Bauch“ auf die eigene Person
- „Verteidigungsstrategien“ als Reaktion auf die Konfrontation mit „Fremden“ und „Fremdem“
- Diskriminierende Gegnerschaft als Folge von Stereotypen und Vorurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt den Begriff „Fremdes“ und „Fremden“ in den Kontext von Konfrontation und Konfliktpotential. Sie hebt die unterschiedlichen Bezugssysteme und psychologischen Reaktionen auf „Fremde“ hervor. Außerdem wird auf die schematische Darstellung im Anhang verwiesen, die als Gedankenmodell zur Orientierung dient.
II. Stereotype und Vorurteile – die „Bilder im Kopf“
Dieses Kapitel behandelt die Ursachen und die Vermittlung von Stereotypen und Vorurteilen. Es wird erläutert, wie „das Unbekannte“ als Nährboden für Spekulationen und Interpretationen dient und wie „Bilder im Kopf“ die Komplexität des Lebens vereinfachen. Die Rechtfertigungsfunktion von Vorurteilen für historische und aktuelle Diskriminierung wird ebenfalls beleuchtet. Im Abschnitt zur Vermittlung und Aneignung werden die Rolle der Erziehung, Werbung und Medien im Prozess der Stereotypenvermittlung dargestellt.
III. Xenophobie und Exotismus – die „Bilder im Bauch“
Dieses Kapitel widmet sich den Phänomenen Xenophobie und Exotismus, die als „Bilder im Bauch“ die gefühlsmäßige Bewertung von „Fremdem“ beeinflussen. Es wird die Entstehung der „Bilder im Bauch“ im frühen Kindesalter im Kontext der Mutter-Kind-Beziehung und der Reaktionen auf „Fremde“ bei Kleinkindern beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Bilder im Kopf" und "Bilder im Bauch"?
"Bilder im Kopf" bezeichnen kognitive Stereotype und Vorurteile, während "Bilder im Bauch" emotionale Reaktionen wie Xenophobie oder Exotismus beschreiben.
Welche Funktion haben Stereotype laut der Arbeit?
Stereotype dienen dazu, die Komplexität des Lebens zu vereinfachen und bieten oft Rechtfertigungen für historische oder aktuelle Diskriminierung.
Wie entstehen emotionale Vorurteile (Xenophobie)?
Die Arbeit verweist auf die Entstehung in der frühen Kindheit, oft im Kontext der Mutter-Kind-Beziehung und ersten Reaktionen auf Unbekanntes.
Was ist der Unterschied zwischen Xenophobie und Exotismus?
Xenophobie ist die Angst vor dem Fremden, während Exotismus eine oft romantisierende oder faszinierte, aber dennoch distanzierende Sicht auf das "Fremde" darstellt.
Welche Rolle spielen Medien bei der Vermittlung von Vorurteilen?
Medien, Werbung und Erziehung werden als zentrale Instanzen genannt, über die Stereotype vermittelt und von Individuen angeeignet werden.
- Arbeit zitieren
- Thomas Haug (Autor:in), 2000, Konfrontation mit Fremden und Fremdem zwischen Stereotypen, Vorurteilen, Xenophobie und Exotismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33770