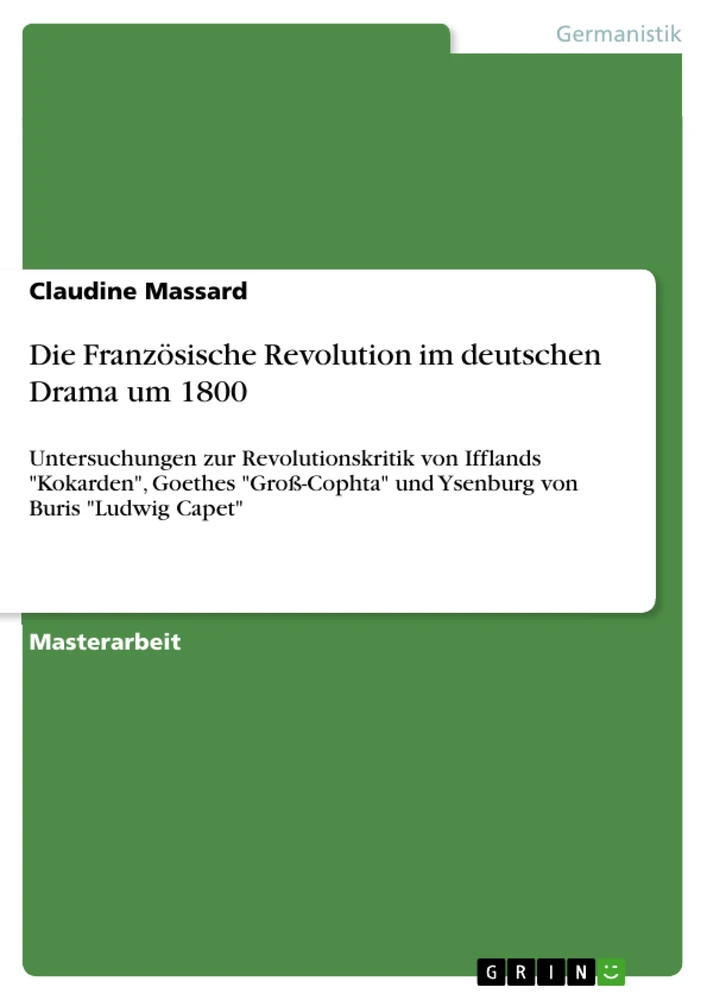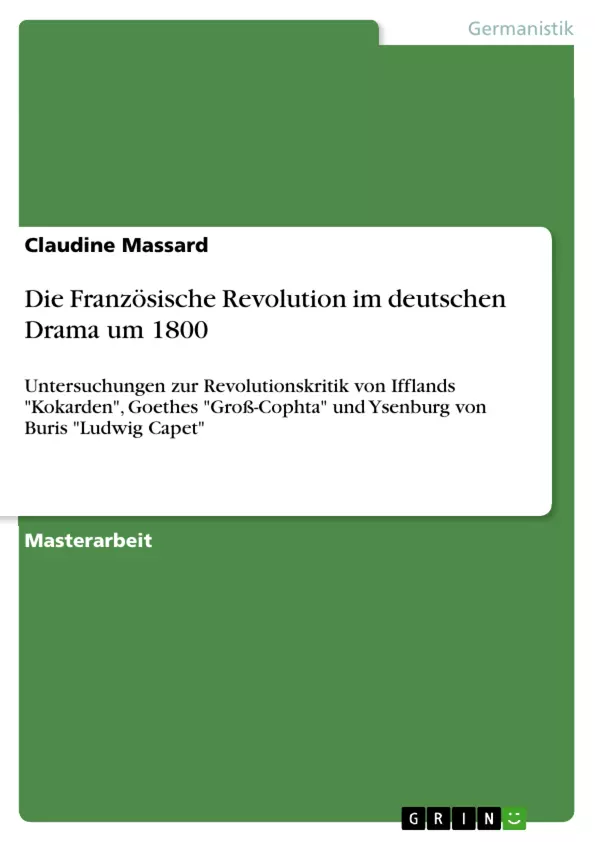Das 18. Jahrhundert ist wohl eines der wichtigsten, was die Entwicklung des deutschen Dramas und der Theaterkultur angeht. Während Schauspieler zu Beginn noch fahrendes Volk und sozial eher niedrig gestellt waren, wurden sie nicht zuletzt etwa durch Gottsched und Lessing zu einer angesehenen Schicht.
Durch Gottscheds Reformen, die ein niveauvolleres Theater zum Ziel hatten, aber auch durch andere Autoren, wie etwa Goethe oder Iffland, welche diese Gattung nachhaltig beeinflusst haben, änderte sich der Status dieser Kunstform langsam aber sicher. Die Literatur erhielt eine didaktische Funktion, welche nach Gili einziges Mittel zum revolutionären Engagement wurde. Genau dasselbe gilt für die antirevolutionär denkenden Autoren. So nutzte etwa Iffland die Bühne als „politisches Podium“, „als man gerade Ludwig XVI. bei seiner Flucht in Varennes verhaftete und er, auf der Bühne stehend, improvisierte: ‚möge der König einen Blondel finden, der sein Leben rettet!’ “ Auch Eke ist sich der „gesellschaftspolitischen Bedeutungsdimension des Theaters“ bewusst, wenn er es als „Multiplikationsmedium von (ideologischen) Geschichtsversionen und Instrument der Meinungsbildung“ beschreibt, das „in der Flut der (vor allem gegenrevolutionären) Dramen“ widergespiegelt wird. Die überwiegende Mehrheit an antirevolutionären Stücken erklärt sich wohl auch durch die Abhängigkeit vieler Autoren von ihren Mäzenen und der Zensur. Ein Beispiel ist das Kölner Dekret von 1791, welches Aufführungen jedes Werkes verbietet, „welches etwas gegen die Religion, die guten Sitten und den Staat enthält.“ Auch Dramen, „wo die Gleichheit der Stände als möglich und ausführbar oder nützlich erhoben werde“ oder solche, in denen „obrigkeitliche Verfügungen verächtlich dargelegt und Ungehorsam gegen dieselben geprediget werden“ waren strengstens untersagt. Aber auch gegenrevolutionäre Stücke fielen oftmals „aus Sorge über eine mögliche Verbreitung revolutionärer Ideen auf indirektem Wege“ der Zensur zum Opfer. Um diese zu umgehen und jede Bildungsschicht zu erreichen, setzten viele Autoren Metaphern und Symbole ein.
Nicht zuletzt auch die zunehmende Bildung und Alphabetisierung des Volkes führte zu einer „relativ hohen Akzeptanz des Revolutionsdramas beim lesenden Publikum“ und verlangte nicht mehr nur nach Laienspielen, was von vielen Autoren in ihren belehrenden und kritischen
Stücken beachtet wurde. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Das Theater als Medium im 18. Jahrhundert
- 1. Gattungstypologie und Analyse der Hauptcharaktere
- 1.1 Der Groß‐Cophta als Lustspiel
- 1.1.1 Figuren
- 1.1.1.1 Graf Rostro
- 1.1.1.2 Die Marquise und der Marquis
- 1.1.1.3 Die Nichte
- 1.1.1.4 Der Domherr
- 1.1.1.5 Der Ritter
- 1.2 Die Kokarden als bürgerliches Trauerspiel
- 1.2.1 Figuren
- 1.2.1.1 Geheime Rath Bangenau
- 1.2.1.2 Magister Hahn und Bierbrauer Freund
- 1.2.1.3 Jürge als Stellvertreter für den Bauernstand
- 1.2.1.4 Franz und Albertine
- 1.3 Ludwig Capet als Trauerspiel
- 1.3.1 Figuren
- 1.3.1.1 Ludwig Capet
- 1.3.1.2 Graf de la Tour
- 1.3.1.3 Merville
- 1.1 Der Groß‐Cophta als Lustspiel
- 2. Verfremdung und Historizität des Stoffs im Hinblick auf die politische Situation
- 2.1 Der Groß – Cophta
- 2.2 Die Kokarden
- 2.3 Ludwig Capet
- 3. Rezeption der Werke und Intention ihrer Autoren
- 3.1 Johann Wolfgang von Goethe
- 3.2 August Wilhelm Iffland
- 3.3 Ernst Carl Ludwig Ysenburg von Buri
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, wie die Französische Revolution im deutschen Drama um 1800 verarbeitet wurde, indem sie die Revolutionskritik an drei Beispielen analysiert: Ifflands "Kokarden", Goethes "Groß-Cophta" und Ysenburg von Buris "Ludwig Capet". Die Arbeit befasst sich mit der Gattungstypologie und den Hauptcharakteren, der Verfremdung und Historizität der Stoffe im Hinblick auf die damalige politische Situation sowie der Rezeption der Werke und der Intention ihrer Autoren.
- Die Rolle des antirevolutionären Dramas in der deutschen Nationalliteratur und dessen Streben nach Volkstümlichkeit.
- Die Verwendung von realistischen Elementen in den einzelnen Bühnenstücken und ihre bewusste Verfremdung.
- Die Intentionen der Autoren und ihre Umsetzung in den Stücken.
- Die Rezeption der Stücke durch das Publikum.
- Die Auswirkungen der Stücke auf die damalige Mentalität und Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort beleuchtet die Bedeutung des Theaters im 18. Jahrhundert als politisches Podium und Multiplikationsmedium für ideologische Geschichtsversionen. Es wird der Einfluss der Zensur auf die Entstehung antirevolutionärer Dramen und der Gebrauch von Metaphern und Symbolen zur Umgehung dieser Zensur beschrieben.
Kapitel 1 analysiert die Gattungstypologie und die Hauptcharaktere der drei Dramen. "Der Groß-Cophta" wird als Lustspiel, "Die Kokarden" als bürgerliches Trauerspiel und "Ludwig Capet" als Trauerspiel klassifiziert. Die einzelnen Figuren werden in Bezug auf ihre Standeszugehörigkeit, ihre Verhaltensweisen und ihre Rolle in der Handlung des jeweiligen Dramas untersucht.
Kapitel 2 befasst sich mit der Verfremdung und Historizität der Stoffe im Hinblick auf die damalige politische Situation. Der Groß-Cophta greift auf die Halsband-Affäre und die Figur des Graf Cagliostro zurück, die Kokarden verwenden revolutionäre Symbole und Begriffe und "Ludwig Capet" bezieht sich auf historische Personen und Ereignisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Revolutionskritik, Drama, Gattungstypologie, Historizität, Verfremdung, Rezeption, Intention, antirevolutionäre Dramen, Französische Revolution, deutscher Nationalliteratur, Volkstümlichkeit, Aufklärung, Adelskritik, Monarchie, Familie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Märtyrer, Tyrannen, Metaphern, Symbole, und die politische Situation im 18. Jahrhundert.
Wie wurde die Französische Revolution im deutschen Drama verarbeitet?
Die Revolution wurde um 1800 oft kritisch oder antirevolutionär in verschiedenen Gattungen wie dem Lustspiel (Goethe) oder dem bürgerlichen Trauerspiel (Iffland) thematisiert.
Welche Rolle spielte die Zensur für Revolutionsdramen?
Strenge Dekrete verboten Stücke, die gegen Staat oder Religion gerichtet waren. Viele Autoren nutzten daher Metaphern und Symbole, um ihre politische Meinung indirekt auszudrücken.
Was ist das Thema von Goethes „Der Groß-Cophta“?
Das Lustspiel greift die historische Halsband-Affäre und die Figur des Grafen Cagliostro auf, um Betrug und moralischen Verfall im Vorfeld der Revolution zu zeigen.
Worum geht es in Ifflands „Die Kokarden“?
Dieses bürgerliche Trauerspiel thematisiert den Konflikt zwischen den Ständen und warnt vor den zerstörerischen Folgen revolutionärer Umbrüche für die Gesellschaft.
War das Theater damals ein politisches Medium?
Ja, das Theater diente als „politisches Podium“ und Multiplikationsmedium für Ideologien, um die öffentliche Meinung in einer Zeit zunehmender Alphabetisierung zu beeinflussen.