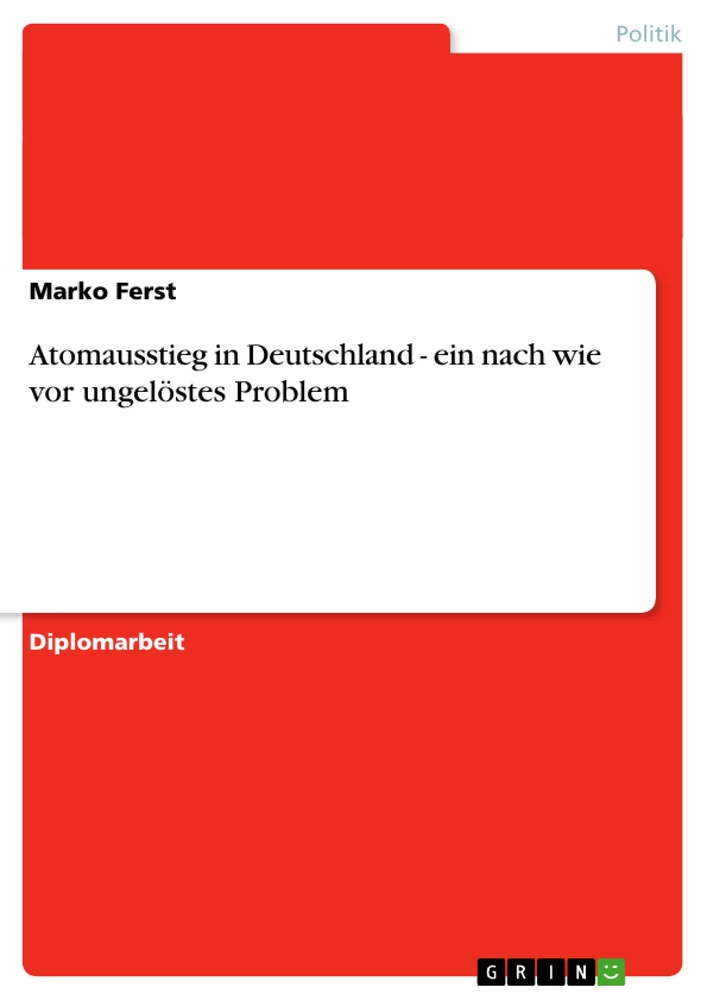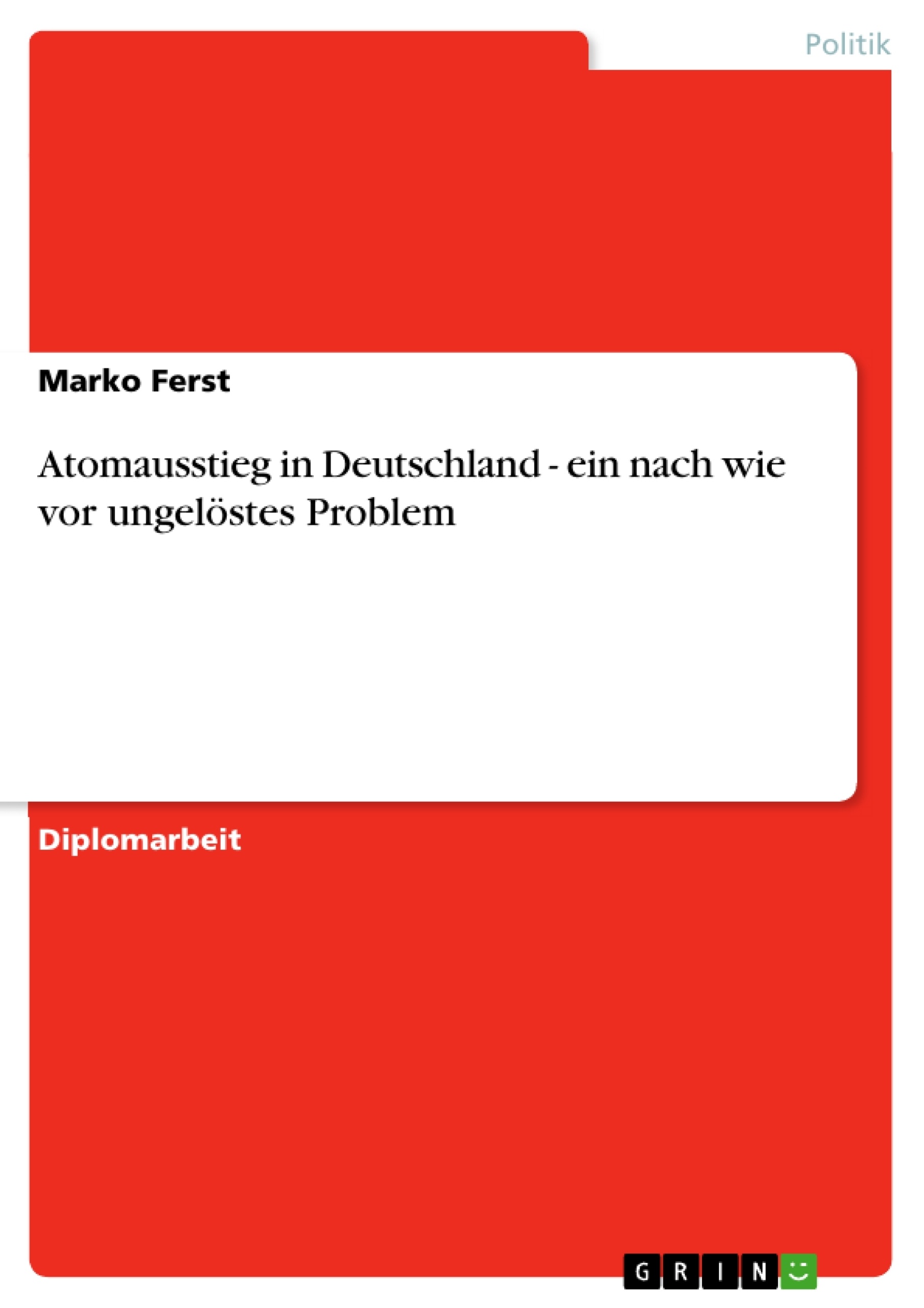Die rot-grüne Bundesregierung vereinbarte zusammen mit vier Energiekonzernen einen langfristigen Ausstieg aus der atomaren Energieerzeugung in Deutschland. Dieser wurde in der sogenannten „Konsensvereinbarung“ festgehalten und am 10. Juni 2001 unterzeichnet. Ergebnis ist, die Energieerzeugung in Atomkraftwerken wird noch bis mindestens 2021 fortgeführt. Zu rechnen ist damit, der endgültige Ausstieg verzögert sich um weitere Jahre. Auch kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, daß es in ein, zwei Jahrzehnten zum Neubau von Atomkraftwerken in Deutschland kommt. Stellt eine CDU/CSU-geführte Regierung die entsprechenden Milliardensubventionen zur Verfügung, kann es durchaus zum Bau neuer Anlagen kommen, wie sie in Finnland oder den USA etc. derzeit geplant werden.
Frameatome ANP bekundete, wie gerne sie auch in Deutschland 5-6 neue Atomanlagen bis 2020 bauen würden. Vermutlich scheitert dies in Deutschland an massiven Protesten von Bürgern und Bürgerinnen, der Antiatom- und weiteren Umweltbewegung. Doch auch darin sei man sich nicht zu sicher. Der Atomreaktor FRM2 in Garching konnte am 9. Juni 2004, zwar unter Protest von Umweltaktiven, jedoch ohne große Probleme in Betrieb gehen. Er wurde zu Forschungszwecken errichtet, nicht zur Stromproduktion.
Die zentrale Fragestellung der Arbeit ist, welche Probleme bleiben durch die weitere Nutzung von Atomkraftwerken und die dabei anfallenden hochradioaktiven Abfällen ungelöst. Auswahlkriterium und Klammer für die in der Arbeit behandelten Probleme bei der Nutzung der Atomenergie sind die hohen Gefährdungspotentiale für die Gesellschaft bzw. die zukünftigen Generationen, die davon ausgehen. Für die Arbeit ist leitend, daß ökologische Zukunftsvorsorge, bezogen auch auf alle kommenden Generationen, Vorrang haben muß, vor kurzfristigen, von Politik und gesellschaftlichen Minderheiten eingeforderten Nutzenserwägungen bei der atomaren Energieerzeugung.
Einzuschätzen wird sein, ob der vereinbarte Atomkonsens, unter Einbezug aktueller politischer Entwicklungen, wirklich als ein Ausstieg aus der Atomtechnologie in Deutschland gesehen werden kann, oder welche Einschränkungen diesbezüglich erkennbar sind. Eine abschließende solide Bewertung dürfte insofern schwierig bleiben, als sich erst im nächsten Jahrzehnt zeigen wird, ob die Vereinbarung zum längerfristigen Atomausstieg in den wesentlichen Punkten eingehalten oder wieder aufgehoben wird.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Einleitung und Grundeinstellungen
- 2. Atomkraft in Deutschland: Ein kurzer Abriß
- 3. Situation der weltweiten AKW-Entwicklung
- II. Eckpunkte beim „Atomkonsens“
- III. Über die mangelnde Konsistenz rot-grüner Atompolitik
- IV. Protestkultur, Gesellschaft und Politik beim atomaren Ausstiegspoker
- V. Die Zukunft der Atomkraft: Die Einschätzung der Parteien und Verbände
- 1. Die Akteure und ihre Orientierung
- 2. SPD
- 3. CDU/CSU
- 4. Bündnis 90/ Die Grünen
- 5. FDP
- 6. PDS
- 7. Anti-Atom-Bewegung
- 8. BUND und Greenpeace
- 9. Atomenergiewirtschaft
- 10. Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie und die Gewerkschaft ver.di
- VI. Atomkatastrophe in einem AKW jederzeit möglich
- 1. Reaktoren in Deutschland sind nicht frei von Störfällen
- 2. Was können wir aus der Atomkatastrophe in Tschernobyl lernen?
- 3. Rechtliche Konsequenzen
- VII. Die Gefahr von Terroranschlägen auf Atomkraftwerke
- 1. Rückblick im Kontext der Anschläge vom 11. September 2001
- 2. Die GRS-Studie zu AKW-Flugzeuganschlägen und die Konsequenzen
- 3. Weitere Sicherheitsaspekte und -risiken
- 4. AKW-Betrieb ist Staatsversagen
- VIII. Die Endlagerung von hochradioaktivem Atommüll
- 1. Grundfragen für die Lagerung
- 2. Warum ist Gorleben als Endlager untauglich?
- 3. Neue Konzepte der rot-grünen Regierung für die Endlagerung
- 4. Suchwege für eine bestmögliche Endlagerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ungelösten Probleme des deutschen Atomausstiegs, insbesondere die hohen Gefährdungspotentiale für die Gesellschaft und zukünftige Generationen. Die Analyse konzentriert sich auf die Risiken der Atomkraftnutzung, die politische Umsetzung des Atomkonsenses und die gesellschaftlichen Reaktionen darauf.
- Risiken der Atomkraftnutzung (Unfallgefahr, Terrorismus, Endlagerung)
- Politische Umsetzung des Atomkonsenses und dessen Mängel
- Gesellschaftliche Reaktionen und die Rolle der Anti-Atom-Bewegung
- Bewertung der Positionen verschiedener Parteien und Verbände
- Möglichkeiten eines schnelleren Atomausstiegs
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Dieses Kapitel legt die zentralen Fragestellungen der Arbeit dar: die ungelösten Probleme der Atomkraftnutzung in Deutschland, insbesondere die hohen Risiken für die Gesellschaft und zukünftige Generationen. Es wird der "Atomkonsens" von 2001 vorgestellt und dessen mögliche Unzulänglichkeiten thematisiert. Der Fokus liegt auf der ökologischen Zukunftsvorsorge und der Bewertung der bestehenden politischen Maßnahmen. Ein kurzer geschichtlicher Überblick über die Atomkraft in Deutschland und die weltweite Situation wird gegeben. Die Methodik der Arbeit wird ebenfalls erläutert, die politikwissenschaftliche Analyse wird in einen interdisziplinären Kontext eingebettet.
II. Eckpunkte beim „Atomkonsens“: Dieses Kapitel analysiert die "Vereinbarung über die geordnete Beendigung der Nutzung der Kernenergie in Deutschland" von 2001. Es werden die Kernpunkte des Kompromisses zwischen Regierung und Atomkonzernen beleuchtet, wie die festgelegten Restlaufzeiten der Atomkraftwerke und die Regelung zur Endlagerung von Atommüll. Kritisch beleuchtet werden die Mängel des Konsenses, die mangelnde Beteiligung der Zivilgesellschaft und die flexiblen Regelungen, die zu Verzögerungen beim Atomausstieg führen könnten.
III. Über die mangelnde Konsistenz rot-grüner Atompolitik: Dieses Kapitel untersucht, inwieweit die rot-grüne Bundesregierung ihren eigenen Zielen des Atomausstiegs gerecht wird. Es werden Beispiele für politische Maßnahmen genannt, die gegen den erklärten Ausstiegswillen sprechen, wie z.B. die Erweiterung von Urananreicherungsanlagen und die Gewährung von Hermeskrediten für Atomkraftwerke im Ausland. Der Fokus liegt auf der Inkonsistenz der Politik und dem Verdacht einer verdeckten Pro-Atompolitik.
IV. Protestkultur, Gesellschaft und Politik beim atomaren Ausstiegspoker: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte und die Strategien der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland, insbesondere im Kontext der Castortransporte. Es werden die Protestaktionen, die Reaktion der Polizei und die öffentliche Debatte analysiert. Der Kapitel beleuchtet die Wechselwirkung zwischen Protestkultur, gesellschaftlicher Meinung und politischer Reaktion auf die Atomkraftproblematik. Der anhaltende Widerstand trotz des Atomkonsenses wird hervorgehoben.
V. Die Zukunft der Atomkraft: Die Einschätzung der Parteien und Verbände: Dieses Kapitel präsentiert die Positionen verschiedener politischer Parteien (SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, PDS) und gesellschaftlicher Akteure (Umweltverbände, Atomindustrie, Gewerkschaften) zum Atomausstieg. Es werden deren Argumente und Strategien im Kontext des Atomkonsenses analysiert, die Bandbreite der Meinungen und die unterschiedlichen Interessenlagen hervorgehoben.
VI. Atomkatastrophe in einem AKW jederzeit möglich: Dieses Kapitel behandelt die Unfallgefahr in deutschen Atomkraftwerken. Es wird auf die technischen Mängel älterer Anlagen, das Risiko von Kernschmelzen und die unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen eingegangen. Der Reaktorunfall von Tschernobyl dient als Beispiel für die möglichen katastrophalen Folgen eines GAU und die langfristigen gesundheitlichen und ökologischen Schäden. Die rechtlichen Konsequenzen des fortgesetzten AKW-Betriebs werden diskutiert.
VII. Die Gefahr von Terroranschlägen auf Atomkraftwerke: Dieses Kapitel befasst sich mit der erhöhten Terrorgefahr für Atomkraftwerke im Kontext des 11. Septembers 2001. Es wird die GRS-Studie zu AKW-Flugzeuganschlägen und deren Geheimhaltung thematisiert. verschiedene Sicherheitsaspekte und mögliche Schutzmaßnahmen werden analysiert. Die Schlussfolgerung ist, dass der fortgesetzte Betrieb deutscher Atomkraftwerke ein Staatsversagen darstellt.
VIII. Die Endlagerung von hochradioaktivem Atommüll: Dieses Kapitel analysiert die Problematik der Endlagerung von Atommüll. Es werden die grundlegenden Fragen der Lagerungszeiträume, die Ungeeignetheit von Gorleben als Endlager und neue Konzepte der Bundesregierung behandelt. verschiedene mögliche Standorte und die Herausforderungen der Langzeitsicherung werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer internationalen Verantwortung bei der Endlagerung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Atomausstieg, Atomkraft, Atomkonsens, Reaktorsicherheit, Terrorismus, Endlagerung, Atommüll, Anti-Atom-Bewegung, Risikowahrnehmung, Umweltpolitik, Energiepolitik, Gesundheitsrisiken, rechtliche Aspekte, gesellschaftlicher Konsens, erneuerbare Energien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Ungelöste Probleme des deutschen Atomausstiegs
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert die ungelösten Probleme des deutschen Atomausstiegs, insbesondere die hohen Gefährdungspotenziale für die Gesellschaft und zukünftige Generationen. Es konzentriert sich auf die Risiken der Atomkraftnutzung, die politische Umsetzung des Atomkonsenses von 2001 und die gesellschaftlichen Reaktionen darauf.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt umfassend verschiedene Aspekte des Atomausstiegs in Deutschland. Dies beinhaltet die Risiken der Atomkraftnutzung (Unfallgefahr, Terrorismus, Endlagerung), die politische Umsetzung des Atomkonsenses und dessen Mängel, die gesellschaftlichen Reaktionen und die Rolle der Anti-Atom-Bewegung, die Bewertung der Positionen verschiedener Parteien und Verbände sowie Möglichkeiten eines schnelleren Atomausstiegs. Es wird ein historischer Überblick gegeben und die einzelnen Kapitel des Dokuments fassen die jeweiligen Themenschwerpunkte zusammen.
Was ist der „Atomkonsens“ und welche Kritikpunkte werden genannt?
Der „Atomkonsens“ von 2001 ist eine Vereinbarung über die geordnete Beendigung der Nutzung der Kernenergie in Deutschland. Das Dokument kritisiert den Konsens aufgrund von Mängeln, mangelnder Beteiligung der Zivilgesellschaft und flexiblen Regelungen, die zu Verzögerungen beim Atomausstieg führen könnten. Die Inkonsistenz der rot-grünen Regierungspolitik bezüglich des Atomausstiegs wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielt die Anti-Atom-Bewegung?
Das Dokument beschreibt die Geschichte und Strategien der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland, insbesondere im Kontext der Castortransporte. Es analysiert Protestaktionen, die Reaktion der Polizei und die öffentliche Debatte, wobei der anhaltende Widerstand trotz des Atomkonsenses hervorgehoben wird.
Welche Positionen nehmen die verschiedenen Parteien und Verbände ein?
Das Dokument präsentiert und analysiert die Positionen verschiedener Parteien (SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, PDS) und gesellschaftlicher Akteure (Umweltverbände, Atomindustrie, Gewerkschaften) zum Atomausstieg, ihre Argumente und Strategien im Kontext des Atomkonsenses, die Bandbreite der Meinungen und die unterschiedlichen Interessenlagen.
Wie wird die Unfallgefahr in deutschen Atomkraftwerken bewertet?
Das Dokument behandelt die Unfallgefahr in deutschen Atomkraftwerken, die technischen Mängel älterer Anlagen, das Risiko von Kernschmelzen und die unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen. Der Reaktorunfall von Tschernobyl dient als Beispiel für mögliche katastrophale Folgen und die langfristigen gesundheitlichen und ökologischen Schäden. Die rechtlichen Konsequenzen des fortgesetzten AKW-Betriebs werden diskutiert.
Wie wird die Terrorgefahr für Atomkraftwerke bewertet?
Das Dokument befasst sich mit der erhöhten Terrorgefahr für Atomkraftwerke im Kontext des 11. Septembers 2001. Es wird die GRS-Studie zu AKW-Flugzeuganschlägen und deren Geheimhaltung thematisiert. Verschiedene Sicherheitsaspekte und mögliche Schutzmaßnahmen werden analysiert, wobei der fortgesetzte Betrieb als Staatsversagen bewertet wird.
Wie wird die Problematik der Endlagerung von Atommüll dargestellt?
Das Dokument analysiert die Problematik der Endlagerung von Atommüll, die grundlegenden Fragen der Lagerungszeiträume, die Ungeeignetheit von Gorleben als Endlager und neue Konzepte der Bundesregierung. Verschiedene mögliche Standorte und die Herausforderungen der Langzeitsicherung werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer internationalen Verantwortung wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Atomausstieg, Atomkraft, Atomkonsens, Reaktorsicherheit, Terrorismus, Endlagerung, Atommüll, Anti-Atom-Bewegung, Risikowahrnehmung, Umweltpolitik, Energiepolitik, Gesundheitsrisiken, rechtliche Aspekte, gesellschaftlicher Konsens, erneuerbare Energien.
- Quote paper
- Marko Ferst (Author), 2004, Atomausstieg in Deutschland - ein nach wie vor ungelöstes Problem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33780