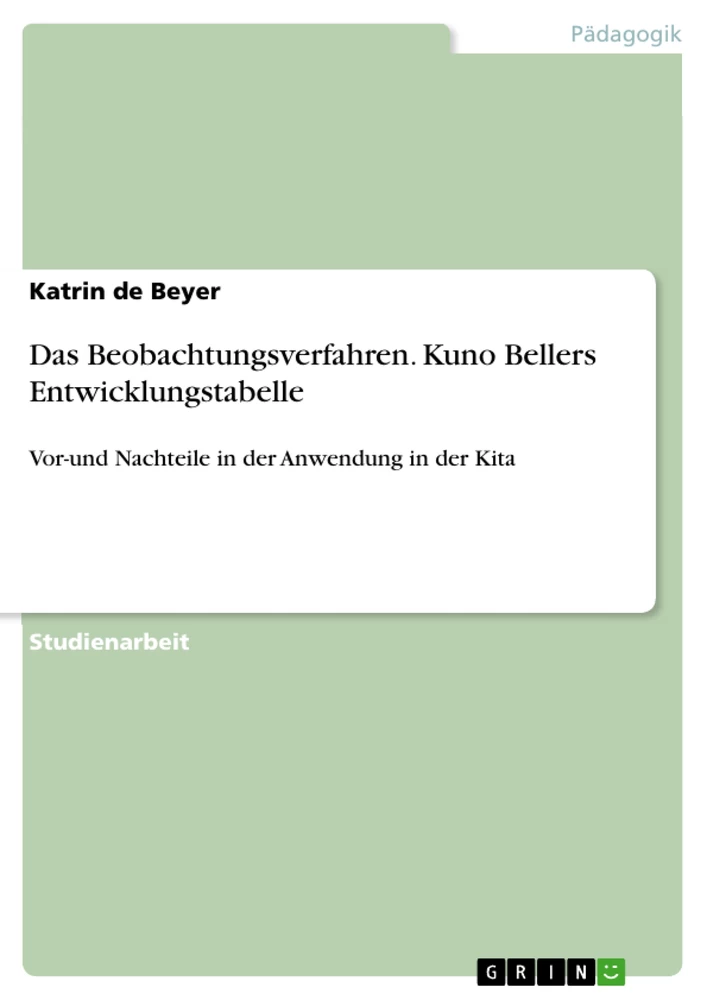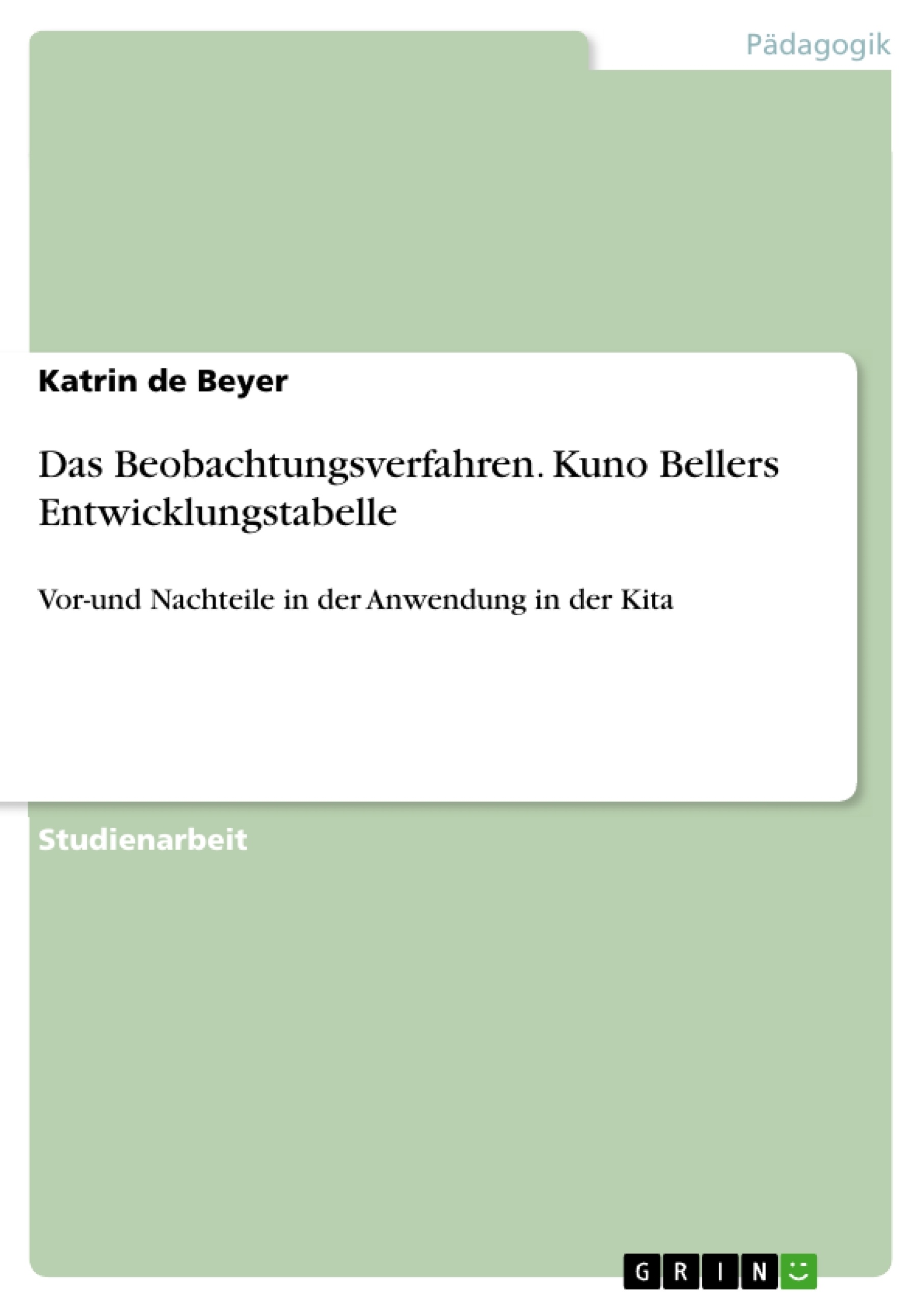Diese Hausarbeit beschäftigt sich im weitesten Sinne mit dem Thema Beobachten und Dokumentieren, konkret mit der Entwicklungstabelle von Prof. Dr. E. K. Beller und S. Beller. Zu Beginn soll der Begriff Beobachtung erklärt werden. Im weiteren Verlauf wird dann erörtert warum, was und wie in der Praxis beobachtet wird.
Um das Verfahren in einem Gesamtkontext zu sehen, stellt die Autorin ein Beobachtungssystem vor und bette die Tabelle darin ein.
Im weiteren Verlauf wird dann der Aufbau, die Funktion und die Anwendung der Entwicklungstabelle ausführlich beschrieben und auf die Erfahrungsangebote eingegangen.
Im Anschluss daran berichtet die Autorin von eigenen Erfahrungen in der Kita und wägt die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen der Beobachtung
- 2.1 Begriffsklärung
- 2.2 Warum beobachten wir
- 2.3 Was beobachten wir
- 2.4 Wie beobachten wir
- 3 Einordnung ins Beobachtungssystem
- 3.1 Erste Säule
- 3.2 Zweite Säule
- 3.3 Dritte Säule
- 4 Kuno Bellers Entwicklungstabelle
- 4.1 Aufbau
- 4.2 Funktion und Anwendung
- 4.3 Berechnung und Auswertung
- 4.3 Erfahrungsangebote
- 5 Resümee
- 5.1 Eigene Erfahrungen
- 5.2 Vor- und Nachteile
- 5.3 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beobachtung und Dokumentation in der frühkindlichen Bildung, fokussiert auf die Entwicklungstabelle von Prof. Dr. E. K. Beller und S. Beller. Die Arbeit erklärt den Begriff der Beobachtung, untersucht deren praktische Anwendung und ordnet die Tabelle in ein umfassenderes Beobachtungssystem ein. Der Hauptteil befasst sich detailliert mit Aufbau, Funktion und Anwendung der Tabelle, inklusive der Erfahrungsangebote.
- Begriffserklärung und verschiedene Arten der Beobachtung
- Einordnung der Beobachtung in ein umfassendes System
- Detaillierte Beschreibung der Entwicklungstabelle von Kuno Beller
- Praxisbezogene Erfahrungen und deren Bewertung
- Vor- und Nachteile des beschriebenen Verfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und benennt den Fokus auf die Beobachtung und Dokumentation, speziell mit der Entwicklungstabelle von Beller. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich von der Begriffsklärung der Beobachtung über deren Einordnung in ein System bis hin zur praktischen Anwendung und persönlichen Erfahrungen erstreckt. Die Wahl des Themas wird mit der langjährigen Erfahrung der Autorin in der entsprechenden Einrichtung begründet.
2 Grundlagen der Beobachtung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Beobachtung fest. Es definiert den Begriff "Beobachtung" nach Büchin-Wilhelm und Jaszus (2011) als "geplante, aufmerksame Wahrnehmung von Ereignissen, Vorgängen sowie von Menschen in ihren Reaktionen und Handlungen". Es wird zwischen freier und systematischer Beobachtung unterschieden. Weiterhin werden die Gründe für Beobachtungen in pädagogischen Einrichtungen erörtert, mit dem Fokus auf die Bedeutung für die kindliche Entwicklung, den kollegialen Austausch und die Elterngespräche. Es werden verschiedene Beobachtungsweisen im Kita-Alltag beschrieben und die Gefahren oberflächlicher Beobachtungen betont, die zu unvollständigen Einschätzungen führen können.
3 Einordnung ins Beobachtungssystem: Dieses Kapitel beschreibt ein Beobachtungssystem nach Viernickel und Völkel (2009), das auf dem „Baukastenprinzip“ basiert und drei Säulen umfasst: Prozesse beobachtende Verfahren, merkmalsorientierte Verfahren und Verfahren zum Erkennen von Entwicklungsrisiken. Jede Säule wird detailliert erläutert, mit Beispielen für die jeweiligen Verfahren. Der Ansatz betont die Notwendigkeit, verschiedene Verfahren zu kombinieren, um ein umfassendes und differenziertes Bild der kindlichen Entwicklung zu erhalten. Dies ermöglicht eine individuelle und ganzheitliche Betrachtungsweise des Kindes.
4 Kuno Bellers Entwicklungstabelle: Dieser Abschnitt widmet sich ausführlich der Entwicklungstabelle von Kuno Beller. Er beschreibt den Aufbau, die Funktion und Anwendung der Tabelle und geht auf die angebotenen Erfahrungen ein. Dies ist der umfangreichste Teil der Arbeit und analysiert die Tabelle im Detail. Hier werden Berechnung und Auswertung der Tabelle behandelt und es wird eingegangen, wie die Tabelle in der Praxis angewendet und interpretiert werden kann. Die Bedeutung der Tabelle für die pädagogische Arbeit und die Förderung der kindlichen Entwicklung wird eingehend erläutert.
Schlüsselwörter
Beobachtung, Dokumentation, frühkindliche Bildung, Entwicklungstabelle, Kuno Beller, Beobachtungssystem, Entwicklungsrisiken, Ressourcenorientierung, pädagogische Praxis, Kita.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Beobachtung und Dokumentation in der frühkindlichen Bildung mit Schwerpunkt auf der Entwicklungstabelle von Kuno Beller
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit Beobachtung und Dokumentation in der frühkindlichen Bildung. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklungstabelle von Prof. Dr. E. K. Beller und S. Beller. Die Arbeit untersucht den Begriff der Beobachtung, deren praktische Anwendung und die Einordnung der Tabelle in ein umfassenderes Beobachtungssystem.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: Begriffserklärung und verschiedene Arten der Beobachtung, Einordnung der Beobachtung in ein umfassendes System, detaillierte Beschreibung der Entwicklungstabelle von Kuno Beller, praxisbezogene Erfahrungen und deren Bewertung sowie Vor- und Nachteile des beschriebenen Verfahrens.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlagen der Beobachtung, Einordnung ins Beobachtungssystem, Kuno Bellers Entwicklungstabelle und Resümee. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Beobachtung und Dokumentation, beginnend mit der Begriffsklärung und theoretischen Grundlagen bis hin zur praktischen Anwendung und persönlichen Erfahrungen der Autorin.
Was sind die zentralen Inhalte des Kapitels "Grundlagen der Beobachtung"?
Dieses Kapitel definiert den Begriff "Beobachtung", unterscheidet zwischen freier und systematischer Beobachtung, erörtert die Gründe für Beobachtungen in pädagogischen Einrichtungen und beschreibt verschiedene Beobachtungsweisen im Kita-Alltag. Es betont die Gefahren oberflächlicher Beobachtungen und deren Auswirkungen auf die Einschätzung der kindlichen Entwicklung.
Was wird im Kapitel "Einordnung ins Beobachtungssystem" erläutert?
Dieses Kapitel beschreibt ein Beobachtungssystem nach Viernickel und Völkel (2009), das auf drei Säulen basiert: prozessbeobachtende Verfahren, merkmalsorientierte Verfahren und Verfahren zum Erkennen von Entwicklungsrisiken. Es erklärt jede Säule detailliert und betont die Notwendigkeit, verschiedene Verfahren zu kombinieren, um ein umfassendes Bild der kindlichen Entwicklung zu erhalten.
Worauf konzentriert sich das Kapitel über Kuno Bellers Entwicklungstabelle?
Dieser Abschnitt beschreibt ausführlich den Aufbau, die Funktion und Anwendung der Entwicklungstabelle von Kuno Beller. Er analysiert die Tabelle im Detail, behandelt Berechnung und Auswertung und erläutert deren Anwendung und Interpretation in der pädagogischen Praxis. Die Bedeutung der Tabelle für die Förderung der kindlichen Entwicklung wird eingehend dargestellt.
Was beinhaltet das Resümee der Hausarbeit?
Das Resümee fasst die eigenen Erfahrungen der Autorin zusammen, bewertet Vor- und Nachteile des beschriebenen Verfahrens und bietet eine abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse. Es reflektiert die gewonnenen Erkenntnisse aus der Anwendung der Entwicklungstabelle von Kuno Beller im Kontext der frühkindlichen Bildung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Beobachtung, Dokumentation, frühkindliche Bildung, Entwicklungstabelle, Kuno Beller, Beobachtungssystem, Entwicklungsrisiken, Ressourcenorientierung, pädagogische Praxis, Kita.
Welche Beobachtungssystematik wird in der Arbeit vorgestellt?
Die Hausarbeit stellt ein Beobachtungssystem nach Viernickel und Völkel (2009) vor, das auf dem „Baukastenprinzip“ basiert und drei Säulen umfasst: Prozesse beobachtende Verfahren, merkmalsorientierte Verfahren und Verfahren zum Erkennen von Entwicklungsrisiken. Die Arbeit betont die Kombination verschiedener Verfahren für eine umfassende und differenzierte Betrachtung der kindlichen Entwicklung.
Wie wird die Entwicklungstabelle von Kuno Beller in der Arbeit eingeordnet?
Die Entwicklungstabelle von Kuno Beller wird detailliert beschrieben und in das vorgestellte Beobachtungssystem nach Viernickel und Völkel eingeordnet. Die Arbeit analysiert Aufbau, Funktion und Anwendung der Tabelle und zeigt auf, wie sie in der Praxis angewendet und interpretiert werden kann, um die kindliche Entwicklung zu fördern.
- Quote paper
- Katrin de Beyer (Author), 2014, Das Beobachtungsverfahren. Kuno Bellers Entwicklungstabelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337814