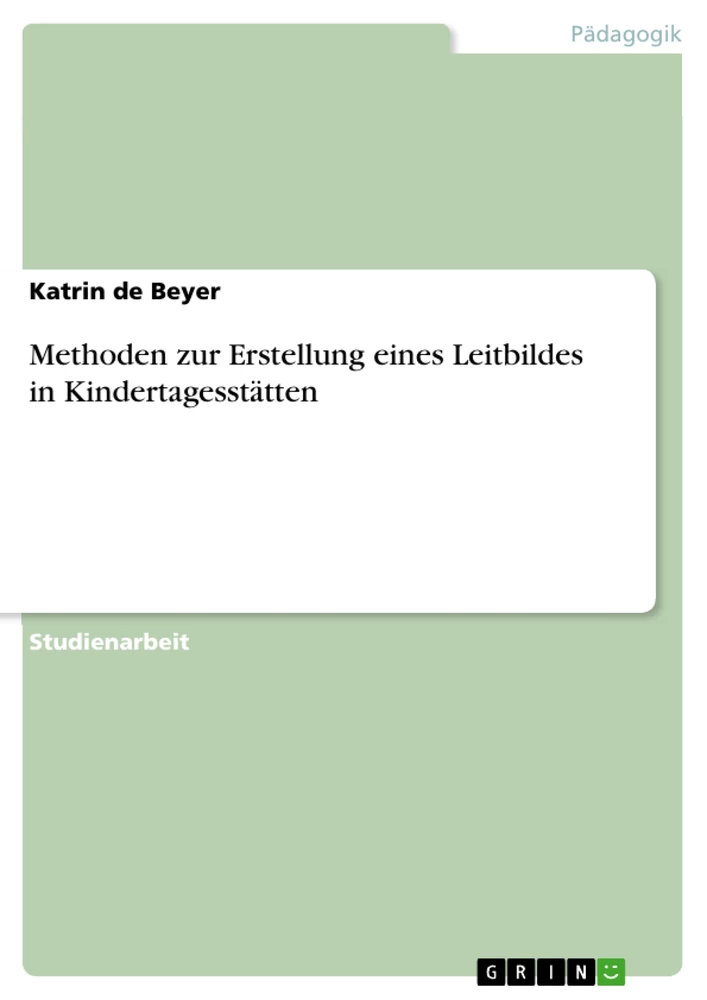Diese Hausarbeit umfasst die wichtigsten Informationen zu einem Leitbild in Kindertageseinrichtungen und eine persönliche Stellungnahme zu den beiden Fragen „Ist es sinnvoll, wenn das Leitbild vom Träger schon vorgegeben wird?“ und „Was spricht für oder gegen einen externen Berater bei der Erstellung eines Leitbildes?“.
Zu Beginn wird eine Abbildung vorgestellt, in der die unterschiedlichen Formen von Kitaarbeit beschrieben werden und der Begriff Leitbild eingeordnet wird.
Darauf folgt die Erläuterung des Begriffs Leitbild in Bezug auf Kitas und die Vorstellung der Rahmenbedingungen zum Erstellen und die Nutzen eines solchen.
Dem folgt die Vorstellung zweier Methoden zur Erstellung eines Leitbildes, mit denen es möglich ist, die Werte eines Teams zu erarbeiten und zu visualisieren. Das sind exemplarisch das Seerosenmodell und das Werteprofil nach Steven Reiss.
Daran schließt sich der Prozess der Erstellung eines Leitbildes an. Hier werden allgemeine Informationen zur Durchführung, Strukturierungshilfen zur Formulierung und methodische Vorschläge, wie man das Leitbild implementieren kann, gegeben.
Im letzten Kapitel geht es um die Frage „Ist es sinnvoll, wenn das Leitbild vom Träger schon vorgegeben wird?“ und die Frage „Was spricht für oder gegen einen externen Berater bei der Erstellung eines Leitbildes?“ Beide Fragen werden unabhängig von einander betrachtet und zu jeder Frage wurde ein eigenes Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ein Leitbild
- 2.1 Was zum Erstellen eines Leitbildes nötig ist
- 2.2 Funktionen eines Leitbildes
- 2.3 Anlässe für eine Leitbildentwicklung
- 3 Methoden zur Erstellung eines Leitbildes
- 3.1 Das Seerosenmodell
- 3.1.1 Der Einsatz des Seerosenmodells
- 3.2 Das Werteprofil von Steven Reiss
- 3.2.1 Der Einsatz des Werteprofils
- 3.1 Das Seerosenmodell
- 4 Prozess der Erstellung eines Leitbildes
- 4.1 Strukturierung des Leitbildes
- 4.2 Implementierung
- 5 Fazit
- 5.1 „Ist es sinnvoll, wenn das Leitbild vom Träger schon vorgegeben wird?“
- 5.2 „Was spricht für oder gegen einen externen Berater bei der Erstellung eines Leitbildes?“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Erstellung und Implementierung von Leitbildern in Kindertageseinrichtungen. Sie beleuchtet die notwendigen Schritte, Methoden und Herausforderungen dieses Prozesses. Zusätzlich wird eine persönliche Stellungnahme zu der Rolle des Trägers und der Verwendung externer Berater abgegeben.
- Definition und Bedeutung von Leitbildern in Kindertagesstätten
- Methoden zur Entwicklung eines Leitbildes (Seerosenmodell, Werteprofil nach Reiss)
- Prozess der Leitbilderstellung und Implementierung
- Rolle des Trägers bei der Leitbildentwicklung
- Nutzen externer Beratung bei der Leitbildentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Leitbilder in Kindertageseinrichtungen ein und beschreibt den Umfang der Arbeit. Sie skizziert den Aufbau der Hausarbeit, der von der Vorstellung verschiedener Kita-Arbeitsformen über die Definition eines Leitbildes bis hin zur Diskussion externer Beratung reicht. Die Einleitung betont die Bedeutung des Leitbildes als Kern der Kita-Kultur und Grundlage der pädagogischen Arbeit.
2 Ein Leitbild: Dieses Kapitel definiert den Begriff Leitbild im Kontext von Kindertagesstätten anhand des Modells von Viva Fialka. Das Haus-Modell (Basis: Leitbild, Raum & Dach: Konzeption, Kamin: Profil, Luft: Qualitätsmanagement) veranschaulicht die zentrale Rolle des Leitbildes als Basis des Selbstverständnisses und der gemeinsamen Ziele der Mitarbeiter. Es wird die Bedeutung des Leitbildes für die pädagogische Arbeit und die Elternentscheidung hervorgehoben.
3 Methoden zur Erstellung eines Leitbildes: Dieses Kapitel präsentiert zwei Methoden zur Entwicklung von Leitbildern: das Seerosenmodell und das Werteprofil nach Steven Reiss. Das Seerosenmodell visualisiert den Zusammenhang zwischen Verhalten, Einstellungen, Werten und Umfeld, ermöglicht die Reflexion von Alltagssituationen und das Ableiten von Teamwerten. Das Werteprofil von Reiss hingegen nutzt 16 Lebensmotive zur Analyse individueller und gemeinsamer Werte im Team, um Konflikte zu minimieren und die Übereinstimmung mit den Werten der Eltern sicherzustellen. Beide Methoden zielen auf die Visualisierung und den Konsens über die Werte des Teams.
4 Prozess der Erstellung eines Leitbildes: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Leitbildentwicklung, inklusive Strukturierung und Implementierung. Es betont die aktive Beteiligung aller pädagogischen Fachkräfte und die Rolle der Leitung bei der Organisation und Moderation des Prozesses. Der Fokus liegt auf der methodischen Vorgehensweise, der Entwicklung von Formulierungshilfen und der praktischen Umsetzung des Leitbildes in der täglichen Arbeit.
Schlüsselwörter
Leitbild, Kindertageseinrichtung, Kita, Werte, Methoden, Seerosenmodell, Werteprofil, Steven Reiss, Leitbildentwicklung, Implementierung, Team, Träger, externe Beratung, Qualitätsmanagement, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Leitbilder in Kindertageseinrichtungen
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit der Erstellung und Implementierung von Leitbildern in Kindertageseinrichtungen. Sie beschreibt die notwendigen Schritte, Methoden und Herausforderungen dieses Prozesses und beinhaltet eine persönliche Stellungnahme zur Rolle des Trägers und der Nutzung externer Berater.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Bedeutung von Leitbildern in Kitas, Methoden zur Leitbildentwicklung (Seerosenmodell, Werteprofil nach Reiss), Prozess der Leitbilderstellung und -implementierung, Rolle des Trägers und der Nutzen externer Beratung.
Welche Methoden zur Leitbildentwicklung werden vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert zwei Methoden: das Seerosenmodell, das den Zusammenhang zwischen Verhalten, Einstellungen, Werten und Umfeld visualisiert, und das Werteprofil nach Steven Reiss, welches 16 Lebensmotive zur Analyse individueller und gemeinsamer Werte nutzt. Beide Methoden zielen auf die Visualisierung und den Konsens über die Werte des Teams ab.
Wie wird der Prozess der Leitbildentwicklung beschrieben?
Der Prozess umfasst die Strukturierung und Implementierung des Leitbildes. Die aktive Beteiligung aller pädagogischen Fachkräfte und die Rolle der Leitung bei Organisation und Moderation werden betont. Die methodische Vorgehensweise, die Entwicklung von Formulierungshilfen und die praktische Umsetzung in der täglichen Arbeit stehen im Fokus.
Welche Rolle spielt der Träger bei der Leitbildentwicklung?
Die Hausarbeit diskutiert die Frage nach der Rolle des Trägers und ob es sinnvoll ist, wenn das Leitbild vom Träger vorgegeben wird. Diese Frage wird im Fazit der Arbeit ausführlich behandelt.
Wann ist die Inanspruchnahme externer Beratung sinnvoll?
Die Hausarbeit diskutiert die Vor- und Nachteile der Nutzung externer Berater bei der Erstellung eines Leitbildes. Diese Frage wird im Fazit der Arbeit ausführlich behandelt.
Welche Kapitel enthält die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Ein Leitbild (inkl. Definition, Funktionen und Anlässe), Methoden zur Erstellung eines Leitbildes (Seerosenmodell und Werteprofil nach Reiss), Prozess der Erstellung eines Leitbildes (inkl. Strukturierung und Implementierung) und Fazit (inkl. Diskussion der Rolle des Trägers und externer Beratung).
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Eine Zusammenfassung jedes Kapitels ist im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" enthalten. Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über den Inhalt jedes einzelnen Kapitels.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Leitbild, Kindertageseinrichtung, Kita, Werte, Methoden, Seerosenmodell, Werteprofil, Steven Reiss, Leitbildentwicklung, Implementierung, Team, Träger, externe Beratung, Qualitätsmanagement, Pädagogik.
- Quote paper
- Katrin de Beyer (Author), 2015, Methoden zur Erstellung eines Leitbildes in Kindertagesstätten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337822