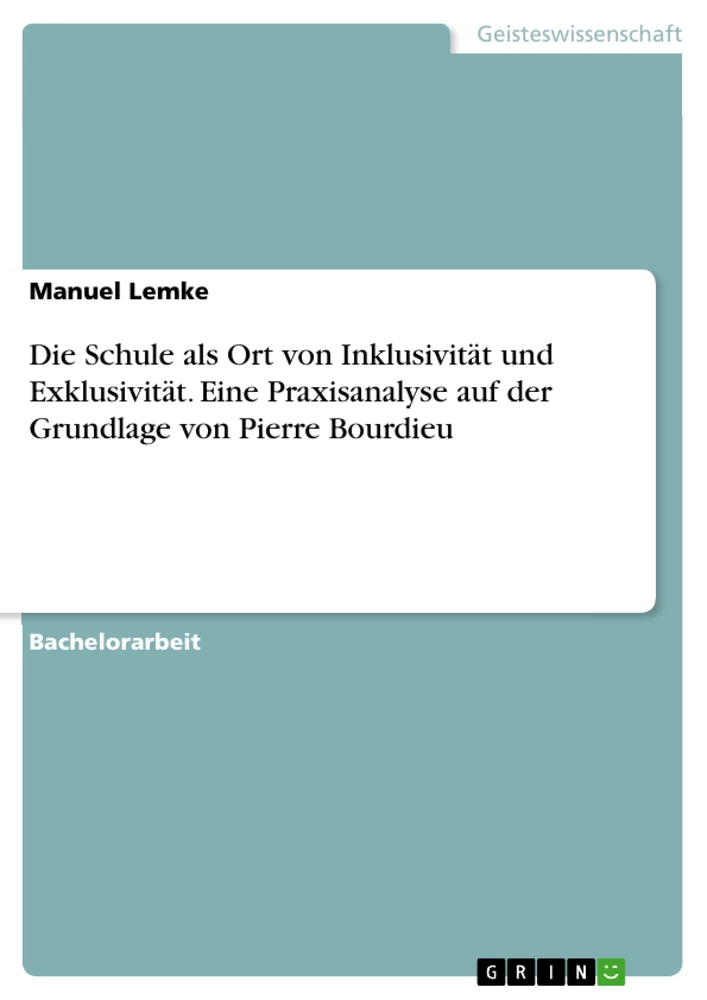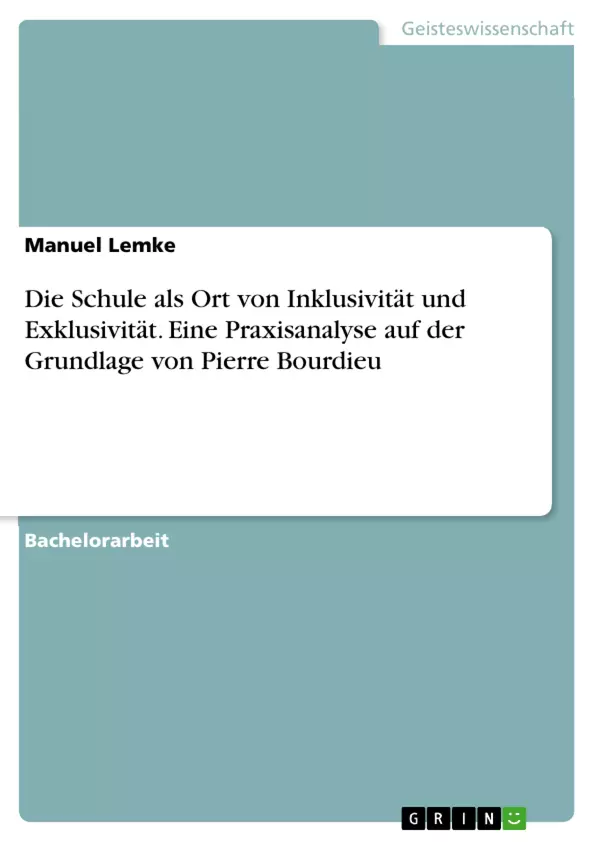Die vorliegende Bachelorarbeit wird sich kritisch mit dem Thema Schule als Medium von Inklusion und Exklusion auseinandersetzen. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die Exklusion gelegt, da diese ständig präsent zu sein scheint, gesellschaftlich jedoch kaum betrachtet wird. Dabei geht es nicht um Menschen mit einer Behinderung, da hierauf nicht zuletzt aufgrund der UN-BRK gesellschaftliches Interesse vorherrscht und immer wieder für Gesprächsstoff in den Medien sorgt.
Diese Bachelorarbeit widmet sich vielmehr den sogenannten Bildungsverlierern. Dies betrifft vor allem Kinder und auch Jugendliche aus Brennpunktgebieten, deren Eltern sie nicht ausreichend unterstützen können oder an der Armutsgrenze leben. Es gibt noch viele weite Parameter die eine Exklusion bedingen oder sogar fördern können, allerdings wird dies erst im Verlaufe dieser Arbeit erläutert. Der Fokus liegt auf den Bildungseinrichtungen, sowie den Eltern, wird jedoch um ein exakteres Gesamtbild zu konstruieren an manchen Stellen erweitert. Welchen facettenreichen Beitrag die Schulen zur Inklusion leisten, wird dabei nicht vergessen und auch immer wieder Gegenstand der Arbeit sein, jedoch nicht mit der Intensität betrachtet wie die Exklusion.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Exklusion
- 2.1.1 Ursprung und Herkunft des Exklusionsparadigmas
- 2.1.2 Exklusionsdefinition
- 2.2 Segregation
- 2.3 Inklusion
- 2.4 Integration
- 2.1 Exklusion
- 3. Habituskonzept
- 3.1 Kapitalformen
- 3.1.1 Kulturelles Kapital
- 3.1.2 Soziales Kapital
- 3.1.3 Symbolisches Kapital
- 3.2 Zusammenfassung des bourdieu'schen Konzeptes
- 3.1 Kapitalformen
- 4. Das deutsche Bildungssystem
- 4.1 Bildungsbereiche
- 4.2 Aufgaben Schule
- 5. Die Schule Ort von Inklusion und Exklusion
- 5.1 Darstellung von exklusionsfördernder Faktoren
- 5.1.1 Lehrkräfte
- 5.1.2 Eltern
- 5.1.3 Weitere Akteure/Aspekte
- 5.1 Darstellung von exklusionsfördernder Faktoren
- 6. Praxisanalyse
- 6.1 Betrachtung und Analyse des fünften Kapitels anhand der Kapitalformen
- 6.1.2 Armut und geringe Kapitalakkumulation
- 6.1.3 Das Schulsystem skandinavischer Länder
- 6.1.4 Schulsystem Kanada
- 6.2 Analyse des Bildungssystems
- 6.1 Betrachtung und Analyse des fünften Kapitels anhand der Kapitalformen
- 7. Praxisanalyse anhand des Habituskonzept nach Pierre Bourdieu
- 7.1 Soziale Herkunft und Migration
- 7.2 Beziehungen zwischen kulturellen Kapital und Bildung
- 7.3 Erziehung und Kapital der Eltern
- 7.3.1 Primäre Sozialisation
- 7.3.2 Inklusionsmedium Schule und die sekundäre Sozialisation
- 7.4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht kritisch die Schule als Ort von Inklusion und Exklusion, wobei der Fokus auf Exklusionsprozessen liegt, die gesellschaftlich oft übersehen werden. Im Mittelpunkt stehen "Bildungsverlierer", insbesondere Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen. Die Arbeit analysiert die Rolle von Bildungseinrichtungen und Eltern bei der Entstehung von Exklusion, berücksichtigt aber auch den Beitrag von Schulen zur Inklusion. Das Bourdieusche Habituskonzept dient als analytisches Werkzeug.
- Analyse von Exklusionsprozessen in Schulen
- Rolle von Lehrkräften und Eltern bei Inklusion und Exklusion
- Einfluss von sozialer Herkunft und Kapitalformen auf Bildungserfolg
- Anwendung des Habituskonzepts von Pierre Bourdieu auf das deutsche Bildungssystem
- Vergleich des deutschen Bildungssystems mit anderen Systemen (Skandinavien, Kanada)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt den Fokus auf Exklusionsprozesse in Schulen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen. Es wird die Bedeutung der Arbeit für das Verständnis gesellschaftlicher Ungleichheiten im Bildungsbereich hervorgehoben und die methodische Vorgehensweise kurz angerissen.
2. Definitionen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe Exklusion, Segregation, Inklusion und Integration. Es werden unterschiedliche Definitionen diskutiert und der Ursprung und die Herleitung des Exklusionsparadigmas erläutert. Dies legt die Grundlage für die spätere Analyse und schafft ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Terminologie.
3. Habituskonzept: Hier wird das Habituskonzept von Pierre Bourdieu ausführlich dargestellt und erklärt. Die verschiedenen Kapitalformen (kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) werden detailliert beschrieben und ihre Bedeutung für die Reproduktion sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem wird herausgestellt. Dieses Kapitel bildet die theoretische Grundlage für die spätere empirische Analyse.
4. Das deutsche Bildungssystem: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das deutsche Bildungssystem, beschreibt die verschiedenen Bildungsbereiche und die Aufgaben der Schule. Es dient als Kontextualisierung für die spätere Analyse der Inklusions- und Exklusionsprozesse im spezifischen deutschen Kontext.
5. Die Schule Ort von Inklusion und Exklusion: In diesem Kapitel werden exklusionsfördernde Faktoren in Schulen dargestellt. Es werden die Rollen von Lehrkräften, Eltern und weiteren Akteuren beleuchtet und deren Beitrag zur Entstehung von Exklusion analysiert. Die Kapitel beschreibt verschiedene Mechanismen und Strukturen die zur Exklusion führen können.
6. Praxisanalyse: Dieses Kapitel analysiert die im fünften Kapitel dargestellten exklusionsfördernden Faktoren anhand der Kapitalformen nach Bourdieu. Es werden Beispiele aus dem deutschen Schulsystem, sowie Vergleiche mit anderen Bildungssystemen (Skandinavien, Kanada) gezogen, um die Komplexität der Problematik zu verdeutlichen. Die Analyse fokussiert auf die Auswirkungen von Armut und geringer Kapitalakkumulation auf den Bildungserfolg.
7. Praxisanalyse anhand des Habituskonzept nach Pierre Bourdieu: Dieses Kapitel vertieft die Praxisanalyse unter Anwendung des Bourdieuschen Habituskonzepts. Es untersucht den Einfluss sozialer Herkunft und Migration, die Beziehung zwischen kulturellem Kapital und Bildung, sowie die Rolle von Erziehung und elterlichem Kapital (primäre und sekundäre Sozialisation) bei der Entstehung von Inklusion und Exklusion. Dieses Kapitel verbindet Theorie und Empirie auf detaillierte Weise.
Schlüsselwörter
Inklusion, Exklusion, Schule, Bildungssystem, Pierre Bourdieu, Habitus, Kapitalformen (kulturelles, soziales, symbolisches Kapital), soziale Ungleichheit, Bildungsverlierer, Armut, soziale Herkunft, Migration, Lehrkräfte, Eltern, Praxisanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Inklusion und Exklusion im deutschen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht kritisch die Schule als Ort von Inklusion und Exklusion, mit besonderem Fokus auf Exklusionsprozessen, die gesellschaftlich oft übersehen werden. Im Mittelpunkt stehen „Bildungsverlierer“, insbesondere Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen. Analysiert werden die Rolle von Bildungseinrichtungen und Eltern bei der Entstehung von Exklusion, aber auch der Beitrag von Schulen zur Inklusion. Das Bourdieusche Habituskonzept dient als analytisches Werkzeug.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse von Exklusionsprozessen in Schulen, die Rolle von Lehrkräften und Eltern bei Inklusion und Exklusion, den Einfluss sozialer Herkunft und Kapitalformen auf den Bildungserfolg, die Anwendung des Habituskonzepts von Pierre Bourdieu auf das deutsche Bildungssystem und einen Vergleich des deutschen Bildungssystems mit anderen Systemen (Skandinavien, Kanada).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein. Kapitel 2 (Definitionen) klärt zentrale Begriffe wie Exklusion, Segregation, Inklusion und Integration. Kapitel 3 (Habituskonzept) erklärt das Bourdieusche Habituskonzept und die Kapitalformen. Kapitel 4 (Das deutsche Bildungssystem) gibt einen Überblick über das deutsche Bildungssystem. Kapitel 5 (Die Schule – Ort von Inklusion und Exklusion) beschreibt exklusionsfördernde Faktoren in Schulen. Kapitel 6 (Praxisanalyse) analysiert diese Faktoren anhand der Kapitalformen und vergleicht das deutsche System mit anderen. Kapitel 7 (Praxisanalyse anhand des Habituskonzeptes) vertieft die Analyse unter Anwendung des Bourdieuschen Habituskonzepts, untersucht den Einfluss sozialer Herkunft und Migration und die Rolle von Erziehung und elterlichem Kapital.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind Inklusion, Exklusion, Schule, Bildungssystem, Pierre Bourdieu, Habitus, Kapitalformen (kulturelles, soziales, symbolisches Kapital), soziale Ungleichheit, Bildungsverlierer, Armut, soziale Herkunft, Migration, Lehrkräfte, Eltern und Praxisanalyse.
Wie wird das Bourdieusche Habituskonzept in der Arbeit verwendet?
Das Bourdieusche Habituskonzept dient als zentrale analytische Grundlage. Es hilft, die Reproduktion sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem zu verstehen und die Auswirkungen von verschiedenen Kapitalformen (kulturelles, soziales, symbolisches Kapital) auf den Bildungserfolg zu analysieren.
Welche Länder werden im Vergleich zum deutschen Bildungssystem herangezogen?
Die Arbeit zieht Vergleiche zum deutschen Bildungssystem mit den Bildungssystemen Skandinaviens und Kanadas.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Exklusionsprozesse in Schulen kritisch zu untersuchen und die Rolle verschiedener Akteure (Lehrkräfte, Eltern etc.) dabei zu analysieren. Sie möchte ein besseres Verständnis gesellschaftlicher Ungleichheiten im Bildungsbereich schaffen.
- Arbeit zitieren
- Manuel Lemke (Autor:in), 2016, Die Schule als Ort von Inklusivität und Exklusivität. Eine Praxisanalyse auf der Grundlage von Pierre Bourdieu, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337910