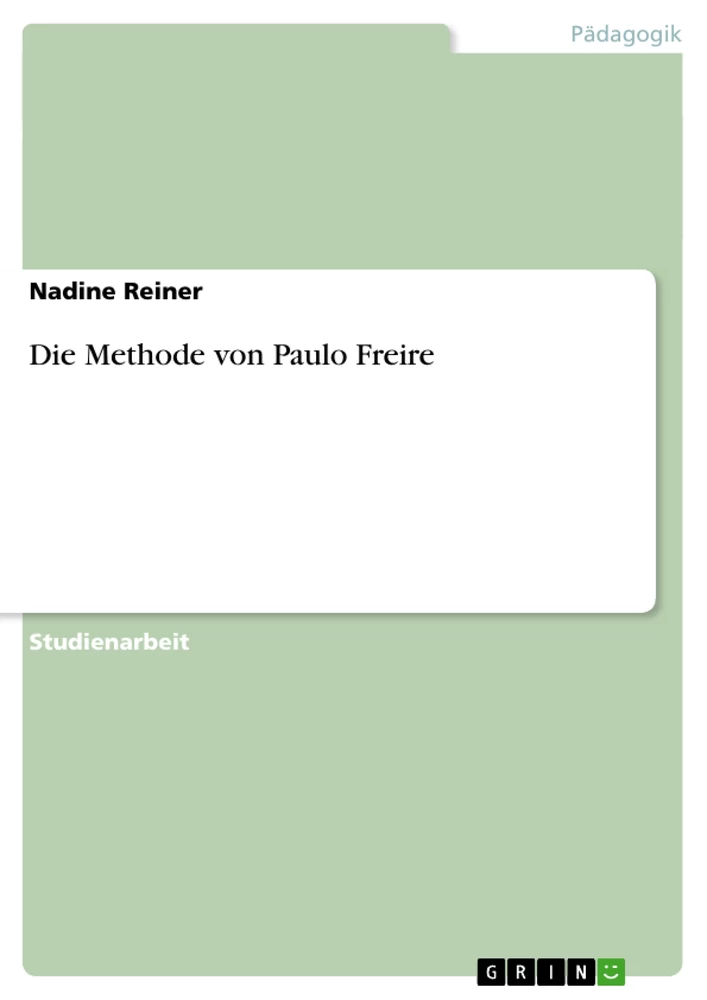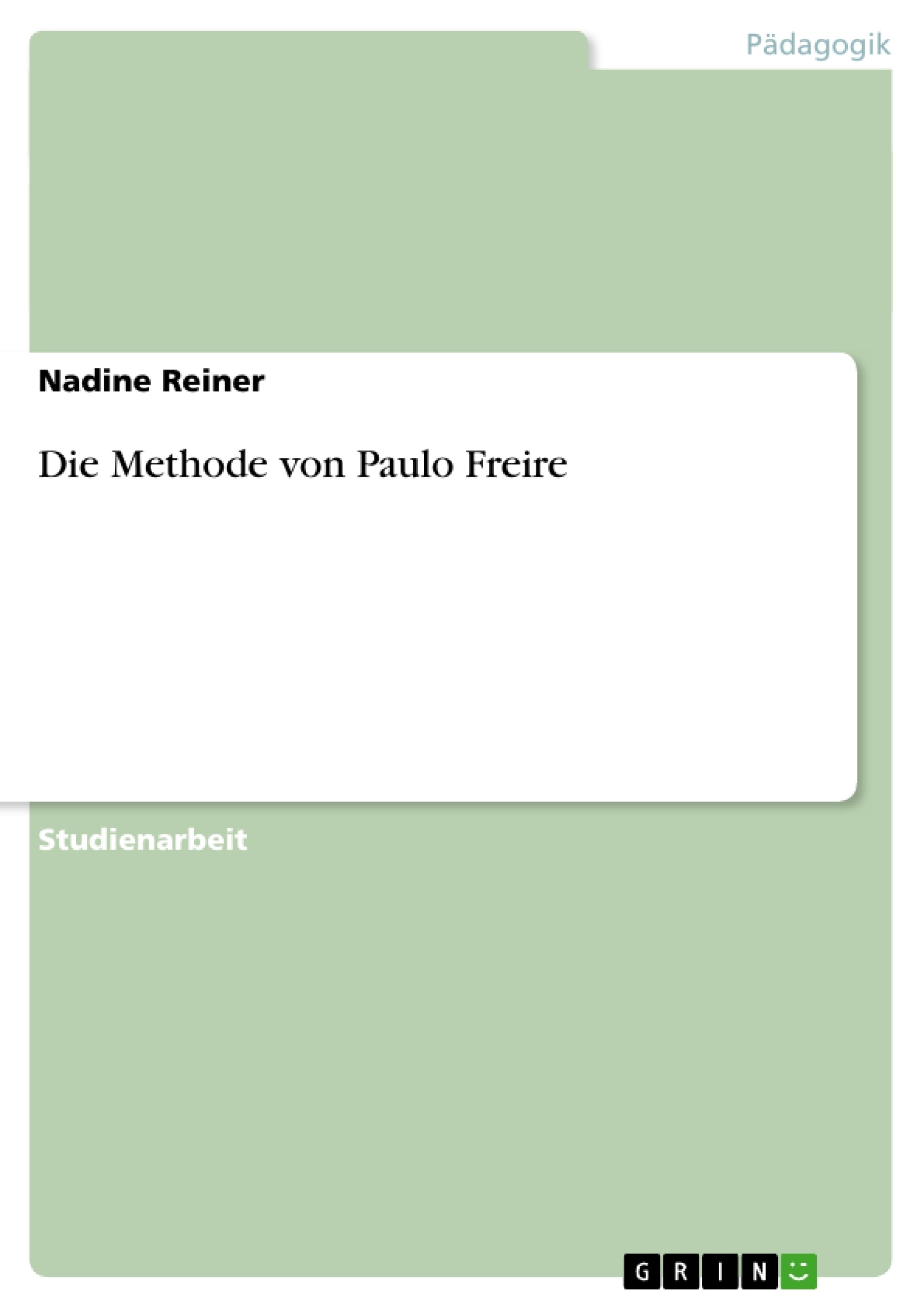Paulo Freire wurde 1921 in Brasilien geboren. Seine Familie gehörte der sozialen Mittelschicht an und er wurde christlich erzogen. Der christliche Gedanke prägt seine Methode und sein Menschenbild. Weiterhin beeinflussten ihn, in seiner Arbeit, Personen wie Sartes i. V. m. Gabriel Marcels, Ortega y. Gasset. Auch anthropologische und philosophische Grundgedanken von Marx und Fromm zeichnen seine Arbeit aus. In seiner methodische Arbeit ist der Einfluss von Hegel erkennbar. Bei der Durchführung greift er auf Mao Tse Tung zurück. Und seine Vorbilder auf politischer Ebene waren Guevara und Martin Luther King. Um die Methode von Paulo Freire zu verinnerlichen und danach zu handeln, ist es unserer Meinung nach wichtig, das Leben und seine Grundlagen für die Entwicklung seiner Methode kurz zu erläutern. Paulo Freire arbeitete als Lehrer und später als Professor und ihm wurde so die Lage der Bevölkerung in Brasilien vor Augen geführt. Die Mehrheit der Bevölkerung (70 – 75%) bestand aus Analphabeten, die aufgrund dessen kein Wahlrecht besaßen. Die Landbevölkerung war überwiegend verarmt und den Herrschaftsverhältnissen ausgeliefert. Durch seine Professur in Pädagogik, Philosophie und Geschichte interessierte er sich für die Erwachsenenbildung und engagierte sich schon früh für die Alphabetisierung der Bevölkerung. Er war sehr unzufrieden mit der Situation in der Erwachsenbildung, da für die Beschulung der Erwachsenen die gleichen Lehrmittel verwendet wurden, wie für Schulkinder. Außerdem wurde beim Lehrplan keine Rücksicht auf die Lebenswelt der Landbevölkerung genommen. Es wird die vorherrschende Bankiers-Erziehung, die später genauer erläutert wird, angewendet.
Zur gleichen Zeit war die brasilianische Gesellschaft in einem Umbruch. Ein Teil der Bevölkerung hielt an der geschlossenen Gesellschaft mit ihren Normen und Werten fest, und der andere hingegen wollte die Gesellschaft öffnen. In dieser Situation entstanden viele entgegengesetzte Tendenzen. So kam Freire zu der Frage ob und wie das Volk auf diese Entwicklungen vorbereitet war. Diese Umbruchsituation führte dazu, dass Paulo Freire es als nötig ansah eine Pädagogik zu entwickeln, die sich an die Situation des unterdrückten Volkes anpasst.
Inhaltsverzeichnis
- Methoden allgemein
- Paulo Freire
- Grundlagen seiner Theorie
- Methodische Umsetzung Praktisches Beispiel der Umsetzung in Lateinamerika
- Übertragung der Methode auf Industrienationen
- praktisches Beispiel
- Reflektion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Pädagogik der Unterdrückten von Paulo Freire und ihre Bedeutung für die Erwachsenenbildung. Er beleuchtet die philosophischen und methodischen Grundlagen der Freire´schen Methode, sowie die praktische Umsetzung in unterschiedlichen Kontexten.
- Die Entstehung der Pädagogik der Unterdrückten im Kontext der brasilianischen Gesellschaft
- Die Grundprinzipien der Freire´schen Methode, einschließlich des Dialogs, der Bewusstseinsbildung und der Problemformulierenden Bildung
- Der Gegensatz zur Bankiers-Methode und ihre Auswirkungen auf die Denk- und Handlungsfähigkeit
- Die Bedeutung des Dialogs und der kritischen Reflexion für den Prozess der Befreiung
- Die Übertragbarkeit der Freire´schen Methode auf Industrienationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Methoden allgemein: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Erwachsenenbildung ein und stellt verschiedene Methoden vor.
- Paulo Freire: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Leben und Werk von Paulo Freire. Es werden seine biografischen Hintergründe und die Einflüsse auf seine Arbeit beschrieben. Außerdem werden die wichtigsten Elemente seiner Pädagogik, wie die Bewusstseinsbildung und der Dialog, beleuchtet.
- Grundlagen seiner Theorie: Dieser Abschnitt behandelt die theoretischen Grundlagen der Freire´schen Methode, insbesondere die Bedeutung der Humanisierung und die Rolle der Unterdrückten in der Entwicklung einer Befreiungspädagogik.
- Methodische Umsetzung Praktisches Beispiel der Umsetzung in Lateinamerika: Dieses Kapitel erläutert die praktische Anwendung der Freire´schen Methode in Lateinamerika. Es werden konkrete Beispiele für die Umsetzung der Methode in der Erwachsenenbildung vorgestellt.
- Übertragung der Methode auf Industrienationen: In diesem Abschnitt wird die Übertragbarkeit der Freire´schen Methode auf Industrienationen diskutiert. Es werden sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Anwendung der Methode in einem anderen Kontext analysiert.
- praktisches Beispiel: Dieses Kapitel präsentiert ein praktisches Beispiel für die Umsetzung der Freire´schen Methode in einer Industrienation. Es werden die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der konkreten Anwendung der Methode in einem bestimmten Projekt aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Pädagogik der Unterdrückten, Paulo Freire, Dialog, Bewusstseinsbildung, Problemformulierende Bildung, Bankiers-Methode, Humanisierung, Emanzipation, Befreiung, Unterdrückung, soziale Transformation, Erwachsenenbildung.
- Quote paper
- Nadine Reiner (Author), 2003, Die Methode von Paulo Freire, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33795