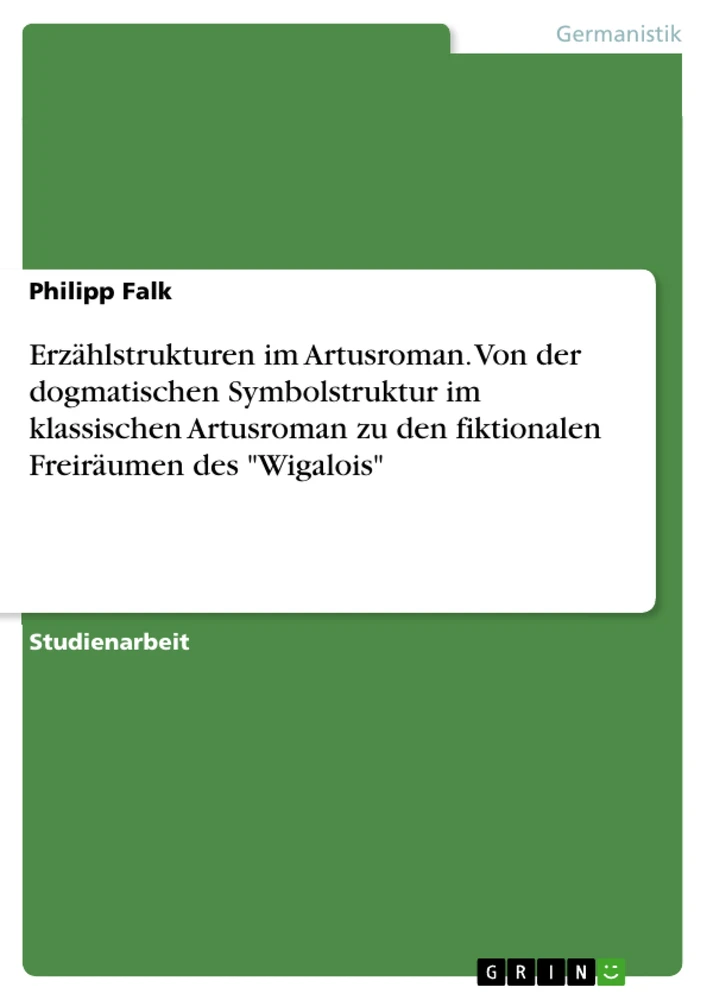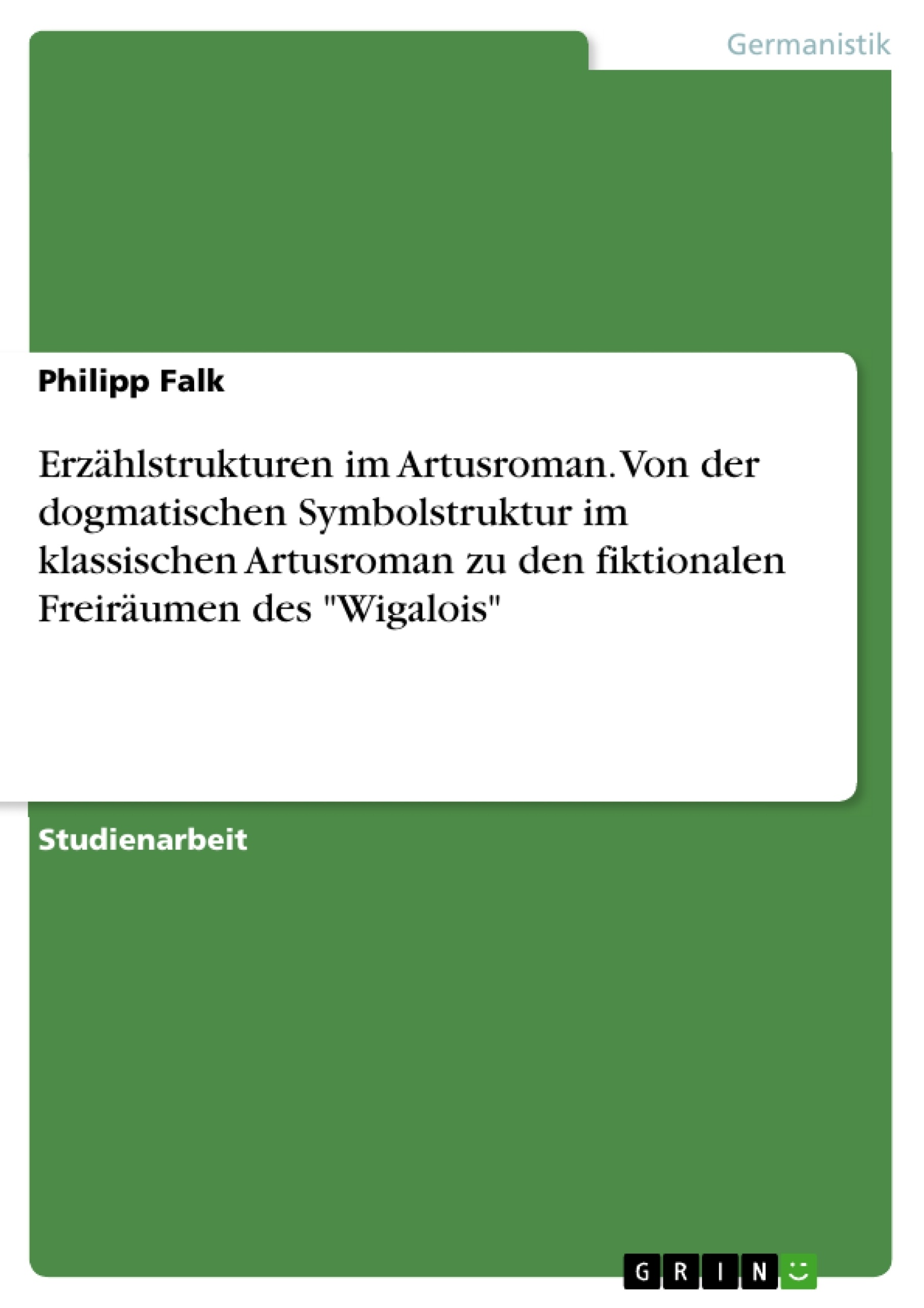Die vorliegende Hausarbeit thematisiert die divergierenden Erzählstrukturen im klassischen und nachklassischen Artusroman. Dabei liegt ein Fokus auf der von der älteren germanistischen Artusforschung angelegten Schablone des Doppelwegs mit Symbolstruktur, sowie der Verwerfung ebendieser übergeordneten Erklärungsstruktur zugunsten eines späteren Artusromans, der sich in jüngeren Forschungsansätzen durch seine Öffnung hin zu mehr fiktionalem Freiraum auszeichnet. Der Analyse zu dieser gattungsimmanenten Dynamisierung liegt – neben der verwendeten Sekundärliteratur – Wirnt von Grafenbergs „Wigalois“ als Fundament der Untersuchung zugrunde. Als hierbei entscheidendes Konstituens wird die Untersuchung der abweichenden Darstellungen des Protagonisten der Handlung eine Vorrangstellung einnehmen und der Versuch unternommen, den aufgrund seines linear verlaufenden Handlungsstrangs als defizitär ausgewiesenen „Wigalois“ zu einem progressiven Fortschritt innerhalb der literarischen Reihe auszuweisen.
Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in einen Dreischritt: In einem ersten Schritt gilt es, Besonderheiten und strukturelle Merkmale der früheren sogenannten Gipfelromanen der Artusliteratur ausfindig zu machen und forschungsgeschichtliche Etappen bezüglich der sinnvermittelnden Symbolstruktur zu untersuchen. Darauf folgend nehme ich Bezug auf kritische Schriften in der jüngeren germanistischen Mediävistik, welche die von Hugo Kuhn eingeführte Symbolstruktur zu relativieren und andere Zugänge zur Erschließung der intra- und intertextuellen Bezüge in den Artuswerken freizulegen versuchen. Der Hauptteil meiner Untersuchungen liegt in der Analyse des „Wigalois“ auf personenorientierte Indizien hin, die einen divergierenden Heldentypus offenbaren und die Erzähltechnik des Wirnt von Grafenberg als progressiven Fortschritt in der Artuserzählung plausibel erklären können. Dabei soll eine Argumentation entwickelt werden, die einer Zuschreibung als defizitär epigonales Werk entgegen wirken kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gattungs- und Strukturmerkmale des Artusromans
- Kritiken zur Symbolstruktur
- Wigalois
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Erzählstrukturen im klassischen und nachklassischen Artusroman, wobei der Fokus auf der traditionellen Symbolstruktur des Doppelwegs und deren Auflösung im späteren Artusroman liegt. Die Arbeit analysiert Wirnts von Grafenbergs Wigalois als Beispiel für einen Artusroman mit größerem fiktionalem Freiraum. Die abweichende Darstellung des Protagonisten im Wigalois wird im Zentrum der Analyse stehen.
- Entwicklung der Erzählstrukturen im Artusroman
- Die traditionelle Symbolstruktur des Doppelwegs
- Auflösung der Symbolstruktur und zunehmende fiktionale Freiräume
- Analyse des Wigalois als progressives Werk
- Die Darstellung des Protagonisten als Indikator für erzähltechnische Fortschritte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der divergierenden Erzählstrukturen im klassischen und nachklassischen Artusroman. Der Fokus liegt auf der traditionellen Symbolstruktur des Doppelwegs und deren Verwerfung im Wigalois, welches als Beispiel für einen Artusroman mit größerem fiktionalem Freiraum dient. Die Arbeit untersucht die abweichende Darstellung des Protagonisten im Wigalois und argumentiert gegen dessen Einstufung als defizitäres, epigonales Werk.
Gattungs- und Strukturmerkmale des Artusromans: Dieses Kapitel beleuchtet die Unterscheidung zwischen klassischen und nachklassischen deutschen Artusromanen basierend auf ihren Gestaltungsmerkmalen. Es diskutiert die lange Vorrangstellung der „klassischen Gipfelwerke“ in der Forschung und die Abwertung späterer Werke als „epigonal“. Es wird ein Exkurs über forschungsgeschichtliche Etappen zur Artusliteratur gegeben, beginnend mit Chrétien de Troyes' Erec et Enide als Gattungsbegründer und Hartmanns von Aue's Erec als erstes deutsches Beispiel. Das Kapitel beschreibt das gängige Strukturmodell des Doppelwegs im Artusroman, basierend auf den Arbeiten von Hugo Kuhn und Walter Haug, mit seinem Aufbau aus zwei korrespondierenden Teilen im biographischen Weg des Helden und seiner symbolischen Aussagekraft.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Erzählstrukturen im Artusroman am Beispiel von Wirnts Wigalois
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Erzählstrukturen im klassischen und nachklassischen Artusroman. Der Fokus liegt auf der traditionellen Symbolstruktur des Doppelwegs und deren Auflösung im späteren Artusroman, insbesondere am Beispiel von Wirnts von Grafenbergs Wigalois. Die Analyse konzentriert sich auf die abweichende Darstellung des Protagonisten in Wigalois und dessen Bedeutung für erzähltechnische Fortschritte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert Wigalois als Beispiel für einen Artusroman mit größerem fiktionalem Freiraum und widerlegt die gängige Abwertung späterer Artusromane als „epigonal“. Sie zeigt die Entwicklung der Erzählstrukturen auf, untersucht die traditionelle Symbolstruktur des Doppelwegs und deren Auflösung, und analysiert Wigalois als progressives Werk.
Welche Aspekte des Artusromans werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Gattungs- und Strukturmerkmale des Artusromans, unterscheidet zwischen klassischen und nachklassischen Werken und diskutiert die forschungsgeschichtliche Einordnung der Artusliteratur. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Strukturmodell des Doppelwegs und seiner symbolischen Bedeutung. Die Analyse des Wigalois konzentriert sich auf die Darstellung des Protagonisten als Indikator für erzähltechnische Fortschritte.
Welche Rolle spielt Wigalois in der Arbeit?
Wigalois dient als Fallstudie für einen nachklassischen Artusroman, der von der traditionellen Symbolstruktur des Doppelwegs abweicht und einen größeren fiktionalen Freiraum aufweist. Die abweichende Darstellung des Protagonisten im Wigalois steht im Zentrum der Analyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Gattungs- und Strukturmerkmalen des Artusromans, ein Kapitel zu Kritiken der Symbolstruktur, ein Kapitel zu Wigalois und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung, während die anderen Kapitel die jeweiligen Themen im Detail behandeln.
Wie wird die traditionelle Symbolstruktur des Doppelwegs behandelt?
Die Arbeit beschreibt das gängige Strukturmodell des Doppelwegs im Artusroman, basierend auf den Arbeiten von Hugo Kuhn und Walter Haug. Sie analysiert die Auflösung dieser Struktur in späteren Werken und zeigt, wie Wigalois von diesem traditionellen Modell abweicht.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Der Inhalt des Fazits ist nicht explizit in der Vorschau enthalten. Die Arbeit argumentiert jedoch gegen die Einstufung von Wigalois als defizitäres, epigonales Werk und betont dessen progressive Aspekte.)
- Citation du texte
- Philipp Falk (Auteur), 2016, Erzählstrukturen im Artusroman. Von der dogmatischen Symbolstruktur im klassischen Artusroman zu den fiktionalen Freiräumen des "Wigalois", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338097