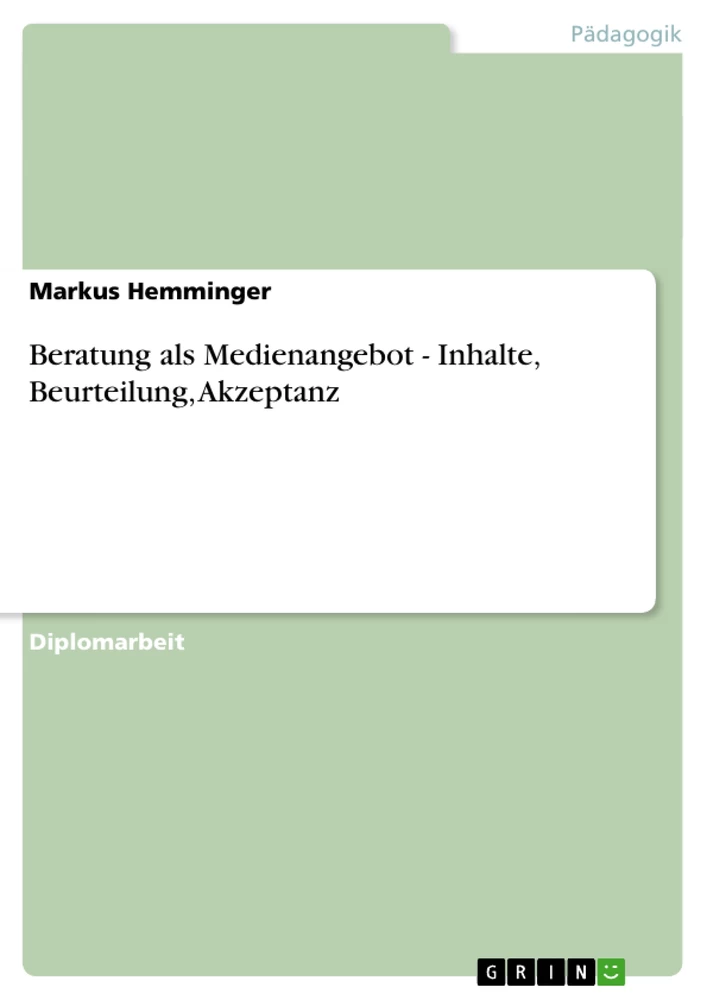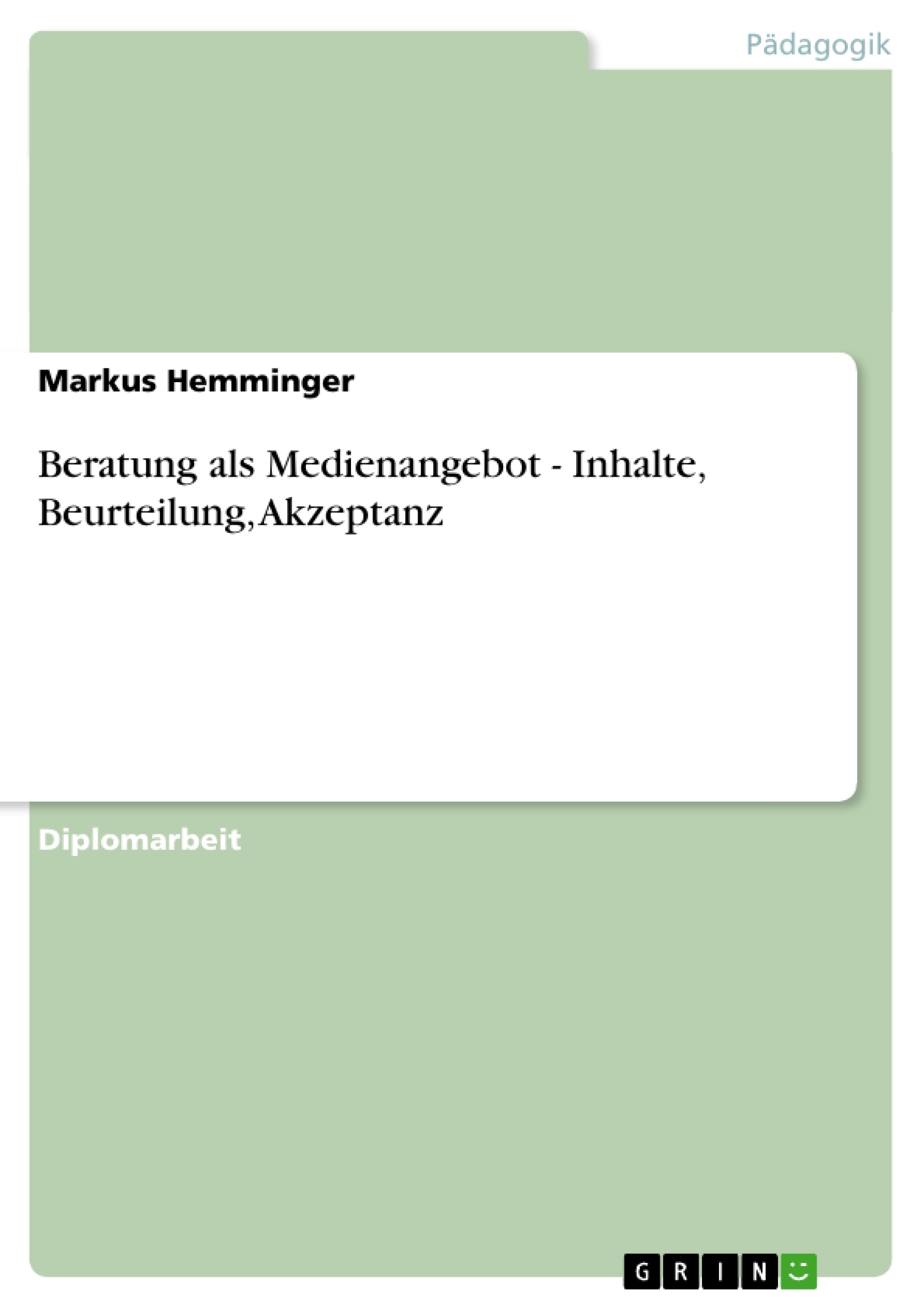Die meisten Menschen haben im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal Probleme, die so groß scheinen, dass sie diese nicht mehr alleine lösen können. Hilfe wird dann bei Freunden oder anderen Vertrauten gesucht oder die Probleme werden verdrängt und nicht selten dadurch nur noch größere aufgebaut. Mehrere Berufsgruppen haben sich darauf spezialisiert, Menschen bei eben solchen Problemen zu helfen, unter anderem Pädagogen und Psychologen. Doch auf diese professionelle Hilfe wird häufig nicht zurückgegriffen. Viele Menschen scheinen den Gang zu einer Beratungseinrichtung zu scheuen. Vielleicht aus Angst vor mangelnder Anonymität, oder weil Beratungsstellen gesellschaftlich nicht die Akzeptanz genießen, die der einzelne für notwendig erachtet.
Beratungseinrichtungen gibt es von den unterschiedlichsten Trägern (Pro Familia, Kirchen, Rotes Kreuz ...) mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten (allgemein, Erziehung, Familien, Sexualität, Drogen, Alkohol). Doch neben der traditionellen Beratungsstelle gibt es auch Beratung als Medienangebot. Manche Formen gibt es schon länger (Telefonseelsorge, spezielle Radiosendungen, Ratgeberseiten in Zeitschriften mit Leserbriefen), andere gibt es erst seit relativ kurzer Zeit (z.B. Internetangebote). Je nach Medium können diese Beratungsformen unterschiedlich intensiv ihrer Beratungsfunktion nachkommen und somit ihre selbst gesteckten Ziele erreichen, und sind deshalb für bestimmte Probleme besser geeignet als andere. Doch wie bekannt sind solche Angebote? Wie häufig werden sie genutzt? Sind sie eine Alternative zur persönlichen Beratung oder nur eine Ergänzung? Sind sie wenig wirksame Spinnerei oder vielleicht doch ein sinnvoller Einstieg? Liegt die Hemmschwelle zur Nutzung eines „medialen“ Beratungsangebots tatsächlich niedriger als beim Besuch einer Beratungseinrichtung? Welche Möglichkeiten gibt es, mediale Beratungsangebote mit realen Beratungseinrichtungen zu kombinieren und somit ein optimales Beratungsangebot für Ratsuchende zu schaffen?
Mit diesen Fragestellungen will sich die vorliegende Arbeit befassen. Zunächst soll aufgezeigt werden, was hier unter Beratung verstanden wird und was sie zum Ziel hat. Dann wird der Bereich der Medien eingegrenzt und es werden beispielhaft einige Beratungsangebote, die als Medienform auftreten, dargestellt.
Um die oben aufgeworfenen Fragen zu beantworten, soll in einem empirischen Teil die Akzeptanz von Beratung und speziell von medialen Beratungsangeboten abgefragt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beratung
- Begriffsbestimmung
- Ursachen für den Beratungsbedarf
- Allgemeine Ziele von Beratung
- Beratung und Therapie
- Geschichte der Beratung
- Erziehungsberatung in Zahlen
- Theoretische Ansätze von Beratung
- Psychodynamische Konzepte
- Humanistische Konzepte
- Lern- und verhaltenstheoretische Konzepte
- Systemtheoretische Konzepte
- Beratungsformen
- Traditionelle Beratungsstelle
- Fernsehen
- Radio
- Printmedien
- Internet
- Die kommerzielle Online-Beratung „www.beratung-therapie.de“
- Online-Angebot von Pro Familia
- Telefon
- Wichtige Unterschiede zwischen face-to-face-Beratungssituationen und entsprechenden Medienangeboten
- Bisher vorliegende Ergebnisse zur Akzeptanz von Beratung als Medienangebot
- Grenzen und Chancen von Ratgeberkolumnen (Borneman, 1988)
- BRAVO (Wenzel, 1988)
- Lösungsorientierte Beratung im Internet (Stumpp, 2001)
- Selbsthilfe, Beratung und Therapie im Internet (Döring, 1997)
- Das Telefon in der Krisenhilfe (Stauß, 1990)
- Begründung der Fragestellung
- Empirischer Teil
- Hypothesenbildung
- Methoden und Stichprobe
- Aufbau des Fragebogens
- Ergebnisse
- Zusammenfassung und Interpretation der gesammelten Daten
- Kritische Betrachtung der Untersuchung
- Fazit
- Literatur
- Anhang
- Fragebogen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit „Beratung als Medienangebot: Inhalte, Beurteilung und Akzeptanz“ analysiert die Einsatzmöglichkeiten von Medien in der psychosozialen Beratung. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Formen von Beratungsangeboten in Medien wie Fernsehen, Radio, Printmedien, Internet und Telefon.
- Analyse der Unterschiede zwischen face-to-face-Beratungssituationen und Medienangeboten
- Bewertung der Akzeptanz von Beratungsangeboten in Medien
- Untersuchung der Grenzen und Chancen verschiedener Medienformate in der Beratung
- Empirische Untersuchung der Akzeptanz von Beratungsangeboten in Medien
- Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der Akzeptanz von Beratung in Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Diplomarbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Beratung. Dabei werden der Begriff, Ursachen für den Beratungsbedarf, allgemeine Ziele und die Geschichte der Beratung behandelt. Auch die theoretischen Ansätze von Beratung werden in diesem Kapitel erläutert.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Beratungsformen vorgestellt, darunter die traditionelle Beratungsstelle, Fernsehen, Radio, Printmedien, Internet und Telefon. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Besonderheiten der Online-Beratung gelegt. Die Arbeit beleuchtet auch die Unterschiede zwischen face-to-face-Beratungssituationen und entsprechenden Medienangeboten.
Im dritten Kapitel werden bereits vorhandene Ergebnisse zur Akzeptanz von Beratung als Medienangebot vorgestellt. Hierbei werden verschiedene Studien zur Akzeptanz von Ratgeberkolumnen, BRAVO, lösungsorientierter Online-Beratung, Selbsthilfe im Internet und Telefonhilfe in der Krisenhilfe analysiert.
Schlüsselwörter
Beratung, Medien, Medienangebote, Akzeptanz, Online-Beratung, Telefonberatung, Erziehungsberatung, Psychosoziale Beratung, Theoretische Ansätze, Empirische Forschung, Fragebogen, Mediennutzung, Kommunikation
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen medialer und persönlicher Beratung?
Die Arbeit untersucht Unterschiede in der Intensität, Anonymität und Erreichbarkeit zwischen Face-to-Face-Gesprächen und Angeboten via Internet, Telefon oder TV.
Welche Medien werden als Beratungsplattformen genutzt?
Dazu gehören das Internet (Online-Beratung), das Telefon (Krisenhilfe), Radio, Fernsehen und Printmedien (z.B. Ratgeberkolumnen in Zeitschriften).
Warum scheuen viele Menschen den Gang zu einer Beratungsstelle?
Häufige Gründe sind mangelnde Anonymität, soziale Stigmatisierung oder Schwellenängste, die bei medialen Angeboten oft niedriger sind.
Welche theoretischen Konzepte liegen der Beratung zugrunde?
Die Arbeit behandelt psychodynamische, humanistische, lern- und verhaltenstheoretische sowie systemtheoretische Konzepte.
Ist Online-Beratung eine vollwertige Alternative zur Therapie?
Die Studie diskutiert, ob mediale Angebote lediglich eine Ergänzung oder ein sinnvoller Einstieg in die professionelle Hilfe darstellen können.
- Arbeit zitieren
- Markus Hemminger (Autor:in), 2003, Beratung als Medienangebot - Inhalte, Beurteilung, Akzeptanz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33821