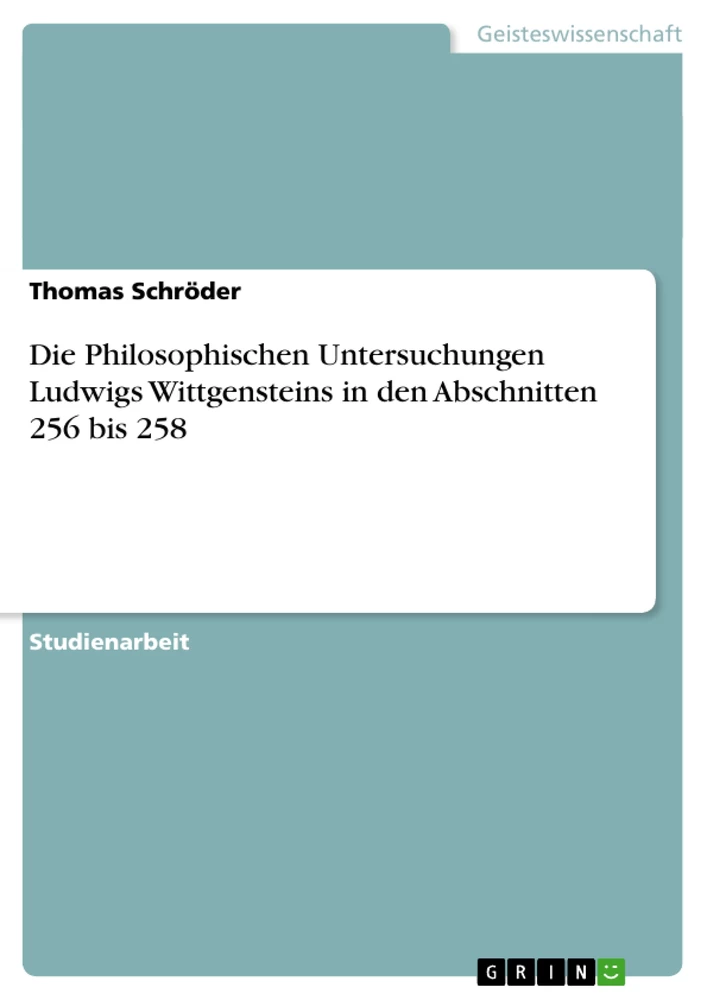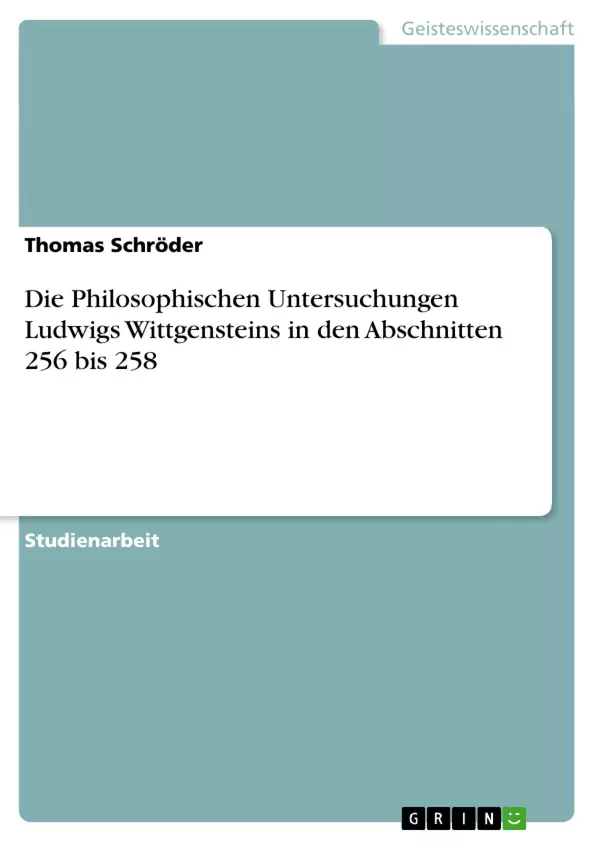Bei der Interpretation von Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen findet der Leser sich konfrontiert mit einem mehrdeutigen und zum Teil epigrammatischen Stil, der zusammen mit der bisweilen völlig unsystematisch erscheinenden Struktur der Aufzeichnung die Gefahr der Verwirrung birgt.
Um Wittgensteins Subtilität und schillernde gedankliche Tiefe sicher auslegen zu können, bedarf es einer Reihe von Vorkenntnissen zu Überlegungen und dem philosophischen Ansinnen Wittgensteins.
Die vorliegende Arbeit leistet den Versuch, die Abschnitte 256 bis 258 der Philosophischen Untersuchungen verständlich auszulegen und unter Zuhilfenahme von Sekundärliteratur zu erhellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Abschnitt 258, in dem Wittgenstein die Frage behandelt, welches Kriterium zur Prüfung der Richtigkeit einer Erinnerung möglich beziehungsweise notwendig ist.
Der Verfechter einer Privatsprache richtet seine Aufmerksamkeit auf seine eigene, private Empfindung und beobachtet diese. Er geht davon aus, dass dieser introspektive Prozess zum Erkennen seiner privaten, inneren (Wittgestein verwendet diese Begriffe synonym) Empfindung hinreichend ist. Wittgenstein entkräftet diese Argumentation, indem er in PU 258 das Fehlen eines Kriteriums zur Richtigkeitsprüfung für eine Erinnerung konstatiert. Seiner Meinung nach kann die reine Introspektion keine Definition von irgendetwas geben.
Die Frage, inwieweit die verschiedenen Abschnitte der PU zueinander kompatibel, das heißt logisch konsistent sind, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht erörtert werden. Stattdessen wird anhand der betrachteten Beispiele Wittgensteins Haltung zur traditionellen Philosophie gedeutet, die er in weiten Teilen für fehlgeleitet hält und deren theoretische Problembestimmungen und –lösungen er als nutzlos für die praktische, positivistisch verstandene Wirklichkeit ansieht. Es wird umrisshaft und implizit Wittgensteins Auffassung verdeutlicht, die die eigentliche Aufgabe der Philosophie in der stückweisen, segmentären Beschreibung dessen sieht, was Sprache leistet; eine Auffassung, mit der Wittgenstein der traditionellen Philosophie einen missverständlichen Gebrauch sprachlicher Ausdrücke unterstellt und mit der sich nichts Geringeres als die Forderung nach einer Ent-Theoretisierung der gesamten Philosophie verbindet sowie die Reduktion auf lokale Beschreibungen von immer Gewusstem.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Wittgensteins Philosophie in den Philosophischen Untersuchungen
- Abschnitte 256 bis 258
- PU 256
- PU 257
- PU 258
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit widmet sich der Interpretation der Abschnitte 256 bis 258 der Philosophischen Untersuchungen Ludwigs Wittgensteins. Sie analysiert insbesondere Abschnitt 258, in dem Wittgenstein die Frage nach einem Kriterium für die Richtigkeit einer Erinnerung behandelt und argumentiert, dass reine Introspektion keine Definition von irgendetwas liefern kann.
- Kritik an der Idee einer Privatsprache
- Das Fehlen eines Kriteriums zur Richtigkeitsprüfung von Erinnerungen
- Die Rolle der Sprache in der Philosophie
- Wittgensteins Auffassung von der Aufgabe der Philosophie
- Die Beschreibung sprachlicher Praktiken
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Arbeit befasst sich mit der Interpretation der Abschnitte 256 bis 258 der Philosophischen Untersuchungen, insbesondere mit Abschnitt 258, in dem Wittgenstein die Frage nach einem Kriterium zur Prüfung der Richtigkeit von Erinnerungen behandelt. Die Arbeit erklärt, dass Wittgensteins Philosophie aufgrund ihres mehrdeutigen und epigrammatischen Stils Herausforderungen für die Interpretation bietet.
Wittgensteins Philosophie in den Philosophischen Untersuchungen
Die Arbeit zeichnet Wittgensteins Philosophie in den Philosophischen Untersuchungen nach und präsentiert seine zentralen Argumente, die sich gegen die traditionellen philosophischen Ansätze richten. Sie beschreibt, dass Wittgensteins Philosophie nicht darin besteht, Theorien aufzustellen, sondern die „Arbeit von Sprache“ zu beschreiben und lokale Missverständnisse aufzulösen.
Abschnitte 256 bis 258
Die Arbeit erläutert die Argumentation Wittgensteins in den Abschnitten 256 bis 258, die sich mit der Frage nach der Privatheit von Namen und Zeichen auseinandersetzt. Die Arbeit betont die Bedeutung des „Privatsprachenarguments“, das den Kern der Kritik an der Möglichkeit einer privaten Sprache bildet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die philosophischen Untersuchungen Ludwigs Wittgensteins, insbesondere auf die Abschnitte 256 bis 258. Schlüsselbegriffe sind Privatsprachenargument, Introspektion, Richtigkeitsprüfung, Erinnerung, Sprache, Beschreibung, Philosophie, und therapeutische Auflösung.
- Quote paper
- Thomas Schröder (Author), 2004, Die Philosophischen Untersuchungen Ludwigs Wittgensteins in den Abschnitten 256 bis 258, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33822