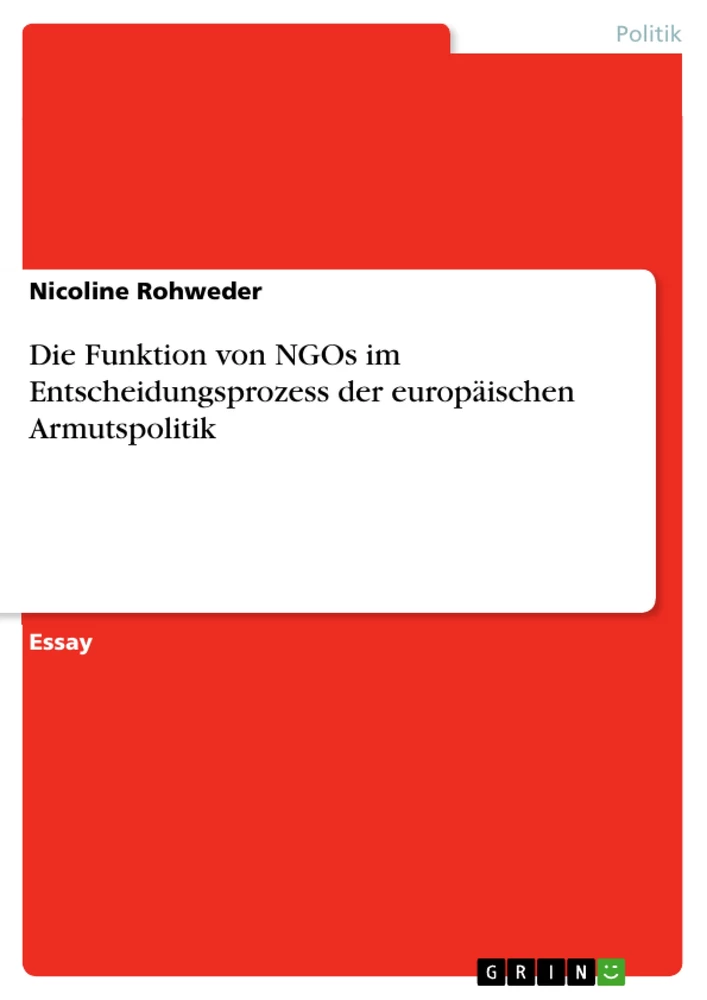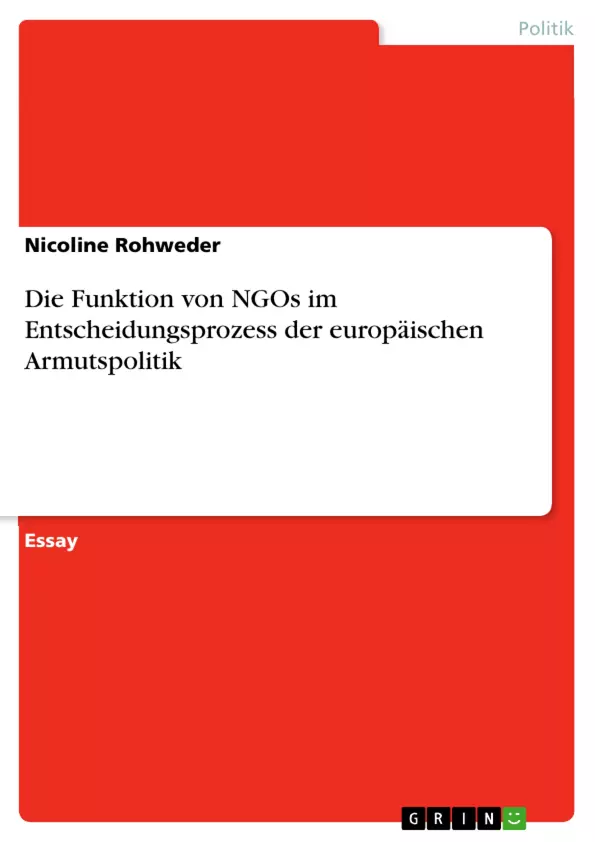Der fünfte Armuts- und Reichtumsbericht erscheint 2016 und wird der Bundesregierung vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgelegt. Der Bericht wird alle fünf Jahre neu verfasst und ganz entscheidend von zivilgesellschaftlichen Akteuren geprägt. Doch welche Aufgabe übernehmen NGOs in diesem Prozess? Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten werden ihnen im politischen Entscheidungsprozess geboten? Mit welcher Zielsetzung beteiligen sich NGOs in der EU-Politik? Diese zentralen Fragen werden innerhalb dieser Ausarbeitung analysiert, um die Forschungsfrage, welche Funktion NGOs im politischen Entscheidungsprozess der Armutspolitik der Europäischen Union übernehmen, begründet zu beantworten.
Im ersten Kapitel wird einleitend der Begriff der Sozialpolitik näher beleuchtet, eine Begriffsdefinition vorgenommen und die Aufgaben und Ziele der Europäischen Sozial-politik skizziert. Im Zuge dessen wird zudem die Methode der offenen Koordinierung kurz erläutert, da sie ein zentrales Element der europäischen Sozialpolitik darstellt. Im Anschluss findet im dritten Kapitel eine Eingrenzung der Thematik auf den Bereich der Armutspolitik statt. In Folge dessen werden zunächst die Begriffe relative und absolute Armut voneinander abgegrenzt, um im Anschluss auf die Armutsgefährdung in Europa einzugehen. Das vierte Kapitel widmet sich den politischen Strategien der EU-Politik, um der Armut entgegenzuwirken und wirtschaftliches Wachstum voranzutreiben. Dabei werden insbesondere die Einwirkungsmöglichkeiten der NGOs in den Fokus genommen und anschließend skizziert, an welchen Stellen des Politik-Zyklus, eine Einflussnahme stattfindet. Eine genaue Betrachtung der NGOs, ihrer Aufgaben und Ziele, erfolgt anschließend im fünften Kapitel.
Abgerundet wird die Arbeit durch die konkrete Auseinandersetzung mit Europa 2020 und der Einflussnahme des European Anti Poverty Network sowie dem Einfluss der EAPN auf die Erarbeitung des deutschen Armuts- und Reichtumsberichtes, der dann abschließend im sechsten Kapitel beleuchtet wird. Die Ausarbeitung schließt mit einem Fazit, dass die Kerngedanken bezüglich der Funktionen von NGOs im politischen Entscheidungsprozess gebündelt aufführt und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sozialpolitik.
- 2.1 Definition und Begriffsklärung
- 2.2 Die offene Methode der Koordinierung...
- 3. Armutsgefährdung in Europa.......
- 4. Die Rolle der Europäische Union in der Armutspolitik
- 4.1 Lissabon Strategie 2000
- 4.2 Europa 2020..
- 4.3 Das Europäische Jahr 2010
- 5. Die Rolle der NGOs in der Europäischen Armutspolitik
- 5.1 Definition NGOs...........
- 5.2 Aufgaben und Funktionen von NGOs.
- 6. Europa 2020 und der Einfluss der EAPN...
- 7. Der deutsche Armuts- und Reichtumsbericht 2011 und der Einfluss der EAPN
- 8. Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung untersucht die Rolle von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) im politischen Entscheidungsprozess der Armutspolitik der Europäischen Union. Sie analysiert die Aufgaben und Funktionen von NGOs in diesem Kontext und beleuchtet ihre Einwirkungsmöglichkeiten auf den Politikzyklus.
- Definition und Begriffsklärung von Sozialpolitik
- Die offene Methode der Koordinierung in der europäischen Sozialpolitik
- Armutsgefährdung in Europa
- Politische Strategien der EU-Politik zur Armutsbekämpfung
- Aufgaben und Funktionen von NGOs in der europäischen Armutspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet den Begriff der Sozialpolitik sowie die Aufgaben und Ziele der Europäischen Sozialpolitik. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der offenen Methode der Koordinierung als zentrales Element der europäischen Sozialpolitik. Kapitel 3 greift den Bereich der Armutspolitik auf und grenzt die Begriffe relative und absolute Armut voneinander ab. Kapitel 4 widmet sich den politischen Strategien der EU-Politik zur Armutsbekämpfung und betrachtet die Einwirkungsmöglichkeiten von NGOs. Kapitel 5 analysiert die Aufgaben und Ziele von NGOs im Detail. Kapitel 6 beleuchtet den Einfluss des European Anti Poverty Network (EAPN) auf Europa 2020 und den deutschen Armuts- und Reichtumsbericht.
Schlüsselwörter
Sozialpolitik, Armutspolitik, Europäische Union, NGOs, offene Methode der Koordinierung, European Anti Poverty Network (EAPN), Armuts- und Reichtumsbericht, Politikzyklus, Einflussnahme, Funktionen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion übernehmen NGOs in der europäischen Armutspolitik?
NGOs fungieren als Experten, Interessenvertreter und Mitgestalter in politischen Entscheidungsprozessen, insbesondere bei der Erarbeitung von Berichten zur sozialen Lage.
Was ist die „offene Methode der Koordinierung“?
Dies ist ein zentrales Instrument der europäischen Sozialpolitik, das auf freiwilliger Zusammenarbeit, Benchmarking und dem Austausch bewährter Verfahren zwischen Mitgliedstaaten basiert.
Wie unterscheidet die Arbeit zwischen relativer und absoluter Armut?
Absolute Armut bezieht sich auf das Fehlen existenzieller Grundbedürfnisse, während relative Armut die soziale Benachteiligung im Vergleich zum Durchschnittseinkommen einer Gesellschaft beschreibt.
Was ist das European Anti Poverty Network (EAPN)?
Das EAPN ist ein bedeutendes Netzwerk von NGOs, das massiven Einfluss auf die Strategie „Europa 2020“ und nationale Armutsberichte, wie den deutschen Armuts- und Reichtumsbericht, ausübt.
An welcher Stelle des Politik-Zyklus setzen NGOs an?
NGOs nehmen Einfluss auf die Problemdefinition, die Politikformulierung sowie die Überwachung und Bewertung politischer Maßnahmen zur Armutsbekämpfung.
- Quote paper
- Nicoline Rohweder (Author), 2015, Die Funktion von NGOs im Entscheidungsprozess der europäischen Armutspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338266